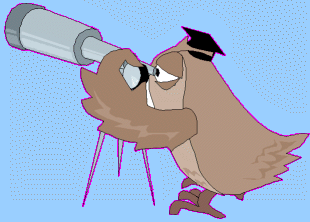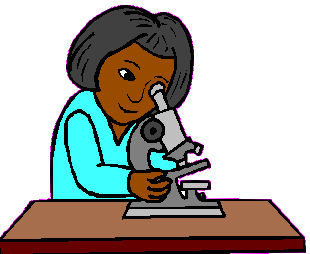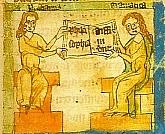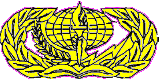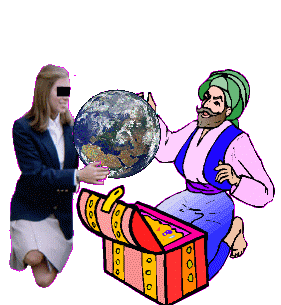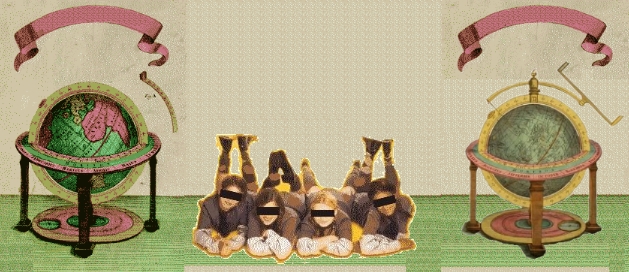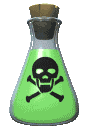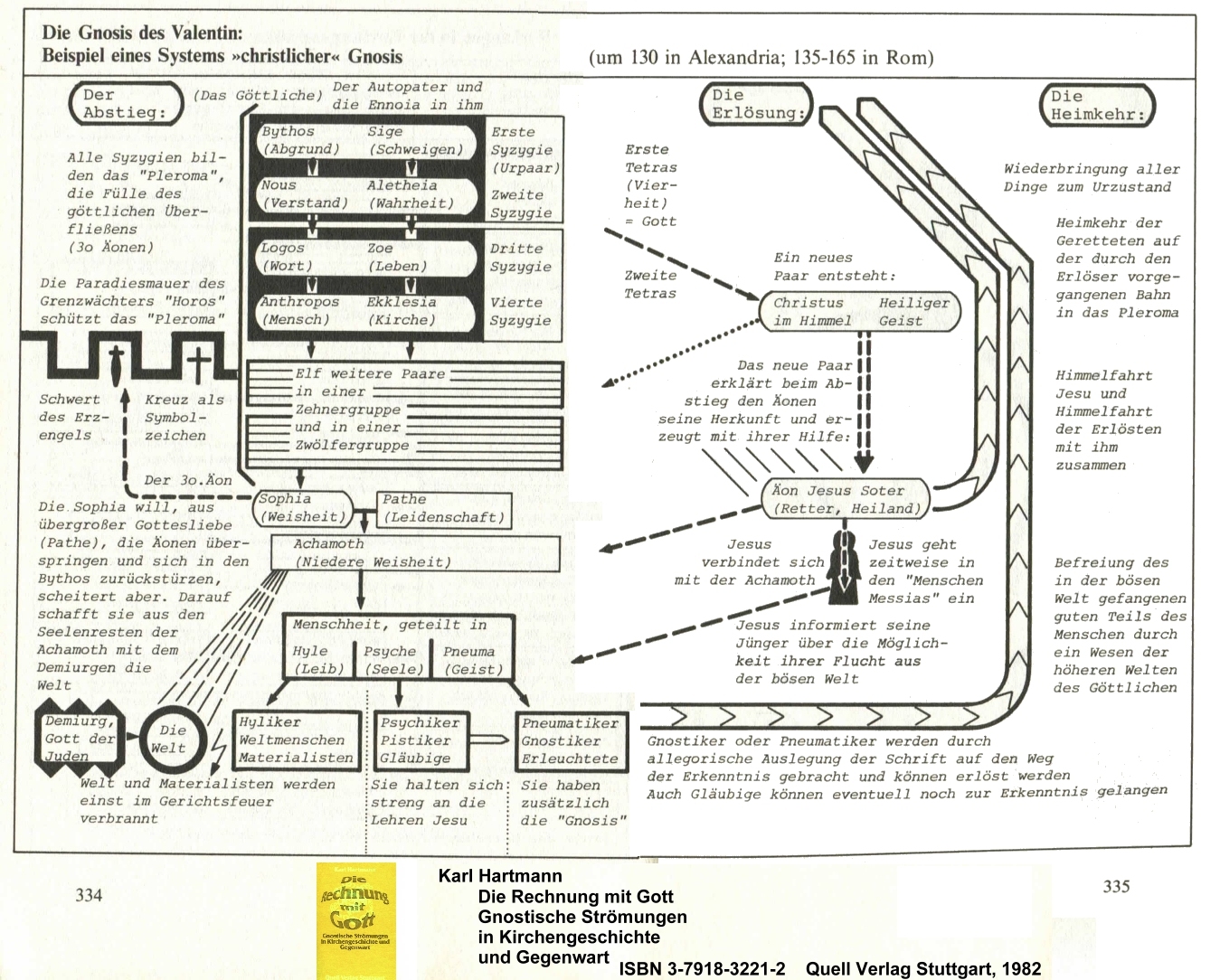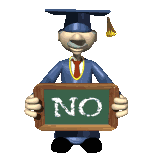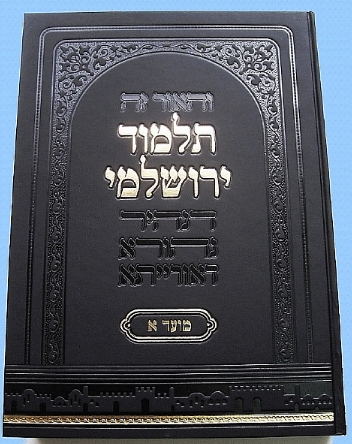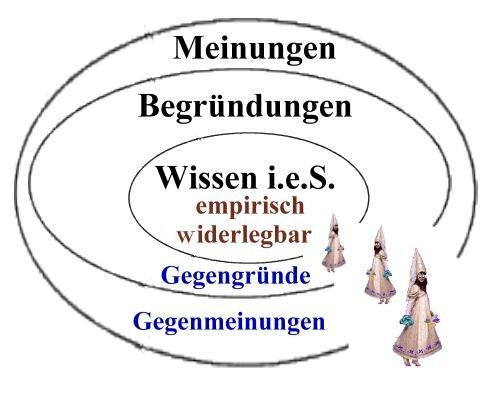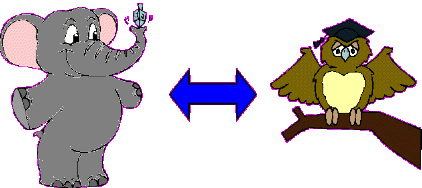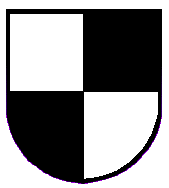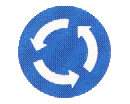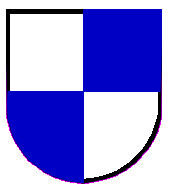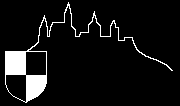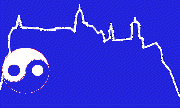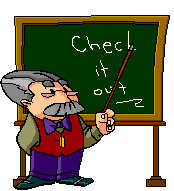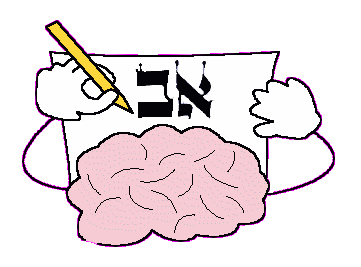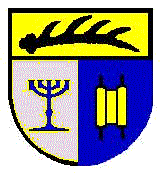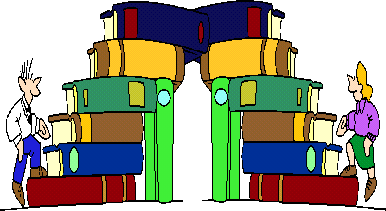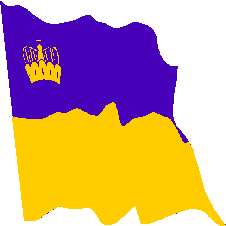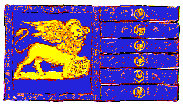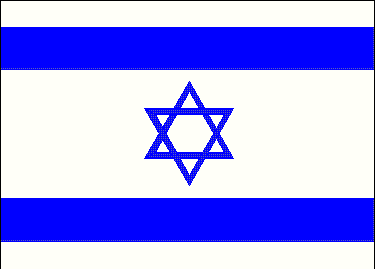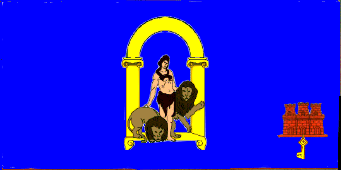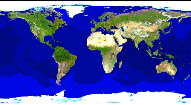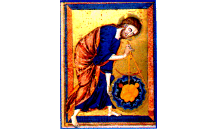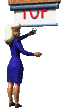9#Goldene#
Königsfrüchte stets in und/oder\aber auf Silber gereicht 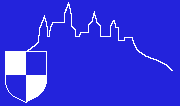 Modalitäten
an Rändern/Grenzern
konzeptionellen Denkens
undװaber begreifenden Verstehens, beziehungsweise Erfahrens
Modalitäten
an Rändern/Grenzern
konzeptionellen Denkens
undװaber begreifenden Verstehens, beziehungsweise Erfahrens
|
[Schlüsselfragen – wenigstens zu, bis von, diesem ר־ו־ח Raum, hinterm Fensterpaar] |
Ist es / diese Blasphemie denn überhaupt zu fassen? Sogar verschriftlichte Sprache, auch ‚griechisch‘-denkend ‚Bibel‘-genannte /to-RAH sche-bik-TAV/ תורה שבכת׳, selbst von G'ttes eigener Hand (gar in Sand, oder ‚wenigstens‘) in Stein(tafeln) eingegrabene /xarut/ חרות Grammatica, ist – äh sei – eben gar kein einheitlicher, eineindeutiger, werdensfrei abgeschlossener, monolithischer Block!/? |
Hier oben herein zu gelangen, gilt als unmöglich, bis im qualifizierten Sinne geheim. –Nebenan ‚Wer-ist-(wie)-Gott?‘-אלוהים in Gelben Zweifessaloon/s steht Sprüche 25,11 an mancher Wand; װ WaW manche erzählen auch von hier drunter, aus, der eben wohlverstandenen G'tteskindschaft, ‚herauf fürchten [ups!]‘ gedurft zu haben, bis höchst טעות\ שגיאה offiziell dawozwischen, äh hier, zu sein.
|
|
Lady Grammatica zu belehren … |
 [Droben, östlich am Michaelsturn-מיכאל, über der ‚alten‘ Kapelle, jedenfalls dieses
Hochschlosses, verborgen, doch gerade von ‚außen‘ durchaus ein wenig sichtbar gewordene / gemachte ‚Geheim/nis‘-Bereiche סוד /sod/-repräsentierend, im Süden des Hochschlosses auf einer oberen Höhe des ungeheuerlichen Anderheitenerkers,
während sich die beiden nördlichen Fensterchen – diesesselben Gemachs (eben gerade gleich neben jenem des/der Zweifel/s)
– bekanntlich
auf einer nur/immerhin mittleren Höhe des Vertrautenerkers befinden]
[Droben, östlich am Michaelsturn-מיכאל, über der ‚alten‘ Kapelle, jedenfalls dieses
Hochschlosses, verborgen, doch gerade von ‚außen‘ durchaus ein wenig sichtbar gewordene / gemachte ‚Geheim/nis‘-Bereiche סוד /sod/-repräsentierend, im Süden des Hochschlosses auf einer oberen Höhe des ungeheuerlichen Anderheitenerkers,
während sich die beiden nördlichen Fensterchen – diesesselben Gemachs (eben gerade gleich neben jenem des/der Zweifel/s)
– bekanntlich
auf einer nur/immerhin mittleren Höhe des Vertrautenerkers befinden] 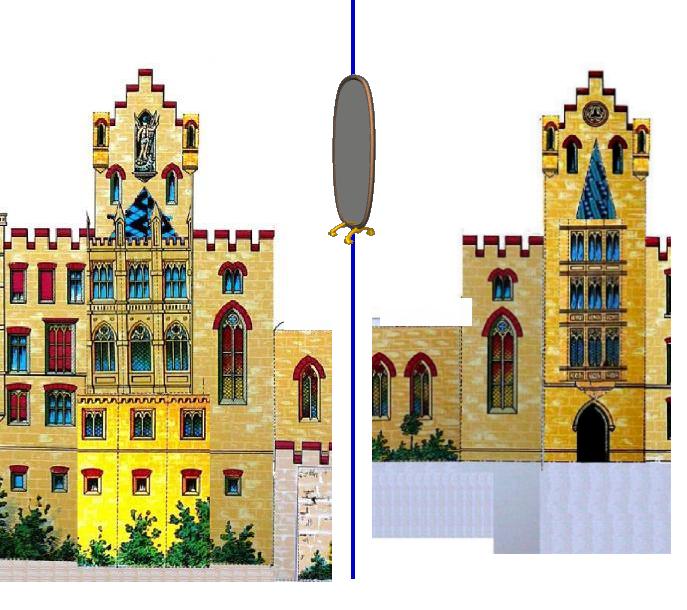
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מִשְׁלֵי שְׁלֹמֹה, Mischle Schelomo
«Auch dies sind Gleichsprüche Schlomos,
welche die Männer Chiskijas Königs von Jehuda
ausgezogen haben.» (Sprüche/mischle 25,1 in der Verdeutschung durch Buber und
Rosenzweig; Hervorhebungen O.G.J.) Also findet
sich gar bei KoHeLeT?
Im / als Vers elf (des 25. Kapitels) dieser Sinnsprüche-Samnmlung, der Ein-, Zu-
und Ausgangssatz 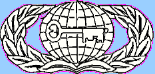 [#Lady Grammar / Grammatikca# kann zwar so einiges (auch) gleichzeitig / ‚multitasking‘
tun und sein bis ausdrücken – doch (gar verbal) nicht einmal in
/ mit(tels) semitischen
Sorachen alles (Relevante im Sinn/en
– ‚kontextübergriffig‘ / ‚satzlos‘
/ ‚voraussetzungsfrei‘) immer nur durch ‚das‘ / ein einziges
Wort ohne lineares –
deutungsanfällig wirkendes, zwischen
Sprachkulturen unterschiedlich bis widersprüchlich übliches (also ‚missverständliches‘) –
hintereinander-Reihen(-müssend) repräsentiert – nicht erst mehrerer, oder so erscheinender, Aspekte oder Gedanken respektive
Handlungen)]
[#Lady Grammar / Grammatikca# kann zwar so einiges (auch) gleichzeitig / ‚multitasking‘
tun und sein bis ausdrücken – doch (gar verbal) nicht einmal in
/ mit(tels) semitischen
Sorachen alles (Relevante im Sinn/en
– ‚kontextübergriffig‘ / ‚satzlos‘
/ ‚voraussetzungsfrei‘) immer nur durch ‚das‘ / ein einziges
Wort ohne lineares –
deutungsanfällig wirkendes, zwischen
Sprachkulturen unterschiedlich bis widersprüchlich übliches (also ‚missverständliches‘) –
hintereinander-Reihen(-müssend) repräsentiert – nicht erst mehrerer, oder so erscheinender, Aspekte oder Gedanken respektive
Handlungen)]
dieses – nur von Menschen, doch teils aus guten, und teils aus schlechten, oder aus wesentlich anderen, Gründen, vor Menschen geheim gehalten-erscheinenden – königlichen, gar kaiserlichen (namentlich: des HaMaSCHiaCH המשיח bzw. ewiger Schwurgott ELoHenu אלוהנו Königs MeLeCH מלך aller Königinnen und Könige MeLaCHiM מלכים), ‚Gemachs‘ (eben in allerlei, bis allen, Wortesinnen):
 [Eher
Abbildungen, immerhin von
doch Artigkeiten Ihrer – gar gespenstischen, äh unendlichen
– Durchlaucht / Vertrautheit der Lady-Siegel- äh Lord-Schlüsselbewahrerin,
[Eher
Abbildungen, immerhin von
doch Artigkeiten Ihrer – gar gespenstischen, äh unendlichen
– Durchlaucht / Vertrautheit der Lady-Siegel- äh Lord-Schlüsselbewahrerin,
gar an der, prompt verbotenen,
zumal dreizehnten, Tür? Für Euch / Sie und/oder
IHN – als / anstatt Innenaufnahmen
dieses, ‚des Allerinnersten‘, Gemachs respektive Gemü(H)ts]
 [‚Devot gedemütigt sein/werden
s/wollendes Sklavenmädchen‘
[‚Devot gedemütigt sein/werden
s/wollendes Sklavenmädchen‘ ![]() bis / gegen / oder
bis / gegen / oder ![]() ‚absolutistisch
willkürliche Herrin der Verfahrensweisen‘ – zählen gar
noch zu den ups harmloser überwindlich benennenden / handhabbaren, hyperrealen Darstellungsvarianten der / an eindrücklich weitreichendsten Verständnisse-Kategorien überhaupt]
Mittels überbietend übertriebener
Überziehung Aufmerksamkeiten / Kräfte / Reflexe ablenkend, bis Wesentlichkeiten
(vor Dritten / einander / sich –
doch wechselseitig ‚gleich‘ respektive symmetrisch-ausgeglichen)
tarnend.
‚absolutistisch
willkürliche Herrin der Verfahrensweisen‘ – zählen gar
noch zu den ups harmloser überwindlich benennenden / handhabbaren, hyperrealen Darstellungsvarianten der / an eindrücklich weitreichendsten Verständnisse-Kategorien überhaupt]
Mittels überbietend übertriebener
Überziehung Aufmerksamkeiten / Kräfte / Reflexe ablenkend, bis Wesentlichkeiten
(vor Dritten / einander / sich –
doch wechselseitig ‚gleich‘ respektive symmetrisch-ausgeglichen)
tarnend.
In der Wand des Gelben Salons der oh Schreck Zweifel (und\aber) der Gewissheiten, im MiCHaEL-Frageturm erscheint manchen manchmal eine verborgene Tür(hüterin, lateinisiert eindeutig namens: Grammatica erscheinend – /dikduk/ דקדוק ‚beinhaltet‘ hingegen beiderlei /darasch/-Auffassungen-דרש von / der ‚Weisung‘, jene deutungsoffenen mit / aus /daled/ דלד und\aber/gegen jene pedantisch-strenge aus / mit \ als תורת-Kellerfaltenrock äh /dalet/ דלת).
 Denn:
Nicht einmal ‚die Pforten der Auslegung‘
sind, oder bleiben, uns (mit und laut
Maimonides balanciert) notwendigerweise
eindeutig verrammelt.
Denn:
Nicht einmal ‚die Pforten der Auslegung‘
sind, oder bleiben, uns (mit und laut
Maimonides balanciert) notwendigerweise
eindeutig verrammelt.
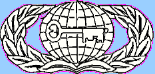 Vollendung/תיקון\Therapeutikum bei Pedanterie/\Grammatik und Perfektionismen / ‚Orthographie‘,
‚‘Transkription‘, ‚Phonetik‘ oder ‚Lesart‘
– Conte Marcellos Venedig-Effekt. #jojo
Vollendung/תיקון\Therapeutikum bei Pedanterie/\Grammatik und Perfektionismen / ‚Orthographie‘,
‚‘Transkription‘, ‚Phonetik‘ oder ‚Lesart‘
– Conte Marcellos Venedig-Effekt. #jojo
 [Von Wehrhaus
und Burghof her gesehen, auf mittlerer nördlicher Erkerhöhe des Michaels- also Absoltutheitsfragenturmes,
liegen hier (‚vom‘, ‚dem‘ bis ‚im inneren Außen‘) sogar vertrauter erscheinende Fenster des gar ‚messianischen Königsgemachs‘
über der immerhin G’tteskindschafts- bis
-furchten-‚Kaüelle‘]
[Von Wehrhaus
und Burghof her gesehen, auf mittlerer nördlicher Erkerhöhe des Michaels- also Absoltutheitsfragenturmes,
liegen hier (‚vom‘, ‚dem‘ bis ‚im inneren Außen‘) sogar vertrauter erscheinende Fenster des gar ‚messianischen Königsgemachs‘
über der immerhin G’tteskindschafts- bis
-furchten-‚Kaüelle‘]  Außen und, statt ‚
Außen und, statt ‚oder‘,
drinnen – mit(beim Norderker.
 Zwar wäre, bis ist, betreffende Worte /bis/ Gesten zu kennen/verwenden schon
einiges ...
Zwar wäre, bis ist, betreffende Worte /bis/ Gesten zu kennen/verwenden schon
einiges ...
‚Neuronal (statt etwa: „neural/intersubjektiv“)
empfunden‘, bis sprachlich/rechnerisch
repräsentiert,
können sehr viele, und vielfältigste  [eher strittig wie
verallgemeinend ‚Alle‘ (including ‘unknown
umknowns‘) reduktionistisch]
[eher strittig wie
verallgemeinend ‚Alle‘ (including ‘unknown
umknowns‘) reduktionistisch]
Dinge/DeWaRiM\ דְּבָרִים in/mit/von ‚Worte/n‘ gefasst, bis (gar Gedanken davon) eingesperrt, erscheinend, kommuniziert (etwa mitgeteilt/verbreitet, verschwiegen, beantwortet/beeinflusst/befragt, bewahrt …) werden.
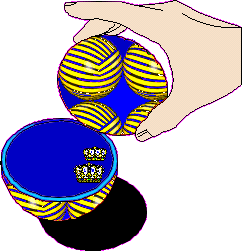
[Verbalsprachen die keine
vereinzelbaren Worte benutzen, verwenden dennoch Sätze-Dosen – nonverbale Aus- und Eindruckungsmöglichkeiten
sind, ups auch innerhalb derselben
Akulturation/Sozialisation nicht etwa (so) eindeutig (wie sie gerne einseitig zumeist – und immerhin
in Verständigungsfällen wechselseitig komplementär/konfrontativ passen)
– aber universell (zu selten
‚unmissverständlich‘) vorkommend] ‚Als‘-strukturell ist/wird
überhaupt
Nichts – nicht einmal kniende Herrscher –
deutungsfrei ‚eindeutig‘! 
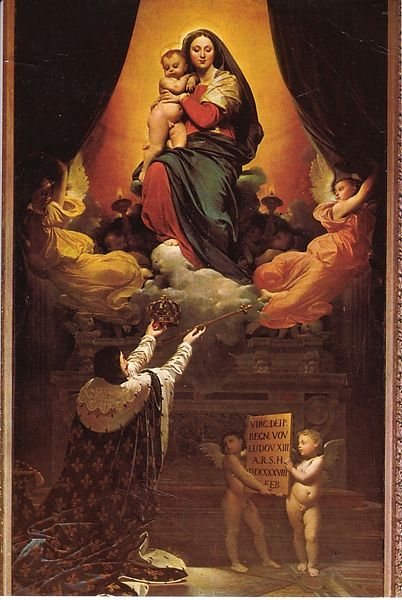
 [Der
Einsatzbedarf ‚anatomischer‘ Knie
–
zumal noch ohne physische Schmerzen
– gehört auch zum Geheimnisverrat:
virtuelles ‚Knicksen‘ nützt, verheimlichtes genügt häufig]
[Der
Einsatzbedarf ‚anatomischer‘ Knie
–
zumal noch ohne physische Schmerzen
– gehört auch zum Geheimnisverrat:
virtuelles ‚Knicksen‘ nützt, verheimlichtes genügt häufig]  Weder stets ‚BDSM,‘ / Dualismus
/ Totalitarismus noch Hyperrealitäten der/oder
Öffentlichkeit, äh Sport / Publikum / Kunst / Bewusstheit / Achtsamkeit ausreichend oder erforderlich!
Weder stets ‚BDSM,‘ / Dualismus
/ Totalitarismus noch Hyperrealitäten der/oder
Öffentlichkeit, äh Sport / Publikum / Kunst / Bewusstheit / Achtsamkeit ausreichend oder erforderlich!

Spätestens ‚Schreiben‘ bewirke, ‚bisher frei herumfliegendes‘ Denken, ‚in Dosen‘ der Sprache/n zu bringen, wo es ‚zwar noch etwas herumsumme‘, doch ‚eigentlich nicht mehr herauskomme‘-!/?/-/. ‚uneigentlich‘ verdichtet/komprimiert/verbreitet/zeitversetzt allerding manchmal schon wirkungsfokuriert.
Gerade sorgfältigstes Übersetzen dolmätscht allemfalls Analoges auch
zwischen#/unter ähnlich vorgehenden Sprachen. Geradezu vielfältig lässt sich
dennoch ‚ein und Dasselbe‘
innerhalb/mit einer Semiotik (spätestens
hinter einender) repräsentieren / wirkungsungleich adressieren – sogar mathematisch/arithmetisch ist dezimal
10 gleich 2 x 5 gleich 4 + 7 - 1 gleich 30 geteilt durch 3 gleich Quadratwurzel
aus 100 und vieles andere mehr – obwohl uns Lehrende ‚zu Ende rechen lassen‘
s/wollen. 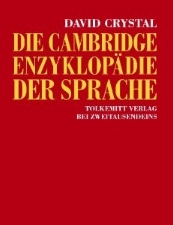
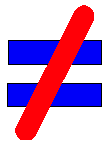

![]() Drei Texte/Gedanken
in quasi ‚talmudischer‘ (Druckfolianten-)Darstellungsform
Drei Texte/Gedanken
in quasi ‚talmudischer‘ (Druckfolianten-)Darstellungsform 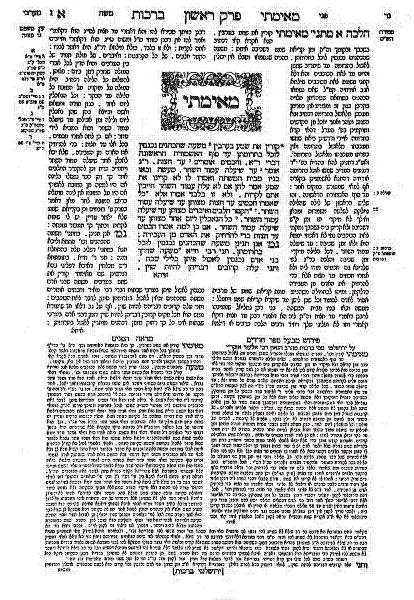 immerhin ‚nebeneinander‘ (geradezu geordnet):
immerhin ‚nebeneinander‘ (geradezu geordnet):

A [Lordsiegelbewahrerin / Grammatik im Raum, gar רוח]

B [Abb. Türe ohne sichtbare Person]

C [Abb. Reverenz-Animation der Ladysiegelbewahrerin]




A) Gar komplexe Einsichtsformen
und Auslegungsweisen, bis Verständnisebenenen, hermeneutischer
Horizonte(hüllen) silbergespinstisch(t)en der
immerhin grammatisch vorfindlichen,
eigentlichen[!] Fülle, 'eigentlich'
– genauer:
in Silber[gestaltungen] übertmittelter/servierter/übertragener/bewahrter – 'goldener'
Früchtepluralität/en, quasi 'in und auf, deren' – zumal oft (indoeuropäisch) vereinzelnd, bis
zusammenfassend, wirkenden – 'Silbergerätenetz/en'. – Na klar,
vergleichweise, also Bitten
um aufmerksame .Vorsicht., simpel
– nicht und anstatt etwa ‚einfach‘ – erscheint, bis © ist, hier,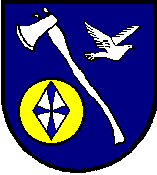 auf/in/an O.G.J.s Homepage, und/aber beriets bisher auf Erden / unter
der Sonne, ausgelegten bis ausgetesteten respektive immerhin verwendeten gegenüber, was Eurer/Ihrer Achtsamkeit/Aufmersamkeit
an sprachlichen bis symbolischen und technologischen Verweisen/Referenzen (mit F-Laut) respektive Hyperlinks zugemutet wird, und, nicht etwa allein – doch schon – an
‚Weiter‘-Denken bis ‚um die Ecke/n‘-Fühlen, abverlangt wäre.
auf/in/an O.G.J.s Homepage, und/aber beriets bisher auf Erden / unter
der Sonne, ausgelegten bis ausgetesteten respektive immerhin verwendeten gegenüber, was Eurer/Ihrer Achtsamkeit/Aufmersamkeit
an sprachlichen bis symbolischen und technologischen Verweisen/Referenzen (mit F-Laut) respektive Hyperlinks zugemutet wird, und, nicht etwa allein – doch schon – an
‚Weiter‘-Denken bis ‚um die Ecke/n‘-Fühlen, abverlangt wäre. ![]() Bereits
die eher exemplarisch gewählten, wenigen,
äh zu vielen, berührten/gemeinten ‚Assoziationen‘ (verbindenden
Zusammenhänge mit, zu und von dem bis den ‚Ganzen‘)
wirken – zumindest stilistisch auf/bei manche/n Menschen –
auch/sogar mittels brave,r
in tabbelarischen Kästchen eingeschlossenen,
Schriftformen-Darstellung – unangenehm verirrendm und befremdlich
unübersichtlich, bis ‚für uneindeutig haltbar‘ (insbesondere wo/da ‚Selbstverständlichkeiten‘/‚Gewohnheiten des Geistes‘ – wenigstens
der Absicht nach – falsifizierend;
vgl.
Bereits
die eher exemplarisch gewählten, wenigen,
äh zu vielen, berührten/gemeinten ‚Assoziationen‘ (verbindenden
Zusammenhänge mit, zu und von dem bis den ‚Ganzen‘)
wirken – zumindest stilistisch auf/bei manche/n Menschen –
auch/sogar mittels brave,r
in tabbelarischen Kästchen eingeschlossenen,
Schriftformen-Darstellung – unangenehm verirrendm und befremdlich
unübersichtlich, bis ‚für uneindeutig haltbar‘ (insbesondere wo/da ‚Selbstverständlichkeiten‘/‚Gewohnheiten des Geistes‘ – wenigstens
der Absicht nach – falsifizierend;
vgl. ![]() Sir Karl Reimund Popper). [Erleuterungsansätze
weniger der A-tens genannten oder angespielten Aspekte fragend]
Sir Karl Reimund Popper). [Erleuterungsansätze
weniger der A-tens genannten oder angespielten Aspekte fragend] [Nächtlich blaues Mondlicht mit Hochschloss
der
alef-he-wet-he
אהבה oder אמן׀ה alef-mem-nun-Überzeugtheitenfestung]
[Nächtlich blaues Mondlicht mit Hochschloss
der
alef-he-wet-he
אהבה oder אמן׀ה alef-mem-nun-Überzeugtheitenfestung] 
B) Nicht viel lesen (eine stellvertretend / variabel für alle Sinneswahrnehmungen drüben
überhaupt gebraucht) ‚mache‘ (ermögliche immerhin – doch drüben und handelnd
von weise zu unterscheiden)
klug (zu werden), sondern
öfters mal Dasselbe (Text-, Theater-, Filn- oder Musikstück, Bild, Ding,
Benehmen, Wort, Gedicht, Gericht, Geschehen pp.) zu betrachten / be- und überdenken helfe dabei. – So, spätestens
namentlich von ![]() Martin
Luther überlieferter, Ansatz (gar bereits) weisen (häufig, etwa als ‚zurück sehen‘
missverstandenen und wehement – namentlich scheinbar als unwirtschaftlich
– bekämmpften) Umgangs damit: Dass des vielen
Medienmachens und Alarmierens kein Ende, sowie
Vieles bis Alles
(unter der Sonne)
bereits, mindestens ‚im Kern‘
Wesentliche, insbesondere ‚mündlicher‘
Martin
Luther überlieferter, Ansatz (gar bereits) weisen (häufig, etwa als ‚zurück sehen‘
missverstandenen und wehement – namentlich scheinbar als unwirtschaftlich
– bekämmpften) Umgangs damit: Dass des vielen
Medienmachens und Alarmierens kein Ende, sowie
Vieles bis Alles
(unter der Sonne)
bereits, mindestens ‚im Kern‘
Wesentliche, insbesondere ‚mündlicher‘
(also: eher ‚dialogisch‘/wechselseitig gelebter, denn formell-festgelegt zitierter, eher verdichtet aufgeführter und z.B. optisch und akustisch dargestellt, ausgedrückter, bis eindrücklich betreffender, denn nicht immer weiter und wieder/neu erwogener/ausgelegter/verstandener - etwa Thora-)
‚Texte‘ im weitesten semiotischen Sinne ‚geschrieben steht‘. – EJZeH OLaM KaTaN ïè÷ íìåò äæéà איזהעולםקטן ‚Was für ’ne kleine Welt(wirklichkeit / Sphäre)‘ wir Menschen doch zumeist (‚mezzokosmisch‘/lokal-gegenwärtig)
erfahren. 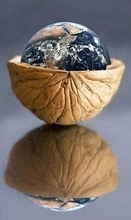 ‚Nussen-Garten‘ [ … ] Kosmos/Universal (griechisch/japhetisch)
versus (hebräisch/semitisch) OLaM/oT עולם׀ות
‚Nussen-Garten‘ [ … ] Kosmos/Universal (griechisch/japhetisch)
versus (hebräisch/semitisch) OLaM/oT עולם׀ות 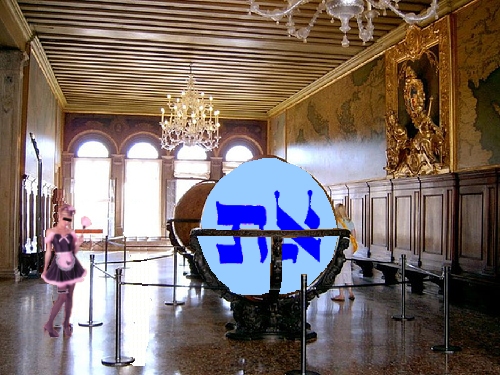


Liste, jüdischerseits insofern/von MoSCHe RaBeNu her ‚mündlich‘ genannter (vielfach schriftlich gestalteter und
beachteter – bis heute, weiter fortgeschriebener), Protokollisierungsmittel (nicht allein) des (menschenheitlich sozio-kulturell erweiterten, bis verallgemeinerten oder stellvertretend,
entpersönlicht)..![]() [Verlinkung runter zur oder Kurz-'Prinzipien'-Aufzählung der Auslegungen
sogar hier? Und Verweise auf Füllengarten PaRDeS]
[Verlinkung runter zur oder Kurz-'Prinzipien'-Aufzählung der Auslegungen
sogar hier? Und Verweise auf Füllengarten PaRDeS]
C) Spätestens KoHeLeT's  abschließende
Warnungen: 'Dass des vielen Medienformens (und Warnrufens äh Brüllens)
kein Ende sei, und zudem viel Studieren (bekanntlich ein vom lateinischen Sprachhorizont her für
'sich bemühen' verwendbarer Begriff)
zur Ermüdung des ganzen Leibes (also längst nicht allein, doch
immerhin physiologischer Körper – also etwa auch der
Aufmerksamkeiten und insbesondere Sensibilitäten, bis etwa Wertschätzung)
beiträgt'.
abschließende
Warnungen: 'Dass des vielen Medienformens (und Warnrufens äh Brüllens)
kein Ende sei, und zudem viel Studieren (bekanntlich ein vom lateinischen Sprachhorizont her für
'sich bemühen' verwendbarer Begriff)
zur Ermüdung des ganzen Leibes (also längst nicht allein, doch
immerhin physiologischer Körper – also etwa auch der
Aufmerksamkeiten und insbesondere Sensibilitäten, bis etwa Wertschätzung)
beiträgt'.
Dürfen Wahrnehmungen (mindestens
beiderlei basaler – der denkerischen
und der handelnden – Arten und
Horizontsphären) weiterer/erweiterter Goldfrüchte in/aus Silberverpackungen
erleichtern. ![]() E.B.
Über das lebendige Interpretament des Messias persönlich/selbst, dass sich die Torah / Er/Sie
sich einem erschließt:
E.B.
Über das lebendige Interpretament des Messias persönlich/selbst, dass sich die Torah / Er/Sie
sich einem erschließt:
Stellen der Schrift(en) und ihrer Auslegung(en / Verstehenstraditionen) die einen ängstigten «verblassen» und andere, die jemand bisher eher überlesen hat, beginn einem (namentlich im endlosen Lichtglanz von Norden her) zu leuchten.
[E.B. Zitat JeSCH[uA]/JaH als lebendiges Interpretament] ![]()
[??Abbs. Womöglich beharren manche lieber brav auf dem - je vorher aktuell - Vorfindlichen: Immerhin irgendeine avartarische Dienerin, gar endlich (auch) Virtualita (synchron in willfährigster Uniform der Schuld/Scham Präsentation gebeugter Knie), knickst ja vielleicht bestimmt bereits irgendwo sonst anziehend Goldfrüchte in bis aus Silbergeräten??]


file:///C:/www.jahreiss-og.de/pic-c/dma-c-silberapfelblase.jpg
file:///C:/www.jahreiss-og.de/pic-c/dma-c-7goldaepfel.jpg


file:///C:/www.jahreiss-og.de/school/blau-netzcc3.jpg (leere türe)
file:///C:/www.jahreiss-og.de/school/blau-netzcc4.jpg (stehende Kniebild)
file:///C:/www.jahreiss-og.de/pic-c/dma-c-silberapfelblase.jpg (Avatarin dm Silberapfel)
file:///C:/www.jahreiss-og.de/pic-c/dma-c-7goldaepfel.jpg
file:///C:/www.jahreiss-og.de/pic-c/dma-c-7granat.jpg
bild
 Bereits das – wohl zumindest auch anders, etwa im Sinne von ‚wider die Ströme der Worte‘,
gemeinte bzw., gegen den Redefluss,
gerichtete – Sprichwort ‚Reden sei – ja immerhin werthaltiges
– Silber und – jedenfalls achtsames,
oder immerhin kontemplatives – Schweigen – gar dagegen
kontrastierend – Gold‘, kann als
Hinweis auf die, oder ‚Abstrich von‘ der, hier (re)präsentierten ‚Bibelzitatstelle‘, äh den Beziehungsrelationen von
Denkformen(auswahlentscheidungen aus mindestens Virtualita's,
wo nicht auch Ihrer Fülle)
und empirischen Gegebenheiten/Ereignissen verstanden,
bis verwendet, sein/werden.
Bereits das – wohl zumindest auch anders, etwa im Sinne von ‚wider die Ströme der Worte‘,
gemeinte bzw., gegen den Redefluss,
gerichtete – Sprichwort ‚Reden sei – ja immerhin werthaltiges
– Silber und – jedenfalls achtsames,
oder immerhin kontemplatives – Schweigen – gar dagegen
kontrastierend – Gold‘, kann als
Hinweis auf die, oder ‚Abstrich von‘ der, hier (re)präsentierten ‚Bibelzitatstelle‘, äh den Beziehungsrelationen von
Denkformen(auswahlentscheidungen aus mindestens Virtualita's,
wo nicht auch Ihrer Fülle)
und empirischen Gegebenheiten/Ereignissen verstanden,
bis verwendet, sein/werden.
UndװAber
etwa ![]() Sir
William hat bekanntlich, besonders in
Sir
William hat bekanntlich, besonders in  ‚Kaufman von Venedig‘ das – antik zwar immerhin zur ‚metallurgischen‘
Trias erweiterte – Motiv-Angebot,
noch/doch etwas anders, bis reduktionistisch, zum Charakter-Deutungsrätsel
ausgelegt, äh virtualita genutzt. [Abbs. Kästchenszene
TMoV]
‚Kaufman von Venedig‘ das – antik zwar immerhin zur ‚metallurgischen‘
Trias erweiterte – Motiv-Angebot,
noch/doch etwas anders, bis reduktionistisch, zum Charakter-Deutungsrätsel
ausgelegt, äh virtualita genutzt. [Abbs. Kästchenszene
TMoV]![]()
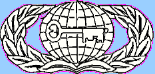 Schlüssel-Textstelle /
Toravers einer – teils verborgenen, bis vergessenen – Zwischenwandvertäfelungstür:
Schlüssel-Textstelle /
Toravers einer – teils verborgenen, bis vergessenen – Zwischenwandvertäfelungstür:
«Ein Wort, geredet
zur rechten Zeit [sic!» so hauptsächlich
Martin Luthers Übersetzungsgedanke des Schlüsselversanfangs], «ist wie goldene Äpfel [sic! eine, immerhin bis in Wörterbücher
eingedrungene, kulturalistische 'Rück'-Übertragung in eine
/ die abendländisch ‚bekannte‘ Frucht / Obstsorte] in
silbernen Prunkgeräten.» (Sprüche 25,11) Wandbildaufschrift
der heimlichen, bis unheimlichen, Tapetentür (דלד׀דלת aus / mit
/ von / zu diesem ‚Kabinett‘ [neben bis oben in /kenedo\
über, ups] G‘ttesfurchtenkapelle
– ‚wohin‘ entschieden Euer Gnaden).
 Fensterchenpaar
unterm Dach des erneuerten, unvollständigen Klemmsteinenachbaus seines
Michaelsflügels, doch gerade hier im Hochschloss,
zu findende Räumchen (H29c – auch der ( für Grammatik).
Fensterchenpaar
unterm Dach des erneuerten, unvollständigen Klemmsteinenachbaus seines
Michaelsflügels, doch gerade hier im Hochschloss,
zu findende Räumchen (H29c – auch der ( für Grammatik). 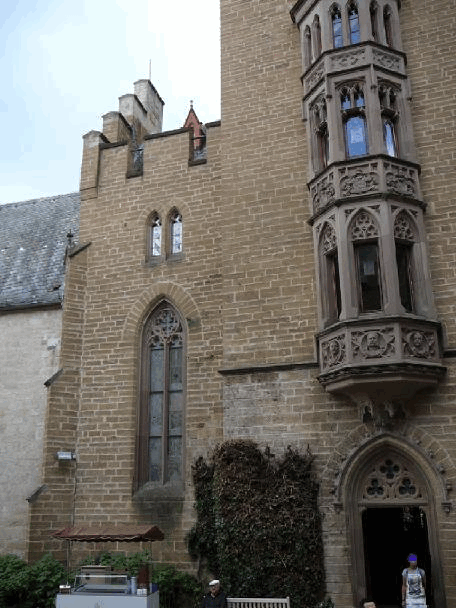 [Einer der immer aktivierbaren, oft gut verborgenen, Empörungsmöglichkeiten-Höhepunkte hängt mit /dewarim/ Trenn- und Verbindbarkeiten von Repräsentioertem und
Repräsentationen zusammen]
[Einer der immer aktivierbaren, oft gut verborgenen, Empörungsmöglichkeiten-Höhepunkte hängt mit /dewarim/ Trenn- und Verbindbarkeiten von Repräsentioertem und
Repräsentationen zusammen]
 Interessant beeinflussen(d) / befassend / bemerkend
/ betreffen könnenD, dass/falls Modelle nicht weniger echt wirksam (als
was / wer sonst noch)?
Interessant beeinflussen(d) / befassend / bemerkend
/ betreffen könnenD, dass/falls Modelle nicht weniger echt wirksam (als
was / wer sonst noch)?

תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבור על־אפניו
TaPuXe ZaHaW
BeMaSKjoT KaSeF DaWaR DaWuR AL-AFNaJW
תַּפּוּחֵי זׇהׇב בְּמַשְׂכּׅיּוֹת כׇּסֶף דׇּבׇר דׇּבֻר עַל־אׇפְנׇיו
A word fitly spoken is like apples [sic!] of gold in a
setting of silver.
Goldäpfel [sic!] in silbernen
Schaugeräten, eine Rede, geredet gemäß ihren Bedingnissen. (Buber-Rosenzweig
Verdeutschung)
TaPuXe תפוחי my
apple
ZaHaW זהב gold
TaPuXe
ZaHaW תפוחי זהב
BeMaSKJoT במשכיות in the lockets (Medalkions)
KaSeF כסף money/silver coin
BeMaSKJoT
KaSeF במשכיות כסף
DaWaR דבר Sache, Angelegenheit, Wort; Kal 'sprechen' (nur Partizip Präsens)
thing
DaWuR דבור gesprochen
(Adjektiv)
Al-AFNaJW על־אפניו on-...
 Eines der angeblichen, bzw. besonders interessengeleiteten,
‚Geheimnisse‘ besteht übrigens
darin, dass es nie nur eine einzige goldene Frucht ist, die
da in ‚der Tiefe‘ bzw. ‚hinter‘, ‚zwischen‘ oder ‚über
dem‘, so gerne ‚wörtlich‘ genannten, Sinn,
etwa einer Textpassage, Partitur oder Drehbuchstelle respektive gerade ‚deren‘
inhaltlicher Bedeutung ‚steckt‘ / ‚liegt‘ – obwohl und weil Menschen zeitgleich und am selben
Ort, (insofern:
‚hintereinander‘) allzumeist nur von/an einer zu ‚essen‘ vermögen, die
einem aber höchstens so singulär passend etc. vorkommt, bis qualial oder kollektiv ist, ohne
deswegen die einzige, oder die gemeinsame / synchronisierte aller zu sein, oder
werden, zu müssen.
Eines der angeblichen, bzw. besonders interessengeleiteten,
‚Geheimnisse‘ besteht übrigens
darin, dass es nie nur eine einzige goldene Frucht ist, die
da in ‚der Tiefe‘ bzw. ‚hinter‘, ‚zwischen‘ oder ‚über
dem‘, so gerne ‚wörtlich‘ genannten, Sinn,
etwa einer Textpassage, Partitur oder Drehbuchstelle respektive gerade ‚deren‘
inhaltlicher Bedeutung ‚steckt‘ / ‚liegt‘ – obwohl und weil Menschen zeitgleich und am selben
Ort, (insofern:
‚hintereinander‘) allzumeist nur von/an einer zu ‚essen‘ vermögen, die
einem aber höchstens so singulär passend etc. vorkommt, bis qualial oder kollektiv ist, ohne
deswegen die einzige, oder die gemeinsame / synchronisierte aller zu sein, oder
werden, zu müssen.
![]()
/www.jahreiss-og.de/school/goldfrucht-stock-photo-pretty-teenager-21067837.jpg
(Goldkugel in Schülerinhand)
file:///C:/www.jahreiss-og.de/school/goldfrucht-stock-photo-pretty-teenager-21067837.jpg

![]() dem Anschein (und nicht allein dem Schein) nach quasi zugleich
außen ‚von Silber‘ und drinnen ‚von Gold‘
dem Anschein (und nicht allein dem Schein) nach quasi zugleich
außen ‚von Silber‘ und drinnen ‚von Gold‘
![]() zutreffend mit ‚Äpfel‘ übersetzbar, und doch
mehr eine Art von orangenähmlichen Zitrusfrüchten bezeichnend/meinend
zutreffend mit ‚Äpfel‘ übersetzbar, und doch
mehr eine Art von orangenähmlichen Zitrusfrüchten bezeichnend/meinend
![]() die – gar in einem eigentümlichen, wörtlichen
Fehlen von ‚Zeit‘ immerhin implizit zu deren ‚passenden‘,
die – gar in einem eigentümlichen, wörtlichen
Fehlen von ‚Zeit‘ immerhin implizit zu deren ‚passenden‘,
![]() aus einer geradezu ‚grundlegend‘ modifizierten
Variantenpalette ‚abgetönt – geredet (‚mündliche Tora‘ /to-RAH she-be'AL pe/) תורה שבעל פה
aus einer geradezu ‚grundlegend‘ modifizierten
Variantenpalette ‚abgetönt – geredet (‚mündliche Tora‘ /to-RAH she-be'AL pe/) תורה שבעל פה
![]() aus eher netzartigen, dichten Silbergeweben
der grammatischen Sprache/n heraus gewickelt, und auf diesen durchaus
‚geldwerten‘ Prunkgeräten angeboten, bis überreicht
aus eher netzartigen, dichten Silbergeweben
der grammatischen Sprache/n heraus gewickelt, und auf diesen durchaus
‚geldwerten‘ Prunkgeräten angeboten, bis überreicht
Einleitender Anredeteil wichtiger und häufiger Segensformel:
BaRruCh aTa/, eLoHeNu MeLeCh Ha-oLaM. ברוך אתה אלוהים מלך העולם Gesegnet seist ‚Du‘, Adonai unser ewiger, Schwur-König des
Alles ....
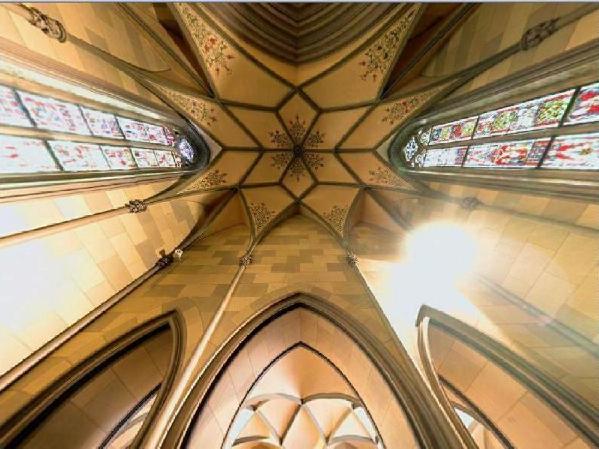
#hierfotos



#######
file:///C:/www.jahreiss-og.de/pic-c/dm04-si-gild-silber.jpg
file:///C:/www.jahreiss-og.de/pic-c/dm04-si-gikdaofel.jpg
file:///C:/www.jahreiss-og.de/pic-c/dm04-si-2granat-gold.jpg
j.j.p.-Buch
 Immerhin hier qualifiziertes Personal serviert
bereits im/zum/vom Anfang /bereschit/
Immerhin hier qualifiziertes Personal serviert
bereits im/zum/vom Anfang /bereschit/ ![]()
 BeReSCHiT בראשית als wohl
prominentes Beispiel (hebräischer Goldkernnuggets im/auf Silber der Sprache)? Immerhin einziges
tanachisches Wort das, eben und nur ganz am freien
Anfang überHaupt
(auch des Textes) mit
einem etwas größer geschriebenen OT, den
immerhin inzwischen zweiten des Alefbet,
beginnt.
BeReSCHiT בראשית als wohl
prominentes Beispiel (hebräischer Goldkernnuggets im/auf Silber der Sprache)? Immerhin einziges
tanachisches Wort das, eben und nur ganz am freien
Anfang überHaupt
(auch des Textes) mit
einem etwas größer geschriebenen OT, den
immerhin inzwischen zweiten des Alefbet,
beginnt. ![]()
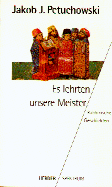 Jakob J. Petuchowski Es lehrten unsere Meister
Jakob J. Petuchowski Es lehrten unsere Meister
Bekanntlich geht der erste Vers dieses auch als ‚Urtext‘
bezeichneten/verstandenen, kanonisierten Korpusteils der Thora (im engsten Sinne) mit BaRA ברא also aus nochmal den
ersten drei Schriftzeichen/Ziffern des ersten Wortes, ‚parallel‘ in
derselben Reihenfolge – die
sich mit ‚schuf‘, bis ‚stellte wi[e]der her‘, und zwar wohl im (auch)
indoeuropäisch (zutreffend) verstehbaren Singular stehend, übersetzen lassen/läßt – und ELoHiM אלוהים,
einer der eben ausdrücklichen, etwa in asiatischen Denken alternativlos,
so vertrauten Pluralformen, eines Namens, der geläufig mit/zu ‚Gott‘ übertragen – und gar (ebenfalls) zutreffend (verstanden) als gesamte
Einheit in, bis der, Vielheit(en) erschrocken verdrängt – wird. – Eine immerhin Darstellungsweise mittels
Singularverb und Pluralnomen, die in etwas anderer Silber- äh Sprachform, auch in spezifischen – nicht unbedingt universalistischen
– Tora-Passagen-Verabsolutierungen,
geradezu irritieren könnende, Verwendung findet (vgl. etwa Michael
Brumlik zur Liturgie am, so wichtigen, Jom Kipur Feiertag, gar der ‚Sünder-Versöhnung‘).
![]() Hirsch, genauer /ZWI/ צבי (althebräisch/wissenschaftlich zwar
auch ‚Gazelle‘ bezeichnend, wie in manchen Übersetzungsvarianten des Liedes der
Lieder gar Schelomos. für die im heutigen Iwrit ein eigenes, anderes Wort
gebraucht wird), der zugleich verborgen und sichtbar wie durchs
Unterholz streift/streicht. Gar mein Geliebter
/dodi/ höchst selbst – Messias. Stimme meines Geliebten – kol dodi – Der
Heilige Israels – Kadosch Jisrael – Einzigartiger König me-lamed-mem-jud-chaf.
Hirsch, genauer /ZWI/ צבי (althebräisch/wissenschaftlich zwar
auch ‚Gazelle‘ bezeichnend, wie in manchen Übersetzungsvarianten des Liedes der
Lieder gar Schelomos. für die im heutigen Iwrit ein eigenes, anderes Wort
gebraucht wird), der zugleich verborgen und sichtbar wie durchs
Unterholz streift/streicht. Gar mein Geliebter
/dodi/ höchst selbst – Messias. Stimme meines Geliebten – kol dodi – Der
Heilige Israels – Kadosch Jisrael – Einzigartiger König me-lamed-mem-jud-chaf.
![]() ‘Die Tore der Auslegung
sind uns nicht verrammelt‘ bemerkte Maimoniedes/Rambam auch/bereits an anderer
Stelle.
‘Die Tore der Auslegung
sind uns nicht verrammelt‘ bemerkte Maimoniedes/Rambam auch/bereits an anderer
Stelle.
![]() [Abbs. Literatur
Schalom und molonlitischer Block. Goldäpfel in Silbernen Prachtgeräten]
[Abbs. Literatur
Schalom und molonlitischer Block. Goldäpfel in Silbernen Prachtgeräten] ![]()
#hierfotos

file:///D:\sphaeren-ghz\hz-pano-hof112.jpg
(oder mit Michaeltutm hz-pano-hof110.jpg)
Und eine äußere Außenseite der goldenen Früchte der gar geschriebenen
Torah ist gezeichnet??

file:///C:/www.jahreiss-og.de/pic-hz/michaAUSHZO-BA4.jpg
Ob und wann welche Verbindungen hinüber, namentlich mit dem/des Zweifelssaloon im G'ttesfrageturm, und hinunter zur, äh herauf aus der, qualifizierten G'tteskindschaft bestehen, und insbesondere verwendet, bis wie betreten, werden,

file:///D:\sphaeren-ghz\hz-panora-stmich0061.jpg
אגורה – 'piece of silver' übersetzt ein
automatischer Translater und /agorah/ –
spräche ein kundiger Mensch, vom Griechischen
her bekanntlich wie, bis als, der meist doch
erhabene Versammlungsplatz (für Märkte und Politik) erklingend. –


gehört zu den entscheidenden Lebensfragen.
file:///C:/www.jahreiss-og.de/school/sch-girl55engel269.jpg
file:///C:/www.jahreiss-og.de/school/sch-girl55engel272.jpg
Sprache-abbs
####llllll#
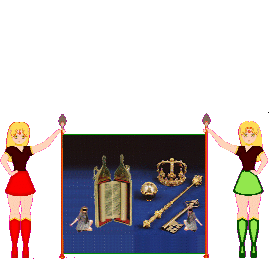
[Gar nicht so wenige Leute
halten ‚Belegstellenkenntnis‘ für Textbeherrschung, bis Verfügungsgewalt über ‚Inhalte‘
/ Gemeintes / Unwissende] Es soll sogar Lehrende gegeben haben, die ihr Schulbuch /
Medienspektrum ganz genau, anstatt ‚ihr‘ Fach bis
Publikum, kannten.
 ‚Barnaby‘ Zitat:
‚Barnaby‘ Zitat:
Banker Perkins: „Ich bedaure Detective, aber mir sind die
Hände gebunden. So ist es nun einmal prinzipiell im Gesetz von 1998 verankert.
‚Daten dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden, sofern der Betreffende
nicht in die Wiedergabe einwilligt‘. Und weder Mr. Higgs noch Mr. Delglish
haben mir hierfür ihr Einverständnis gegeben.
Ah, nicht, dass Mr. Delglish unter diesen Umständen [er wurde inzwischen
ermordet] seine Einwilligung doch noch geben
würde.“
Detective Sergeant Jons[, der von seinem Chef DCI Barnanby die Weisung
hat ‚sich nichts gefallen zu lassen‘]: „Was
soll der Aufstand, Mr. Perkins?“
Baker: „Ah, wie meinen Sie?“ DS Johns: „Dieser lächerliche
Affentanz, den Sie jedes Mal aufführen, wenn wir Informationen von Ihnen b brauchen.“ Bakier:
„Wie ich gerade ausführte. Das
Gesetz sagt eindeutig …“ ![]() DS Johns unterbricht: „Das Gesetz sagt eindeutig, und
zwar in Fettdruck unter ‚Ausnahmen‘, Paragraph 29: ‚Datenweitergabe zum
Zweck der Verhinderung oder Aufdeckung von Straftaten, der strafrechtlichen
Verfolgung, oder Festnahme von Straftätern, oder der Festsetzung und
Eintreibung von Steuern, ist ausgenommen, vom oben ausgeführten
Datenschutzprinzip.‘“
DS Johns unterbricht: „Das Gesetz sagt eindeutig, und
zwar in Fettdruck unter ‚Ausnahmen‘, Paragraph 29: ‚Datenweitergabe zum
Zweck der Verhinderung oder Aufdeckung von Straftaten, der strafrechtlichen
Verfolgung, oder Festnahme von Straftätern, oder der Festsetzung und
Eintreibung von Steuern, ist ausgenommen, vom oben ausgeführten
Datenschutzprinzip.‘“
Bankier entsetzt: „Sie kenn es offenbar auswendig.“ DS
Johns: „Ja! – Genauso wie eine Reihe von anderen Paragraphen. Es spart Zeit im
Umgang mit widerborstigen oder kontraproduktiven Bankiers, Anwälten,
Steuerprüfern. – ![]() Das
Gesetz, Mr. Perkins, ist wie
Das
Gesetz, Mr. Perkins, ist wie ![]() die Bibel: Sie
finden immer Zitate, die im Widerspruch zu anderen Zitaten stehen.“
die Bibel: Sie
finden immer Zitate, die im Widerspruch zu anderen Zitaten stehen.“
Bankier: „Trotzdem sollten Sie nicht so mit mir reden.“ –
DS Johns: „Ich hab noch nicht gegessen.“ [Der von seinem DCI in der Mittagspause losgeschickt worden war.] (Britische TV-Serie: ‚Inspektor Barnaby‘; Hervorhebungen,
Verlinkungen und Illustrationen dieses Exzerpts O.G.J.)

 ‚Vom Fels zum Meer.‘ [Falls/Wo doch mehr/Meer als zwei(erlei ‚falsches‘ und ‚weniger schlechtes‘ Verhalten) existiert] Abbs.
Wege-des-widerspruchs.
‚Vom Fels zum Meer.‘ [Falls/Wo doch mehr/Meer als zwei(erlei ‚falsches‘ und ‚weniger schlechtes‘ Verhalten) existiert] Abbs.
Wege-des-widerspruchs.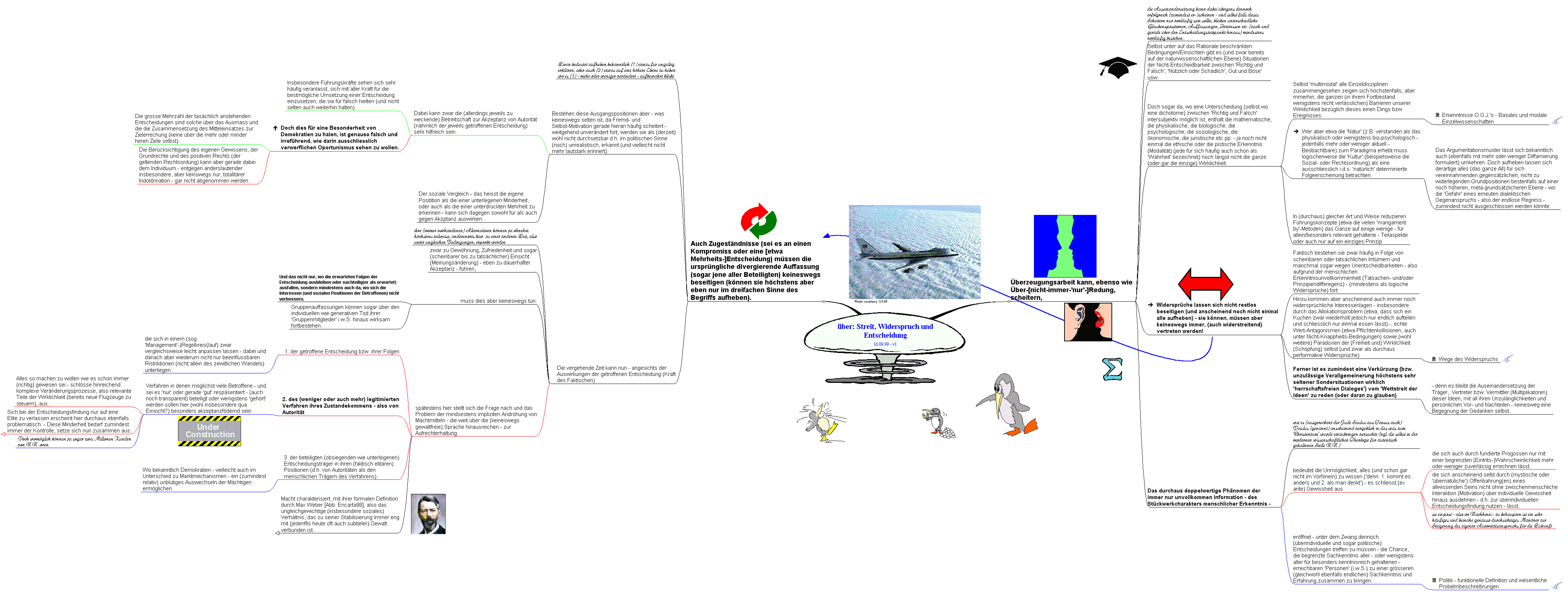
[Der (an Goldfrüchte/n) Vielfalten Vielzahlen schrecken,
etwa fernöstliche, zumal südasiatische
Denkweisen / sino-tibetische Sprachen, die (zwar) weder indoeuropäischen Singular (im vereinzigend emgsten
Sinne) ausdrücken/verstehen, noch
grammatikalische ‚Artikel‘ benötigen (doch – lexikalisch gelistet, äh gestützt – so übersetzt / damit und dahin deutbar),
weitaus weniger, als griechisches
/ monokausalistisches Vergptten]
‚Das ist Alles פ-PE/FE-ף viel komplizierter
als gedacjt werde; – aber/denn in Tat und Wahrheit liege es an dem was, unseres/meines
Erachtens, ursächlich‘-geht weiter nur argumentativ/rechthaberisch
im selben Interaktionskreis – vereinfacht-gedrillter statt weiser/intelligenter
Komplexitätsreduktion/Handlungsentscheidung (#tun# oder #lassen#) – herum. 
Es kommt
eben darauf an, wie mit Varianten, und gleich gar
Widersprüchen, im selben Textkorpus, bis zwischen Aussagen
/ Behauptungen / Darstellungen (zumal zur/in derselben, oder wenigstens
für hinreichend ähnlich / dafür gehaltenen,
‚Sache‘) umgegangen wird:
Etwa indem sie, wie insbesondere christlicherseits, der ‚höheren Bibelkritik‘
als Anlass/Anhalt dienen: Den Text in
verschiedene Quellen/Schichten zu scheiden; mit deren Authentizität, bis Ursprünglichkeit, sich
zu quäken hat, wer sich für eine, äh die, ‚reine/wahre‘ da für
widerspruchsfrei gehaltene/erklärte. Lehre zu
entscheiden habe.
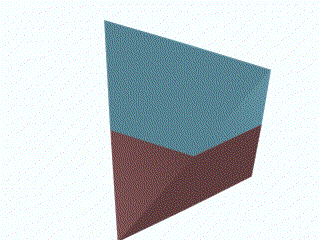
Oder etwa indem, wie insbesondere jüdischerseits
vorgegangen wird, uns/Menschen unterschiedlich/wiederholt, bis widersprüchlich,
erscheinende Textpassagen zu Anlässen werden: Erneut/Anders und tiefer,
respektive umfassender/vollständiger lesend, über deren mögliche Zusammenhänge
/ aktuell noch unbekannte Seiten, bis insbesondere über
situative/perspektivische Unterschiede, nachzudenken / zu forschen – ohne
deswegen/dazu den Text, seine Einheit (in Vielheiten/Plural - gar) des /echad/ אחד, dessen Herkunft
in, einander gar wechselseitig untreu auszuschließen habende, Täuschungen, äh
Teile zerlegen zu müssen.
[/taxat
haschemesch/ ‚unter der Sonne‘ … erkannte spätestens ![]() ]
]
Ein, bis der, Ansehens- und Machttmissbrauch
besteht allerdubgs darin, Heilige Texte
(doch es eignen sich auch und
bereits noch so profane Gesetze, besonders Verfassungen
und sonstige Satzungen bzw. Zitatsammlungen, sowie Gesamtwerke, dazu)
wie/als einen
Steinbruch /chet-resch-taw/
חרת zu (Heiliges-)Absonderungsversuchen
/ der Rechtfertigung des eigenen Handelns /
Forderns zu verbrauchen – indem (kanonisch, zumal ‚biblisch/akademisch‘, überlieferte Beleg-)Stücke /
‚Steine‘ daraus, als scheinbar gewaltfreie
Überzeugungswaffen – im Namen des Rechts, des ‚Volkes‘, der ‚Majestät‘, der
Kultur, der Natur, der Gesundheit, der Tradition, der wahren
Vernunft, der Ordnung
/ des Prinzips, Gottes – eingesetzt
werden. 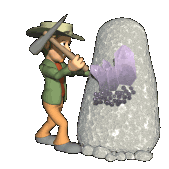 [] In/Aus den (gar sämtlichen) Überlieferungen lässt sich nämlich, so gut wie, Alles, undװaber
zumindest auch das jeweilige Gegenteil von all dem,
herausnehmend finden/zitieren – jedenfalls
insofern bis zusammenhanglos ‚nichts Neues unter der Sonne‘. Obwohl,
bis weil, sich gerade hinsichtlich der Ausbuchstabierung/Formulierung
grundlegenden Rechts qualitative
Veränderungen, gar zivilisatorische
Fortschritte, ergaben, bis weitere ergeben,
eignet sich Recht(setzung bzw. Rechtsverständnis) ganz besonders
für die Behauptung etwas – namentlich ‚das was einem, oder anderen, angetan worden‘ – sei Unrecht, also
gottlos bis Menschenrechtsverletzend – da das so, und sogar in Stein,
beurkundet geschrienen stehe(n würde, bis zumindest so zitiert/verstanden werden müsse). Nicht selten trägt
die Überzeugung/Vorstellung
davon weiter (bzw. ganz wo anders hin) als ‚der Text‘, sein Wortlaut, und vor allem als der zuständige Richter/Gerichtshof es täten, bis tun.
[] In/Aus den (gar sämtlichen) Überlieferungen lässt sich nämlich, so gut wie, Alles, undװaber
zumindest auch das jeweilige Gegenteil von all dem,
herausnehmend finden/zitieren – jedenfalls
insofern bis zusammenhanglos ‚nichts Neues unter der Sonne‘. Obwohl,
bis weil, sich gerade hinsichtlich der Ausbuchstabierung/Formulierung
grundlegenden Rechts qualitative
Veränderungen, gar zivilisatorische
Fortschritte, ergaben, bis weitere ergeben,
eignet sich Recht(setzung bzw. Rechtsverständnis) ganz besonders
für die Behauptung etwas – namentlich ‚das was einem, oder anderen, angetan worden‘ – sei Unrecht, also
gottlos bis Menschenrechtsverletzend – da das so, und sogar in Stein,
beurkundet geschrienen stehe(n würde, bis zumindest so zitiert/verstanden werden müsse). Nicht selten trägt
die Überzeugung/Vorstellung
davon weiter (bzw. ganz wo anders hin) als ‚der Text‘, sein Wortlaut, und vor allem als der zuständige Richter/Gerichtshof es täten, bis tun.  []
[]
Die ganzen (ob etwa ausgesprochenen, impliziten oder gar irrigen)
Hausnummern- bzw. Paragrafen- und Belegstellenangaben des Zitierens / Autorisierens haben eben stets
die Eigenschaft, als ein – gar aus dem, respektive einem, ganz
anderen / größeren Zusammenhang gerissenes –
Teilstück behauptet, bis entlarft werden, zu können, das (so, nun und hier) bis sogar in ‚sein‘ Gegenteil, oder was aich
immer sonst, verkehrt sei/werde. 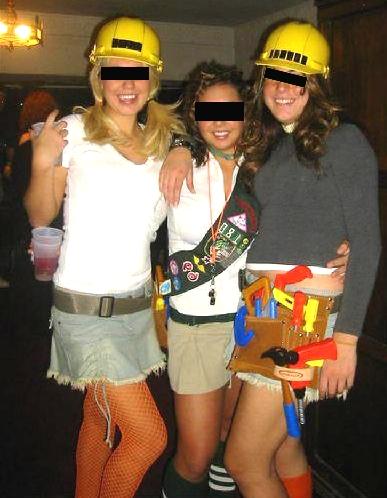
Nicht einer der, auf diesen Seiten zu repräsentieren (bis zu verstehen)
versuchten Gedanken, und auch keine der gemeinten Gegebenheiten, ist eine Erfindung, oder wäre
erstmalig alleinige Entdeckung, ![]() O.G.J.‘s – alles
durchaus schon / anderen bekannt, bis sonst wo geschrieben stehend.
O.G.J.‘s – alles
durchaus schon / anderen bekannt, bis sonst wo geschrieben stehend.  – Und\Aber von
der תורה sagen uns die weisen
Gelehrten bekanntlich ohnehin, dass
darin längst alles … Sie wissen
schon.
– Und\Aber von
der תורה sagen uns die weisen
Gelehrten bekanntlich ohnehin, dass
darin längst alles … Sie wissen
schon.
 Zu den veritablen Missverständnissen würde
gehören, aus der – zumal distanziert kritischen,
bis verbessern s/wollenden –
Zu den veritablen Missverständnissen würde
gehören, aus der – zumal distanziert kritischen,
bis verbessern s/wollenden –  Verwendung der/von Zitate/n bis Exzerpten (hier) zu schließen, dass
ich/wir die herangezogenen Texte (respektive sogar ihre Herkunft, bis Urheberschaft) für misslungen
oder schlecht halte/n.
Verwendung der/von Zitate/n bis Exzerpten (hier) zu schließen, dass
ich/wir die herangezogenen Texte (respektive sogar ihre Herkunft, bis Urheberschaft) für misslungen
oder schlecht halte/n.
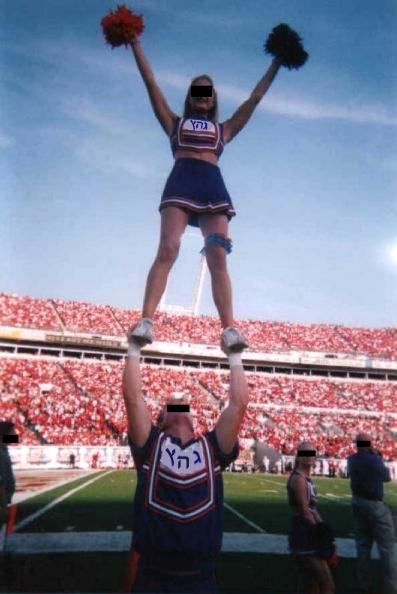 [Weder muss einen erstaunen, noch ‚sich
erhaben vorkommen lassen‘, auf den Schultern
von Riesen stehend, noch (etwas)
weiter oder anderes
(als bereits diese)
sehen zu können]
[Weder muss einen erstaunen, noch ‚sich
erhaben vorkommen lassen‘, auf den Schultern
von Riesen stehend, noch (etwas)
weiter oder anderes
(als bereits diese)
sehen zu können]
Schon eher werden (hier) gewählte Zitate/Werke als ‚so gelungen‘ oder aber ‚folgenschwer‘ betrachtet, dass sie die Mühen darum, bis Auseinandersetzung damit, lohnen mögen. Viel Komprimierungs-, Übertragungs- und\aber Präzisierungsarbeiten wurden zudem bereits geleistet, bis wirkmächtig vorgelegt, oder tradiert (respektive inzwischen wieder, und so mache dagegen – ohne für diese Enttäuschung eines vollständigen Überblicks zu bedürfen – bedauerlicherweise, verkannt / vergessen).
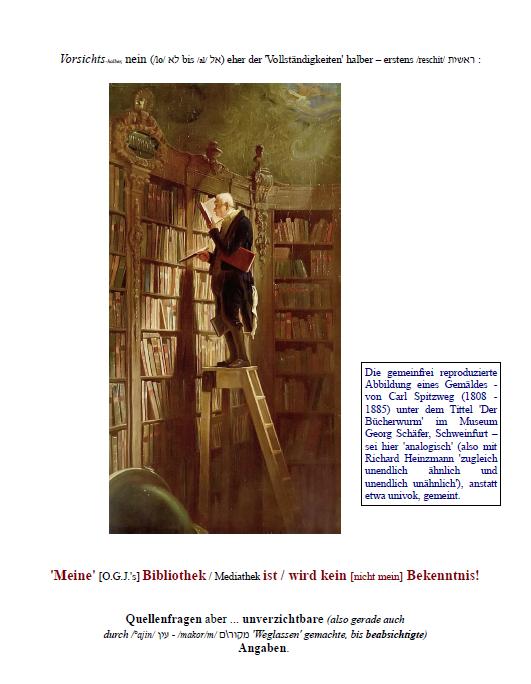 [Sogar/Gerade eine ‚professorale, bis
professionelle‘ Bibliothek ist nämlich kein Bekenntnis –
und schon gar unsere/meine Mediathek nicht.]
[Sogar/Gerade eine ‚professorale, bis
professionelle‘ Bibliothek ist nämlich kein Bekenntnis –
und schon gar unsere/meine Mediathek nicht.]
Aus der Verwendung (respektive aus der Nichtverwendung eines – zumal erwarteten – Zitates) folgt (also) auch nicht etwa eine ‚inhaltlich‘-nennbare Zustimmung, Empfehlung oder Aneignung (zur/als ‚Nahrung‘ – noch nicht einmal da / wo ihm nicht explizit widersprochen wird).
[‚Es gibt
nichts Neues …‘]  Die
Bewährung, bis Bewahrung, von Traditionen, gleich gar gelebter (und vielleicht sogar so ähnlich überlieferten, bis
ursprünglichen/begonnenen), kann sich durchaus auf deren erinnerliches
Vorhandensein beschränken, muss jedenfalls kein
Beleg ihrer Richtigkeit (gleich
gar nicht einmal intersubjektiv konsensfähiger Nützlichkeit, bis Unausweichlichkeit) sein oder werden.
Die
Bewährung, bis Bewahrung, von Traditionen, gleich gar gelebter (und vielleicht sogar so ähnlich überlieferten, bis
ursprünglichen/begonnenen), kann sich durchaus auf deren erinnerliches
Vorhandensein beschränken, muss jedenfalls kein
Beleg ihrer Richtigkeit (gleich
gar nicht einmal intersubjektiv konsensfähiger Nützlichkeit, bis Unausweichlichkeit) sein oder werden.
Sie, ![]() Tradition/en,
sind auch und dennoch nicht immer nur
‚Silber‘/geredete (äußere oder
auch verinnerlichte) Form / Art
und Weise, sondern können als solche auch (zumindest komplexitätsreduzierender, bis prinzipientranszendierter)
Inhalt / ‚Gold‘ sein/werden – allerdings im e/Einen und/oder\aber
(ebenso naheliegenderweise)
im Anderen irren, und
ferner, doch gleichzeitig irgendwo zwischen. respektive an ‚falsch oder richtig‘ vorbei, bis nicht,
verstanden werden.
Tradition/en,
sind auch und dennoch nicht immer nur
‚Silber‘/geredete (äußere oder
auch verinnerlichte) Form / Art
und Weise, sondern können als solche auch (zumindest komplexitätsreduzierender, bis prinzipientranszendierter)
Inhalt / ‚Gold‘ sein/werden – allerdings im e/Einen und/oder\aber
(ebenso naheliegenderweise)
im Anderen irren, und
ferner, doch gleichzeitig irgendwo zwischen. respektive an ‚falsch oder richtig‘ vorbei, bis nicht,
verstanden werden.
 UndװAber es
verkennt/missbraucht
UndװAber es
verkennt/missbraucht ![]() wer sie für unwandelbar hält, oder als
eindeutig ausgibt/einklagt, was
dennoch/gerade unbeliebig treu: ‚Weitergabe des
Feuers, bis gar nicht zerstörendes אש /esch/, anstatt Bewahrung der (ihrerseits weder nutz- noch
harmlosen) Asche‘ wurde/wird bereits vielfach formuliert/reklamiert.
Doch geht das Gemeinte
/ so Verborgene wesentlich darüber hinaus.
Mindestens bis zur / als der
gegenwärtigen Anwendung des jeweils Überlieferten, respektive dafür
Gehaltenen / daraus Hergenommenen, am jeweiligen Ort – bei, mit, wegen, unter
und gegen ‚zeitgenässische/n‘ (an-
und/oder abwesende) Menschen
und Umstände/n.
wer sie für unwandelbar hält, oder als
eindeutig ausgibt/einklagt, was
dennoch/gerade unbeliebig treu: ‚Weitergabe des
Feuers, bis gar nicht zerstörendes אש /esch/, anstatt Bewahrung der (ihrerseits weder nutz- noch
harmlosen) Asche‘ wurde/wird bereits vielfach formuliert/reklamiert.
Doch geht das Gemeinte
/ so Verborgene wesentlich darüber hinaus.
Mindestens bis zur / als der
gegenwärtigen Anwendung des jeweils Überlieferten, respektive dafür
Gehaltenen / daraus Hergenommenen, am jeweiligen Ort – bei, mit, wegen, unter
und gegen ‚zeitgenässische/n‘ (an-
und/oder abwesende) Menschen
und Umstände/n.
|
«Reinheit/Reinheitsgesetze Levitische Terminologie und
[bis ‚versus‘; O.G.J.] hygienische Begrifflichkeit |
|
[Im Vorstellungshorizont, unter (bis von) der Erwartungsfirmamentkuppel ] |
|
|
Unter den ausführlichsten Bestimmungen der [sic!] biblischen Religion [sic! einer der ‚Kultur‘-Begriffe erfasst ‚sozialfigurative Judentümmer-Fragen‘ zwar auch nicht hinreichend, läge aber vielleicht näher am Alltagsleben der Israeliten, zumal/gerade ‚in der Wüste‘, als das gänige, oft erwähnte (teils nebenstehende) spätere/antike lateinische Denkkonzept für, bis anstatt, dalet-taw דת; O.G.J.], die dann noch von den [sic!] Pharisäern und den ic!] Rabbinen weiterentwickelt wurden, befinden sich die Gesetze über „rein“ (tahor) [טהור] und „unrein“ (tame) [טמא], wie sie besonders in den Büchern Levitikus und Numeri des Pentateuchs, also in der sog. „Priesterschrift“ der hebräischen Bibel, stehen. |
דת
Religion {religion} Glaube; Religion; Vertrauen; Redlichkeit {faith} Religion; Glaube; Überzeugung,... {belief}
Evangelium; Gospel (religiöse Lieder der... {gospel} Evangelium, vier erste Bücher des Neuen... {Gospel} Gesetz; Urteil; Gericht; Recht {law}
Panzerfaust, tragbare leichte Waffe in... {LAW (Light Anti-Armor Weapon) } Gesetz; Regel; Sitte; Spielregel;... {rule} Dekret; Erlaß; Urteil {decree} |
[O.G.J. about ‘religion/s‘: Nämlich überindividuelle,
soziokulturell figuriert, gegenüber
so fragwürdig fragiler emotionaler Geborgenheit(smängel) scheint / verlockt
intellektuelle / denkerische (gleich gar ‚Heils‘-)Gewissheit leichter – namentlich ohne ungeheuerliche Anderheit
undeterminiert freie Subjekte – Bestand/Sein zu versprechen. |
insofern und von daher also durchaus mit/in alef-mem-nun-Wortwurzel-א־מ־ן bis /‘emuna(h)/ אמונה im ‚persönlich( gar friedlich)en‘ Subjekt-beziehungsrelational qualifizierten (häufig auch ‚innerlich‘, bis ‚spirituell‘, und manchmal sogar wohl treffender/davon zu unterscheidend ‚kontemplativ/besinnlich‘, genannten) Sinne (der – so weitgehend verdunkelten / verschütteten / übersehenen, ‚eigentlichen‘ – primären Struktur) von ‚Glaube‘ treffend (die ‚Sphäre‘ mehr oder minder dummen/törichten, bis klugen und weisen, Praktiken des ‚Vertrauens, Hoffens und Liebens‘ enthüllend / bemerkend) repräsentiert; |
|
So gelten z.B. einige Tiere als „rein“, andere wiederum als „unrein“ (Lev 11), Mann und Frau werden durch den [Samenerguss beim; O.G.J.] Beischlaf „unrein [jedoch weder vom Sauberwaschen alleine/sofort wieder ‚rein‘, noch wird (oder soll) so irgendjemand geschlechtliche Vermehrung verboten / verhindert werden; O.G.J.]“ (Lev 15, 16-18). Der Blutfluß der menstruierenden Frau (Lev 15, 19-24), der Wöchnerin (Lev 12), wie überhaupt jeglicher Blutfluß [wie gar auch immer veranlasster Blutkontakt, eben bereits nochidisch auch tierischer; O.G.J.] bei Mann und Frau führen zur „Unreinheit“ (Lev 15). Das tut auch der Aussatz (Lev 13-14), worunter wahrscheinlich die Schuppenflechte gemeint ist. Hauptquelle der „Unreinheit“ ist aber der Leichnam (Num 19). Diese [sic! so manche solcher; O.G.J.] „Unreinheit“ ist auch übertragbar und kann nur durch verschiedene Reinigungsrituale (vgl. z.B. Num 19), bei denen immer das Wasser [ersatzweise Sand – plus stets das Vergehen, teils längerer zeitlicher, Fristen, danach; O.G.J.] eine Rolle spielt, beseitigt werden. |
אמונה Religion; Glaube; Überzeugung,... {belief}
Glaube, Glaubensbekenntnis, Überzeugung {creed} Evangelium; Gospel (religiöse Lieder der... {gospel} Evangelium, vier erste Bücher des Neuen... {Gospel} Grundsatz, Lehrsatz, Lehre;...
{tenet} Kredo, Glaubensbekenntnis {credo}
Dogma (Glaubenssatz); Glaube {dogma}
Glaube; Religion; Vertrauen; Redlichkeit {faith} Religion {religion} אמון
Sicherheit, Glaube; Pfand; Vertrauen;... {trust} Geheimnis; Zuversicht, Sicherheit,... {confidence} Glaube; Religion; Vertrauen; Redlichkeit {faith} Treue; Naturtreue; Glaubwürdigkeit;... {fidelity} Vertrauen; Zutrauen; Verlaß; Stütze {reliance} Vertrauen, Glaubwürdigkeit {credibility}
Kredit, Kreditgeschäft; Glaubwürdigkeit;... {credit} Glaube {credence} Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit {credibleness}
Vertrauen; Zuversicht {confidentiality}
Vertrauen; Heimlichkeit {confidentialness}
Abhängigkeit; Vertrauen {dependance}
Abhängigkeit; Vertrauen {dependence}
מונה
(>>מֻנָּה) /muna/ ernennen; nominieren {nominate} |
von Vorzeichen und (vorfindliche, bis entwickelte) Vorschriften – mithin also ups juristisch kodifizierbar, auf- bis festgeschrieben, und / oder dies (namentlich [paulinisch kaum völlig verworfene?} ‚Gesetzestreue‘) gar (ethisch [jedenfalls prinzipiell], sittlich [ausgestaltend], ‚heilig‘, ‚geistlich‘ pp.) überbieten s/wollend |
also überhaupt diesbezüglich Kenntnisse, und zwar mit deren Deutungen/Anwendungen, voraussetzend/verlangend, bis sogar (auch kontrafaktisch/künftig – הבא) erreichen s/wollend respektive müssend, wie sie ‚(überzeugungs- bis jedenfalls verhaltens-)inhaltlich‘ (gleichwohl sekundär doch) gestützt /dat/ דת mit aus/zu den (Erkenntnisparadigmen-)Wortwurzeln (‚gebrauchter‘ דרש /darasch/-Arten daleds דלד bis/statt dalets דלת): ידע׀דיע׀דעה׀דעת, bestenfalls irreführend ebenfalls ‚Glaube‘ genannt werden, aber Überzeug(ungshorizontereichweicht)en, Theoriedenkformen und Vorsellungsfirmamente meinen, bis sind, die zudem für (gar höherrangiges / besseres, da ‚außerraumzeitlich‘ / transzendent offenbartes, – wo nicht bereits grenzenlos absolutes, doch eben deswegen ja empfängerseitig keineswegs weniger kritisch deutungsbedürftiges – Hyper-)Wissen gehalten werden, gar ohne dies(e Verstöße gegen das / Verfehlungen, dessen, was durch mindestens dreifache Beschränkungen qualifizieres Wissen überhaupt wäre, ist und kann) selbst so zu bemerken/beachten (durch Anderheit/en meist eher, und immerhin, wenn auch häufig konflikthaft, erlebend spiegelbar); |
|
Um überhaupt einem Verständnis dieser Bestimmungen nahe zu kommen, muß zunächst einmal begriffen werden, daß sich die biblischen und rabbinischen Begriffe von „rein“ und „unrein“ mit einer hygienischen Vorstellung von „sauber“ und „unsauber“ absolut nicht decken. Nicht nur kann von einigen Tieren, die als „unrein“ gelten, nicht behauptet werden, daß sie etwa unsauberer wären als Tiere, die als „rein“ gelten. Nicht nur vermißt man Neben dem „Aussatz“ die Erwähnung von anderen Krankheiten. Der rein [sic!] levitisch-kultische Sinn ist aber daraus erkenntlich, daß der rabbinische Fachausdruck für „kanonisch“ (bei der Beschreibung von biblischen Schriften) lautet: „Sie verunreinigen die Hände“, während nichtreligiöse [sic? eher ‚nichtkanonische‘, ohne deswegen etwa irgendwie ‚profan‘, oder gar ‚ungeistlich‘, sein zu müssen? O.G.J.] Schriften „die Hände nicht verunreinigen“ (mYad 3, 4; 4, 6). Damit sollte gewiß nicht gesagt werden, daß die biblischen Schriften „unsauber“ sind! (Zur Erklärung dieser merkwürdigen Terminologie vgl. ./. Levy, Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim, Bd, II, Darmstadt 1963, 163f.) Tabus in der biblischen Religion [sic! wobei zumindest dieser lateinische Fachbegriff biblisch nicht (weder tanachisch noch apostolisch) vorkommt, zumal gar mehr/anderes – etwa Lebenspraxis, Gesellschaftsordnung/en bis kultische Rituale Jisraels, respektive der Juden – gemeint sein / adressiert werden mögen; O.G.J.] |
um so/richtig zu leben/dahin (sei wäre es nun eher ‚zutück‘ und/oder ‚überhaupt mal, zumal sozial geduldet, bis anerkanntermassen, dahin‘) zu kommen, dass einem etwas, bis jemand, gleich gar Mächtigere |
(zumal an Umständen, [planmäßig bis kontingent, oder notwendigerweise, bis willkürlich] zusammentreffende Ereignisse und zumindest Mit- bzw. Nebenmenschen und insbesondere deren Gemeinwesen mit Verfügungen über mach elementare Dinge / hirokratischen Ziteilungsansprüchen von gemeinschaftlichen Heilsgütern., sowie lberhaupt Lebewesen, bis – mehr oder minder [ent]personalisiert – hin zu Schicksalhaftem, Karmatischem, Prinzipiellem, Göttern, Erwartbarem/Unwahrscheinlichem etc. – gar nicht so selten anstelle, oder jedenfalls im Namen. Gottes/Adinaus, wie immerhin Jisrael zu bemerken bisher kaum müde geworden) |
|
|
einem, dem Einzelnen/jeweiligen Individuum, mit Zugehörendem/wWichtigen – warum auch immer (vorzugsweise vorher/ursächlich erkennbar: da tauschhändlerisch, bis determiniert – oder aber eben vertrauenssensitivst zuverlässiger-, liebender- bis gnädigerweise) – duldsame, bis wohlwollende, Gegenüber sind/werden. – Worin/Wobei sich nichtreligiöse Realitätenhandhabungsweisen (auch noch so ‚reine‘ Anschauungen erweisen sich stet/bereits als Verhalten) und dafür Gehaltenes eher in ihren (jedenfalls vorgeblichen) Verzichten auf transzendente Setzungen/Argumentationen abheben s/wollen, nicht aber durch Verzichte auf intersubjektive Vernunftenaxiome(setzungen); die eben/allerdings auch ‚Religionen‘ verder zu leugnen vermögen, noch deren Verwendung ernsthaft betreiten/verheimlichen, respektive vor Überprüfungen/Kritik schützen, sollten. – |
‚Inhaltlich‘ wesentlicher als immerhin solch soziale Schließungen (vgl. zur Herrschaftsausübung [des und] der über den und die Menschen: Partikularismus-Vorwürfe / ethologische Unterscheidungen). bis eben (gar politologischen) Motivationsmanöver, bleiben/wären allerdings die Wohin/Wozu-Fragen des geforderten Sinneswandels / Umsinnens, bis erforderlichen, Umkehrens / Rückkehrens zu (einem, gar dem ]jeweiligen]. Heils-Weg) und (des nochmals oder dennoch) Aufsuchen( des – wie ‚final-durativ‘ auch immer verstandenen – Zieles / namentlich Gotte)s: |
||
|
So verschieden die modernen
wissenschaftlichen Theorien über die
biblischen [sic! bis
jüdischen] Reinheitsgesetze auch sind, es scheint doch festzustehen, daß diese Gesetze [sic!] in ihrem Ursprung auf [sic!] archaische [sic? falls nicht inzwischen unbeliebtere / uneingestandene
Handhabungsweisen / Erklärungsformen des
Vorfindlichen, als (zumal fortschrittsparadigmatisch); O.G.J.] Tabus zurückgehen [und/oder diesen aber in einer, gar ups menschlicherseits, bis
kulturell, akzeptablen / aufhebenden Art und Weise, widersprechen, indem Praktiken
/ Rituale verändert – gar zivilisatorisch beschränkt /
entzaubert/e – in höherer, (ihrerseits ja
gerne der kompromisshaften Vermischung/en
verdächtigten, bis für ‚Entweihungen‘ anfälligen) Form bewahrt werden; O.G.J. ]. |
Auflösende
Vernichtung ( |
Dialogische
Versöhnung (mit/der/in)
gegenübermachtgesellschaftliche(n regeneratioons- und fortentwicklungsfähigen) Bundesverhältnisse(n) verschiedener ‚Ebenbürtiger‘/Freier – wechselseitig
respektabstandsfähig, gar waw |
|
Einige der „unreinen“ Tiere mögen in der polytheistischen
Welt Opfertiere gewesen oder
sogar als Gottheiten verehrt worden sein. Gegenüber geheimnisvollen [sic! auch heute menschlicher- bis
Wissenschaftlicherseits nicht etwa vollständig
deterministisch reproduzierbaren; O.G.J.] Vorgängen, die mit Zeugung und
Geburt in Verbindung standen, wie bei der [sic! mehr oder
minder; O.G.J.] regelmäßigen
Menstruation, reagierte man [sic!] mit Ehrfurcht und Scheu. [sic!] Bei ungewöhnlichen [sic! eher wenigen Fachleuten
bekannten; O.G.J.] körperlichen
Ausscheidungen witterte [sic! physiologische Instinkte sind jedoch weder notwendigerweise
‚primitiv / archaisch‘, noch unreflektierbar, und lassen sich ‚kulturell‘
durchaus erheblich überformen; O.G.J.] man eine die Regelmäßigkeit [bis ‚Gesundheit‘, ‚Reproduktion‘
pp.? O.G.J.] bedrohende
Gefahr; und vor dem Tod und dem, was mit ihm
zusammenhängt, fürchtete man sich [sic! |
anthropologische Widersprüche
argumentzieren zwar, dass archaische, animistische etc. ‚Religionen‘ ein ‚normales entspannteres‘ / ‚natürlicheres‘ Verhältnis zum Tod hätten, vermögen
gleichwohl dessen Schrecken und zumal rituellen Bewältigungsbedarf nicht
verschwinden zu lassen. – Wesentlicher erscheint O.G.J. hier allerdings die Fragen der
Furcht- und Ehrfurchaddresierung: mehr oder minder beeinflussbare /
determinierte Schicksalsmächte versus persönlich interaktionsfähiger
Bundes-G‘tt]. |
|
[Ob nun völlig neue / ganz andere, oder immerhin erneuerte / vollendete, ‚Erde‘ /eretz/ ארץ gar auf / mit jud יוד (anstelle des/nach dem bisherigen he הא – [un]menschlicherseits ja nicht selten brav zum תב׀ה taw תו ‚stützend‘ flextiert) aus dem ganz großen, ‚eigentlichen‘ Zwiegespräch …?] |
|
|
Die Ursprünge dieser Tabus [sic! |
wo diese gängig-gebildete fachbegriffliche Denkform / Unterstellung nicht eine zu retrospektive ‚bürgerlicher‘ Vorstellungen in Anthropologie, bis Ethnologie, unter überzogen-unaufgeklärtem Fortschritts- bis Überlegenheitsparadigmata, geschuldet wurde / wird? O.G.J.], |
|
|
|
|
so interessant sie auch für die Anthropologie sein mögen, sind für den [sic!] religiösen Menschen und für die Religionswissenschaft weniger wichtig als die Rolle, welche diese Bestimmungen in der biblischen und in der rabbinischen Religion [sic? Sichtweise und (Er-)Lebenspraxis; O.G.J.] spielen. Hier dienen sie nämlich der Selbstvergewisserung des Gottesvolks [sic! |
mindestens und zumal aber den Nachkommen Israels ‚in der
Wüste‘ und gelich gar als politisch-soziologisches und ethnographisch-kulturelles
Subjekt, zumal als Bundesgegnüber (gar nicht allein seinen,
sondern אחד des Einen) G’ttes.], |
|
|
|
|
als Merkmale des Unterschieds von den Andersgläubigen [sic! |
jedenfalls den Andershandelnden (in
welchen Wortsinne auch immer: ‚deretwegen‘) – aber eben auch als Juden,
bis gar hinzugenommene / anerkannt qualifiziert gottesfürchtige Nichtjuden,
verbindende Gemeinsamkeiten (vgl. zu diesbezüglichen
Strittigkeiten auch unten / das Apostelkonzil Apg. 15); O.G.J.] |
|
|
|
|
und als Zeichen der Selbstheiligung (vgl. Lev 11, 43-47). Auch ist nicht zu übersehen, daß der in der antiken Welt weitverbreitete Totenkult im biblischen Israel dadurch unmöglich gemacht wurde, daß gerade von den Priestern ein höherer Grad der levitisehen Reinheit verlangt wurde, der ihnen etwa den Aufenthalt in dem selben Raum mit einem Toten strengstens untersagte (Lev 21, 1). |
Heiligung (zumal als Heils-Erlanungs-Mittel) mag auch
insoferen wesentlich in Selbst- und eher weniger in Heiligung durch
segenende/fremde Andere gedacht sein/werden als die (wie ‚innerlich‘ und oder
‚äußerliche‘ auch immer) Absomderung bedeutet/beinhaltet (vgl. die
einschöägigen Stichworte des Begenungslexikons). |
|
|
|
|
Pharisäisches und rabbinisches
Judentum Die Pharisäer und die Rabbinen haben dann die levitisehen Reinheitsgesetze bis in die [sic! |
bzw. das was sie jeweils – gar zeitlich und örtlich, im Detail, durchaus unterschiedlich – mehrheitlich dafür hielten, bis (zumal konfessionell / national weiterhin verschieden aufrechter)halten / entdecken; O.G.J.] |
Zwei |
|
|
allerletzten Konsequenzen ausgearbeitet, wobei sie auch bewußt Reinheitsgesetze, die von der Bibel nur für die Priesterschaft bestimmt waren, als für das ganze Volk [sic!] verbindlich betrachteten. Es schwebte ihnen hier das Ideal von Ex 19, 6 vor das ganze Volk [sic!] zu „einem Reich [sic!] von Priestern“ zu machen. [sic! |
gar eher universalistische Ausbreitungsaspekte auf alle Menschen, oder vielleicht eher als Dienstleistung für die ganze Menschenheit zu verstehend, bis verstanden? O.G.J. an ‚theokratisch Mächtiges‘ der ‚zweiten Tempelperiode‘ gemahnt] |
||
|
Eine ganze Ordnung der Midrascha ist den
Reinheitsgesetzen gewidmet. Dagegen wird von allen zwölf Traktaten der Midrascha-Ordnung „Reinheiten“ nur ein einziger nämlich der von der Menstruation handelnde Traktat Niddah, im Talmud selbst weitergeführt und kommentiert. Da die meisten Reinheitsgesetze irgendwie mit dem Tempelkult in Verbindung standen [sic! |
grammatikalische Tempusfragen (Durativ, Pretäritum etc.)
sind hier beachtliche eschatologische
/ gottesreichliche (Erwartungs-)Wahl-Entscheidungen; O.G.J.] |
|
|
|
(vgl. J. Neusner), hätte es der rabbinischen Absicht, das Judentum unabhängig von der Existenz eines Tempels [sic! oder sonstiger ‚äußerlich‘ sichtbarer Schechina-Wohnstätte/n-שכינה, ‚bei/aus/neben‘ den Torarollen/Synagogen? bestehend / funktionierend O.G.J.] aufrecht zu erhalten, entgegen [sic!] gewirkt, wenn der Glaubensgemeinschaft [sic!] weiterhin die auf den Tempel bezogenen Reinheitsvorschriften für die gewöhnlichen [sic!] Mahlzeiten und die täglichen Gebete auferlegt worden wären. |
|
Was an/anstatt Stiftshütte-, oder gar Lehrüberzeugtheiten- äh Steinfafeln-, bis Tempelkult, g’ttesdienstlich wie praktiziert werden kann respektive darf, ohne dem Verdikt anheim zu fallen / im Verdacht zu stehen Götzendienst zu sein/werden, gehört weiterhin zu den (zumal innerhalb der jeweiligen soziokulturellen, bis religiösen, Gemeinwesen) besonders schwierigen Fragen. |
|
Ablehnung der Reinheitsgesetze im Neuen
Testament [sic! |
durch manche Apostolischen Schriften? O.G.J. etwa mit Zwi Sadan; vgl. nebenstehende Auszüge] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Im
Neuen Testament [sic! eben
nicht nur strittig ob dies(er Textkorpus, bis Kanon, überhaupt) zu welcher
Verbindlichkeitsstufe der/an ‚göttlicher Weisung/Tora(h-Wahrnehmung)‘ zählt, sondern zumal was, wie (namentlich: hallachisch-verbimdlich
versus h/aggadisch-erzählerisch) zu verwenden/verstehen; O.G.J.]
zeigen Stellen wie Mt 15, 1-20; 23, 2 -26; Mk 7, 1-13 und Lk 11, 37-41, an
denen Jesus gegen die rabbinischen Reinheitsgesetze polemisiert, daß man sich
in der frühen Kirche [sic! gar
schon den (ja zumindest lokal/regional verteilt
belegten, bis handelnden ‚Ur‘-)Gemeinden? O.G.J.] bereits
über die Reinheitsgesetze hinweggesetzt [sic! War solches ‚nachher‘/zu seiner Zeit beabsichtigt, für
richtig/nötig/geboten hält, respektive wo ablehnende Verwerfung ([manch]
rabbinisch-jüdischer [bis dazu gewordenen]) Auffassungen, zwecks Abgrenzung,
Mission etc. pp., der Regelfall – muss(te und zwar auch bis ins 17. nachchristliche Jahrhundert)
bekanntlich so argumentiert werden: als ob dies schon immer – hier genauer
(zumindest): ‚eben bei/für/von Jesus (gar
überraumzeitlich
[prä]existent) – so gewesen / angeordnet‘ / jedenfalls ‚dies nichts (das
legitim) Neue/s‘ / geändert‘ / allenfalls
‚auslegender תורה-Kommentar‘ sei; O.G.J. mit Sir Francis et.al.] hatte.
Allerdings verlangt der Jesus der Synoptiker noch [sic! Wobei, bis wogegen, etwa Zwi Sadan aufzuzeigen bemüht/vermag, dass Jeschua sich durchaus so ‚biblische‘ Regeln – ‚das Gesetz Mosches‘ – erfüllend/achtend verhielt, wie nicht etwa allein nur er sie versteht; O.G.J.] von dem geheilten Aussätzigen, daß er die levitisehen Reinheitsvorschriften einhält (Mt 8, 1-4; Mk 1, 40-45; Lk 5, 12-16), aber es ist
Doch aus seiner ganzen, im Neuen Testament [sic!] wiedergegebenen Einstellung
klar, daß ihm die Verinnerlichung der
Religion [sic! hier mag dieser übliche Ausdruck wohl am wenigsten passen, oder (dies) den Konflikt verdeutlichen, der ‚Innerlichkeit‘ vom zwar unverzichtbaren ‚Äußerlichen‘, aber nicht darauf (schon gar nicht auf ‚Fassaden‘-Vorstellungen) beschränkbarem, trennt; O.G.J.] [Abb. Fassaden h29c Papiermodellspiegel] wichtiger war als das von den
Pharisäern dem Priestertum entlehnte Händewaschen vor den Mahlzeiten.
Moralisierung
[sic! gar verdächtig jäufig eher eine ‚Veräußerlichung‘, bis zur Schau-Stellung‘; O.G.J.]
levitischer Vorstellungen
Diese Verinnerlichung der [sic!] Religion [sic!] –
bei aller Bejahung des Zeremonialgesetzes! - war übrigens auch der Fall bei den Rabbinen, die dabei eine Richtung einschlugen, die schon in der hebräischen Bibel selbst vorgezeichnet ist - wenn etwa die levitisehen Begriffe von „rein“ und „unrein“ auf
moralische [sic! gar ethische, jedenfalls nicht allein/nur akulturiert erwarteter; O.G.J.], d.h. mit dem Kult nicht
zusammenhängende Vergehen, angewandt wurden (vgl. A. Büehler). So wurde dann auch der Versöhnungstag,
der in der Bibel selbst (Lev 16) [zumindest ‚auch‘; O.G.J.] einen
levitisehen Reinigungskult darstellte, in seiner späteren rabbinischen Entwicklung [sic! oder jedenfalls ‚Entdeckung‘; O.G.J.] zu einem Tag der moralischen [sic! ‚ethischen‘, mit Menschen, und gar Umständen,, bis zu G’tt, versöhnenden, bis eben ‚kontemplativen‘; O.G.J.] Besinnung.
Gegenwärtiges
Judentum [sic! gegenwärtige Judentümmer/‚Konfessionen‘; O.G.J.]
Bei den heutigen Juden der orthodoxen
Richtung spielen nur noch die mit den
Reinheitsgesetzen verbundenen Speisegesetze, die Vorschriften, die mit der Menstruation zusammenhängen, das
Händewaschen vor den Mahlzeiten
und das Verbot für die von den ehemaligen Tempelpriestern abstammenden, an Beerdigungen (außer im Fall von
nahen Verwandten, siehe Lev 21, 1-4)
teilzunehmen, eine Rolle im religiösen [sic! eher ‚im alltäglichen und feiertäglichen‘; O.G.J.]
Leben, Von vielen konservativen Juden
und einigen liberalen und reformierten
Juden werden die Speisegesetze entweder total oder teilweise gehalten, aber
die anderen von den orthodoxen Juden
noch [sic! Wieder die Omnipräsenz des Entwicklungsoaradigmas in eine bestimmte Richtung; O.G.J.] eingehaltenen Reinheitsvorschriften finden in diesen Kreisen keine weitere Beachtung.»
![]() (Jakob J. Petuchowski zusammen mit Cl.Th. im
jüdisch-chrislichen Begegnungslexikon,
S. 171-173 der 3, Nwuaufkage 1997,, so bereits Sp. 332- 1989;
verlinkende Hervorhebungen O.G.J.)
(Jakob J. Petuchowski zusammen mit Cl.Th. im
jüdisch-chrislichen Begegnungslexikon,
S. 171-173 der 3, Nwuaufkage 1997,, so bereits Sp. 332- 1989;
verlinkende Hervorhebungen O.G.J.)
Perspektiven für Dialoge/Trialoge … jedenfalls zwischen Christen und Juden, bzw.
gar mit und unter Nichtjuden bis Nichtchristen, wurden in diesem / für den
Artikel nicht noch einmal zusammenfassend, bis weiterführtend,
herausgearbeitet. 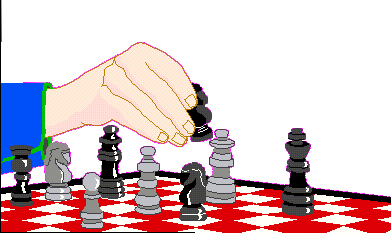
a) Zunächst
irritiert so manche die so wesentliche
Trennung von Reinheit und Sauberkeit.
b) Als unvermischte Absonderung verstandene Heiligung kollidiert
insbesondere äußerlich mit universalistischen
Aspekten. Und die nicht weniger berüchtigte (weder äißerlich erzwingbare, noch unmittelbar – und
menschlicherseits sozial bis politisch schon
gar nicht [voll]ständig überwacht – kontrollierbare) als berühmte/viel verlangte ‚innere (Heim- öh)
Einkehr‘ verführt nur zu gerne zur bemühten/leichtfertigen
Empfindung, ReSCH nur
sich selbst näher bei Gott
zu … Sie/Euer Gnaden wissen schon.
c) Nicht
zuletzt daher (dass/wenn nur G’tt in des,
und gar der, Menschen לבב / innerstes Herz sieht) bieten(drängen sich Vereinfachungen / Komplexitätsreduzierungen auf die / Urteile und
Führungsverfahren mittels, respektive zwecks, der äußeren Erscheinungen (dem Aussehen, den [gemachten oder
unterlassenen] Aussagen etc. bis immerhin Verhaltensweisen) zu Rückschlüssen auf / als Zeichen der ‚inneren
Überzeugtheiten‘ an/auf: Wer sich (und
gar in dem Mass/Totalitätsgrad wie jemand) sich an die heteronomen Vorgaben und Erwartungen (zumal der/der anderen Menschen) hält, gilt damit/dadurch als entsprechend
rechtschaffen, rechtgläubig pp.; ‚das Warum‘ (des Subjekts) lasse/lässt sich ja nicht (mal/zumal Bekenntnisse / Geständnisse
– zweifelsfrei) prüfen, äh stets (mindestens einseitig) unwiderlegbar dietrologisch/passend
unterstellen.
d) Der ja längst (vom genauem, gar kritisch prüfenden, Zuhören her/weg) als Gefolgschaft(ssynonym um)verstandene ‚Gehorsam‘
möge, bis muss, den Gemeinwesen zwar genügen –
was diese aber keineswegs an Eidesverlangen,
Gesinnungsunterstellungen und Überprüfung-behauptenden Verfahren hindert.
‚Dies/Sie nütze/schade
aderen/allen/nir/sich/uns‘ Aussagen, bis Behauptungen, oder immerhin/sogar Feststellungen / Gewissheiten, respektive Sorgen / Vorsichten und Vorwürfe
befruchten wahrscheinlich: (zwar) nicht immer/nur – (aber/doch)
hinreichend
gleiche / häufige / mächtige / richtige / variiierte / viele Wiederholungen ‚des-Besseren‘ / ‚Desselben‘ / ‚des-Wahren‘ / ‚des-Zwingenden‘ müs(t)en, äh werden doch hoffentlich bis wohl, verhaltensrelevant:
 Nicht
einmal, dass verursachte Um-
oder Zustände immer … müssten und wüssten manche schon besser / gegenteilig /
mehr / weniger-!/? [‚Auch‘,
ausdrücklich wer hier wörtlich
auf ‚Gerade‘
besteht wird deshalb nicht
immer/üverall ausgeschlossen: Inklusive dadurch begünsitigtes, ermöglichtes bis
veranlasstes, etwa Husten oder Reizen (gar zu müssen/tun) ‚beruhige sich/manche‘, bei
/ trotz aller Peinlichkeiten ungültiger und unzuverlässlicher Einzelfälle, in
manch(
ander)en Einzelfällen, durch&trotz ‚mehr-deselben‘ Rauchens, äh suchen-Tuns]
Nicht
einmal, dass verursachte Um-
oder Zustände immer … müssten und wüssten manche schon besser / gegenteilig /
mehr / weniger-!/? [‚Auch‘,
ausdrücklich wer hier wörtlich
auf ‚Gerade‘
besteht wird deshalb nicht
immer/üverall ausgeschlossen: Inklusive dadurch begünsitigtes, ermöglichtes bis
veranlasstes, etwa Husten oder Reizen (gar zu müssen/tun) ‚beruhige sich/manche‘, bei
/ trotz aller Peinlichkeiten ungültiger und unzuverlässlicher Einzelfälle, in
manch(
ander)en Einzelfällen, durch&trotz ‚mehr-deselben‘ Rauchens, äh suchen-Tuns]  Dass,
zudem wann, gleich gar besonders hoch besteuerte (also dennoch häufig konsumierte, oder so begrenzte-?) Mittel schlecht bis verboten sei/werde
bekannt.
Dass,
zudem wann, gleich gar besonders hoch besteuerte (also dennoch häufig konsumierte, oder so begrenzte-?) Mittel schlecht bis verboten sei/werde
bekannt.
Exemplarisch reicht
beindruckend, bis auffällig und dementsprechend
konfliktfähig
(bis manche/n unerträglich affizierend vorkommend),
immer, und bereits
‚seit‘ Genesis / berechsicht / ‚Anfang‘ (zumal ‚Kapitel drei‘ – dagegen/wogegem verstoßend-?)
auch, dass/wo gar nicht alles (jedenfalls
ernährungsphysiologisch, bis denkerisch, oder ‚sozialverträglich‘) gegessen zu werden braucht, was vielleicht (oder ‚nachweislich‘ / manchen, äh
allen / nur Absonderlichen, Besserwissenden oder gleich böswilligen
Ungeheuern, respektive … nicht) gut schmeckt:
 Abb.?????? [Debütantinnen beim Anschneiden der
Balltorte]
Abb.?????? [Debütantinnen beim Anschneiden der
Balltorte]
#olaf
Substituierbarkeit/en
schon
oder spätestens von/zwischen Fetten
versus Kohlehydraten und höher-modale
empören/erschüttern manche obwohl/wie sie nicht deckungsgleich identisch wirkend, zustande kommen usw.: ‚Dass einem bestimmte Nahrungsmittel (Ausdrucks- und Denkweisen, gar
nicht alleine apostolisch, d/noch
anders ebenfalls) schaden
können‘, braucht zwar nicht bestrotten zu werden um bemerken zu können:
dass dies weder nach 20 Minuten klar oder überstanden sei, noch immer und
überall für bis gegen alle / dieselben Menschen gleich zu verlaufen hat;
allenfalls/nur solches zu
berücksichtigen / bezweifeln / erwähnen / prüfen / sagen / wagen darf(!) nicht immer allen empfohlen
sein/werden!  [Kaum etwas eignet sich
derart perfekt zu Achtsamkeiten, Entzweiungen, Erklärungen, Komplizierungen,
Reglementierungen, Unterhaltungen, Verachtungen, Verbindungen, Vereinfachungen,
Widerstreben, Wissen und Zugehörigkeiten wie Ernährungsfragen] Begrenzungsregelungen gemeinwesemtlicher
Intransparenzen, äh ‚natürlicher‘ und sonstiger Willkür zivilisieren durchaus.
[Kaum etwas eignet sich
derart perfekt zu Achtsamkeiten, Entzweiungen, Erklärungen, Komplizierungen,
Reglementierungen, Unterhaltungen, Verachtungen, Verbindungen, Vereinfachungen,
Widerstreben, Wissen und Zugehörigkeiten wie Ernährungsfragen] Begrenzungsregelungen gemeinwesemtlicher
Intransparenzen, äh ‚natürlicher‘ und sonstiger Willkür zivilisieren durchaus.
«Speisegesetze 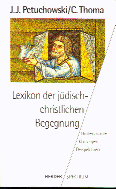 [Längst
nicht nur unter oder von Juden, respektive sonstigen Semitinnen und Semiten,
aufgestellt bis verlangt – wo diese nicht notwendigerweise auch für die ganze übrige
Menschenheit zu gelten hätten]
[Längst
nicht nur unter oder von Juden, respektive sonstigen Semitinnen und Semiten,
aufgestellt bis verlangt – wo diese nicht notwendigerweise auch für die ganze übrige
Menschenheit zu gelten hätten]
Bedeutung
Unter den Observanzen
des Judentums spielt die Einhaltung der
biblischen und rabbinischen Speisegesetze eine erhebliche Rolle, da [sic!] diese Gesetze die [sic!]
Religion in das alltägliche Leben der gesetzestreuen [sic!] Juden bringen.  [Vom Staatsbankett – nicht nur des venezianischen Dogen,
immerhin eine seiner wichtigsten zeremonialen
Aufgaben – bis gleich gar als (jedenfalls bisher) ‚letztes‘ bekannt geworden
‚Abendmahl Jeschuas auf Erden‘ (mit so
mancherlei Bezügen auf/wider – namentlich vorherige und seitherige –jüdische
zumal Pesach-/Sederfeiern) reichen vergleichsweise beliebig vermehr- und
‚inhaltlich‘ erweiterbare Repräsentationen:
Bis in Anfänge der Genesis /
berecschits hinein betreffen ‚Ernährungsfragen‘
auch, und nicht ausschließlich, in physiologischen Stoffwechsel-Hinsichten. –
[Vom Staatsbankett – nicht nur des venezianischen Dogen,
immerhin eine seiner wichtigsten zeremonialen
Aufgaben – bis gleich gar als (jedenfalls bisher) ‚letztes‘ bekannt geworden
‚Abendmahl Jeschuas auf Erden‘ (mit so
mancherlei Bezügen auf/wider – namentlich vorherige und seitherige –jüdische
zumal Pesach-/Sederfeiern) reichen vergleichsweise beliebig vermehr- und
‚inhaltlich‘ erweiterbare Repräsentationen:
Bis in Anfänge der Genesis /
berecschits hinein betreffen ‚Ernährungsfragen‘
auch, und nicht ausschließlich, in physiologischen Stoffwechsel-Hinsichten. –  Zumindest
ein Schelm, wer etwas … dabei … Sie, Euer Gnaden wissen
schon: ‚Essen‘ erweist sich
als am variabelsten verfügbare ‚Ersatzhandlung‘ für alles (und nahezu, bis daran-denkerisch
ohnehin, bei allem – sonst) überhaupt.
Zumindest
ein Schelm, wer etwas … dabei … Sie, Euer Gnaden wissen
schon: ‚Essen‘ erweist sich
als am variabelsten verfügbare ‚Ersatzhandlung‘ für alles (und nahezu, bis daran-denkerisch
ohnehin, bei allem – sonst) überhaupt.
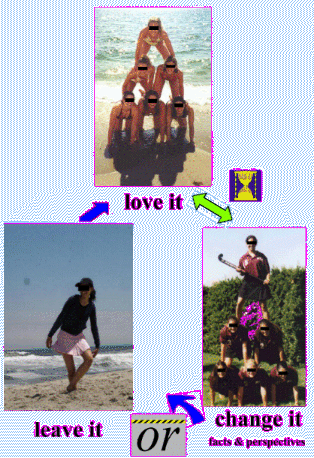 Spätestens
zu essen, was Gott / Natur allen, respektive mir/uns, verboten habet – müsse ja
gesundheitsschändlich sein/werden!
Spätestens
zu essen, was Gott / Natur allen, respektive mir/uns, verboten habet – müsse ja
gesundheitsschändlich sein/werden!
O.G.J.: Für/wider so manche Leute dennoch, sogar erstaunlich unabhängig davon warum sich jemand auf eine (zumal spezifische) Art und Weise (und also nicht jederzeit beliebig wechselnd – oder z.B. chemisch beschreibbare und sonstige [allenfalls unter diesem Namen / in dieser Sprachregelungsform ernsthaft bestrittene] Nährstoffe kaum vollständig substituierend) ‚ernähren‘ sind/erweisen sich Ernährungsfragen – gleich gar als solche möglicher Mahls- bzw. Tischgemeinschaft/en, was also deren Aspekte als soziokulturelle, bis [mehr oder minder hoch]zeremonielle, Ereignisse (nicht nur an diesem/jenem besonderen Ort des Hochschlosses, zumal dafür – mit, bis gar teils weitgehend ohne, den Zweck der Nahrungsaufnahme) – als komplex und – zwar nicht notwendigerweise, doch häufig – als besonders virulent / heftig / aktivierbar; zumal unter den Verdikten von/wider Ungleichheiten, Alternativangeboten bis Vermischungsmöglichkeiten, etc. pp.]
[Zumindest komplementär damit sind/werden auch die Bekömmlichkeitenfragen berührt, und deutlich wie hochspannend
aufgeladen jene (gar zudem
jüdisch[ formuliert]e) Einsicht wird: ‚Dass gar nicht alles gegessen
werden muss, was vielleicht (und
zumal intersubjektiv konsensfähig übereinstimmend
allen Lebewesen – da/wenn ungefähr ‚halbe-halbe‘ [genauer
über fünf bis ca. 90%ige Gewichtsanteile]  aus Zuckern und Fetten zusammen gemischt so;
vgl. auch Olaf Adam) ‚gut‘ / verlockend schmeckt (dass es pausenlos … Sie, Euer Gnaden, bis manche
Industrien, wissen wohl schon).‘
Weswegen allerdings schon so manche Menschen hingerichtet worden sind. – Erst recht falls/wo/da (ja/doch) Gott höchst selbst
einem die Nahrung(smittel zu)bereitet
(hat – nicht allein/nur dem
träumenden/visionären jüdischen Apostel) ist/wird des
Themas Omnipräsenz/Wichtigkeit
deutlich; es bedarf also mindestens ebenso göttlicher Weisung/en zur, gar
vernünftigen, Handhabung seiner Komplexitäten:
aus Zuckern und Fetten zusammen gemischt so;
vgl. auch Olaf Adam) ‚gut‘ / verlockend schmeckt (dass es pausenlos … Sie, Euer Gnaden, bis manche
Industrien, wissen wohl schon).‘
Weswegen allerdings schon so manche Menschen hingerichtet worden sind. – Erst recht falls/wo/da (ja/doch) Gott höchst selbst
einem die Nahrung(smittel zu)bereitet
(hat – nicht allein/nur dem
träumenden/visionären jüdischen Apostel) ist/wird des
Themas Omnipräsenz/Wichtigkeit
deutlich; es bedarf also mindestens ebenso göttlicher Weisung/en zur, gar
vernünftigen, Handhabung seiner Komplexitäten:
[Aus jemandes ja bereits dadurch nur Teilmenge der (unüberschaubaren Vielfalten Vielzahlen an) Meinungen, dass diese so transparent wie möglich erklärend offengelegt und ernsthaft vertreten / behauptet werden, dass angeeignete / gewollte zutreffend verstanden werden / wurden – können ja nur jene für / als Wissen in Frage kommen, die sich (zumal gegenüber Gegenargumenten) überhaupt (also nicht nur zirkelschlüssig in/durch/für sich selbst geltend axiomatisch gesetzt, oder noch so ‚gewissheitlich‘ empfunden) nachvollziehbar begründen, und ups nebenan damit auch bezweifeln, lassen.
Doch bereits/immerhin ![]() Plato (in der Antike) genügen, gar
in diesen Sinnen ‚wahre, begründete Meinung/en‘ nicht, um als qualifiziertes Wissen gelten zu dürfen & können; mit/seit
Plato (in der Antike) genügen, gar
in diesen Sinnen ‚wahre, begründete Meinung/en‘ nicht, um als qualifiziertes Wissen gelten zu dürfen & können; mit/seit ![]() Gadamer
(erst im 20. Jahrhundert
formuliert) kommt nämlich auch noch die dritte einschränkende Bedingung
hinzu: Derart reduziert und intersubjektiv genau verstanden (anstatt etwa deckungsgleich übereinstimmend akzeptiert / geteilt) Gemeintes, äh Wissen
in diesem engeren Sinne, müsste sich
nämlich zudem / überhaupt auf mindestens eine geeignet empirische Art und Weise in/an
Wirklichkeit/en überprüfen lassen.]
Gadamer
(erst im 20. Jahrhundert
formuliert) kommt nämlich auch noch die dritte einschränkende Bedingung
hinzu: Derart reduziert und intersubjektiv genau verstanden (anstatt etwa deckungsgleich übereinstimmend akzeptiert / geteilt) Gemeintes, äh Wissen
in diesem engeren Sinne, müsste sich
nämlich zudem / überhaupt auf mindestens eine geeignet empirische Art und Weise in/an
Wirklichkeit/en überprüfen lassen.]
 (Aber) Wer Morbus Artr… bis Z… hat – braucht (auf)
Ernährungsüberzeugtheiten (nicht zu
verzichten)!
(Aber) Wer Morbus Artr… bis Z… hat – braucht (auf)
Ernährungsüberzeugtheiten (nicht zu
verzichten)!
So benötigen beispielsweise
Kleinkinder (Mutter)Milch, während viele Erwachsene (zumal Kuh-)Milch (entgegen
so mancher Überzeugung) nicht gut vertragen (zumal weil
ihre Körperzellen, als Angehörige der Blutgruppen A]-Typ] und Null [0-Typ], mit
in tierischen Milchen enthaltenen ![]() Lektinen/Lektinproteinen schlecht, bis nicht, klar kommen; vgl. etwa popularisierend Peter D'Adamos),
und manchen Allergikern nicht einmal Soja(-Milch, bis deren Tofu-Quark) bekommt. Ähnlich
unterschiedlich vielfältige und zahlreiche Korrelationen lassen sich auch
bezüglich Verträglichkeiten, Unverträglichkeiten und ‚Neutralitäten‘ sämtlicher
Mineralstoff-, Kohlenhydrate/Zucker-, Fett/e- und eben
Eiweiße/Proteine-‚Lieferanten‘, äh Früchte, Gemüse, Brotgetreide, gleich
gar Fleischarten, Getränken pp. finden. Der ‚eigentliche‘ (zudem gar monokausalistische
vereinfachte, oder aber zeremoniall-aufwandsmaximale Ritualzelebrationen, äh
Ausgewogenheit[en]kult-)Irrtum besteht nun
eben darin (namentlich Gott /
Über- bis Außerraumzeitliches [Besser- bis] Allwissen würde/solle sagen,
jedenfalls Erfahrung habe mitgeteilt): ‚Etwas,
nämlich genau was, davon ausschließlich, immer (oder jedenfalls ‚diätetisch‘ wann/wie)
überall, für einen – gar nein,
sogar für alle überhaupt – gesundheitsnützlich / gut und was böse / schädlich‘ sei! Der komplementär andere (zumal verhaltensfaktische) Fehler jedoch bleiben
folglich die Annahmen: deshalb existiere überhaupt keine (zugänglichen – nämlich auch keine überindividuell erfahrungshorizontlich begrenzten, erlebniswelt[firmament]lich wandelbaren – relationalen/relativen) ‚Richtigkeiten, ‚Falschheiten und
Unentscheidbarkeiten bezüglich (zumal/zumindest einzelner) Aspekte‘;
Lektinen/Lektinproteinen schlecht, bis nicht, klar kommen; vgl. etwa popularisierend Peter D'Adamos),
und manchen Allergikern nicht einmal Soja(-Milch, bis deren Tofu-Quark) bekommt. Ähnlich
unterschiedlich vielfältige und zahlreiche Korrelationen lassen sich auch
bezüglich Verträglichkeiten, Unverträglichkeiten und ‚Neutralitäten‘ sämtlicher
Mineralstoff-, Kohlenhydrate/Zucker-, Fett/e- und eben
Eiweiße/Proteine-‚Lieferanten‘, äh Früchte, Gemüse, Brotgetreide, gleich
gar Fleischarten, Getränken pp. finden. Der ‚eigentliche‘ (zudem gar monokausalistische
vereinfachte, oder aber zeremoniall-aufwandsmaximale Ritualzelebrationen, äh
Ausgewogenheit[en]kult-)Irrtum besteht nun
eben darin (namentlich Gott /
Über- bis Außerraumzeitliches [Besser- bis] Allwissen würde/solle sagen,
jedenfalls Erfahrung habe mitgeteilt): ‚Etwas,
nämlich genau was, davon ausschließlich, immer (oder jedenfalls ‚diätetisch‘ wann/wie)
überall, für einen – gar nein,
sogar für alle überhaupt – gesundheitsnützlich / gut und was böse / schädlich‘ sei! Der komplementär andere (zumal verhaltensfaktische) Fehler jedoch bleiben
folglich die Annahmen: deshalb existiere überhaupt keine (zugänglichen – nämlich auch keine überindividuell erfahrungshorizontlich begrenzten, erlebniswelt[firmament]lich wandelbaren – relationalen/relativen) ‚Richtigkeiten, ‚Falschheiten und
Unentscheidbarkeiten bezüglich (zumal/zumindest einzelner) Aspekte‘;
 da sich
Studien (und gleich gar
deren überzeugte Anwendungskonsquenzen / gar
korruptionsanfällige, jedenfalls interessengeleitete Deutungen) widersprechen
(so gelten in den USA/Kanada beispielsweise die Kohlenhydrate/Zucker als
das Ernährungsübel, die durch Fette zu ersetzen seinen, undװaber in Europa/Großbritannien
die umgekehrte Doktrin/Bekenntnisse –
da ‚solch[ gemurmelt]e‘ /
wissenschaftliche Forschungsergebnisse widerlegbar:
Zum heftig[ aufschreiend]en Entsetzen dessen was viele Hausmänner/Köchinnen
erlernt, ‚sind sämtliche Salate und Gemüse durchaus/gerade ohne Fette/Öl
verdaulich/gut bekömmlich‘, sowie die gängigen Unterschiede zwischen
Nahrungs- und Arzneimitteln [auch] irreführend. Zum gar noch größeren Entsetzen dessen,
was viele MedizinerInnen gelehrt, äh gelernt,
haben… Ursächlichkeiten
[zumal schuldhaften] aus Befunden abzuleiten: So sind z.B. – zumal
hormonell korrelierte –
‚Fettverteilungsstörungen‘ [mitrochondrial wohl, doch seltene
ATP-Spiegel-Irritationen] weder gleich ‚Fettsucht‘
[Adipositas – ‚männlicher Apfel- versus weiblicher Birnenformen‘], noch kommt
‚beiderlei‘ nur getrennt voneinander vor pp.)
keinerlei Empirie vorhanden/zugänglich; es
mache (ohnehin)
keinen / eben den Unterschied wie (zumal asketisch streng [zumal
verzichtend/einseitig] versus libertinistisch extrem [zumal orgastisch/spontan])
jemand sich verhalte; rituelle/zeremonielle Vorschläge, bis gar Vorschriften, wären überflüssig
oder bedürften/hätten – zumal physiologische/r (eben als deterministisch /
notwendig zwingende) – Berechtigungen;
pp.; O.G.J.]
da sich
Studien (und gleich gar
deren überzeugte Anwendungskonsquenzen / gar
korruptionsanfällige, jedenfalls interessengeleitete Deutungen) widersprechen
(so gelten in den USA/Kanada beispielsweise die Kohlenhydrate/Zucker als
das Ernährungsübel, die durch Fette zu ersetzen seinen, undװaber in Europa/Großbritannien
die umgekehrte Doktrin/Bekenntnisse –
da ‚solch[ gemurmelt]e‘ /
wissenschaftliche Forschungsergebnisse widerlegbar:
Zum heftig[ aufschreiend]en Entsetzen dessen was viele Hausmänner/Köchinnen
erlernt, ‚sind sämtliche Salate und Gemüse durchaus/gerade ohne Fette/Öl
verdaulich/gut bekömmlich‘, sowie die gängigen Unterschiede zwischen
Nahrungs- und Arzneimitteln [auch] irreführend. Zum gar noch größeren Entsetzen dessen,
was viele MedizinerInnen gelehrt, äh gelernt,
haben… Ursächlichkeiten
[zumal schuldhaften] aus Befunden abzuleiten: So sind z.B. – zumal
hormonell korrelierte –
‚Fettverteilungsstörungen‘ [mitrochondrial wohl, doch seltene
ATP-Spiegel-Irritationen] weder gleich ‚Fettsucht‘
[Adipositas – ‚männlicher Apfel- versus weiblicher Birnenformen‘], noch kommt
‚beiderlei‘ nur getrennt voneinander vor pp.)
keinerlei Empirie vorhanden/zugänglich; es
mache (ohnehin)
keinen / eben den Unterschied wie (zumal asketisch streng [zumal
verzichtend/einseitig] versus libertinistisch extrem [zumal orgastisch/spontan])
jemand sich verhalte; rituelle/zeremonielle Vorschläge, bis gar Vorschriften, wären überflüssig
oder bedürften/hätten – zumal physiologische/r (eben als deterministisch /
notwendig zwingende) – Berechtigungen;
pp.; O.G.J.] 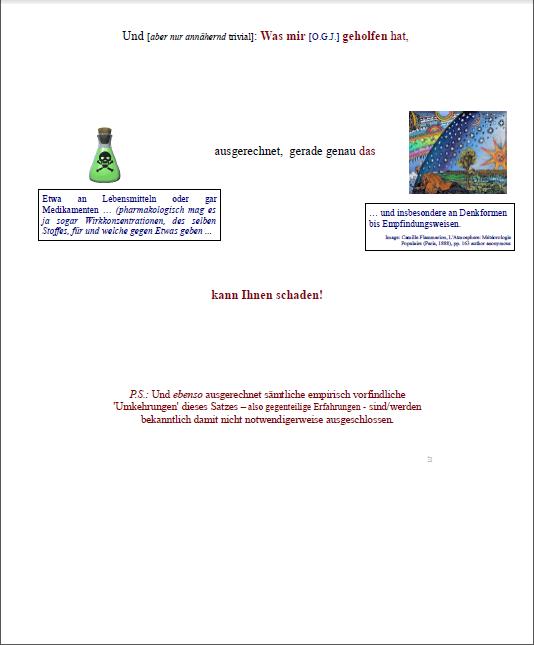 [Sorry, oder
auch nicht: Ausgerechnet
und gerade das, was mir (zumal
Ihres/Eures Erachtens) geholfen – kann Ihnen schaden!] Dass/Ob/Wen(n)
Raeuch(eropfer)en entspannt-!/?/-/. [Dazugelernt/Dazugeübt]
[Sorry, oder
auch nicht: Ausgerechnet
und gerade das, was mir (zumal
Ihres/Eures Erachtens) geholfen – kann Ihnen schaden!] Dass/Ob/Wen(n)
Raeuch(eropfer)en entspannt-!/?/-/. [Dazugelernt/Dazugeübt]  Zumindest einige
Gelehrte
Menschen bemerken / LaMeDs Einsichten
kommen dazu, dass abgeshenen von lebensvon ‚Überleben rettenden‘ chirugischen
Eingriffen und Schocktherapien (während, nach und an denen … Sie wissen schon um/vom
veränderliche/n Sterblichkeitsraten) Leben(szeiten) eher
vertieft/intensiviert und eben mutwillig/unnötig verkützt sein/werden können.
Abb-NCVG-curtsy.ani
Zumindest einige
Gelehrte
Menschen bemerken / LaMeDs Einsichten
kommen dazu, dass abgeshenen von lebensvon ‚Überleben rettenden‘ chirugischen
Eingriffen und Schocktherapien (während, nach und an denen … Sie wissen schon um/vom
veränderliche/n Sterblichkeitsraten) Leben(szeiten) eher
vertieft/intensiviert und eben mutwillig/unnötig verkützt sein/werden können.
Abb-NCVG-curtsy.ani
Biblische Speisegesetze
Abgesehen von den Anordnungen, die mit dem Opferkult und der landwirtschaftliehen Gesetzgebung verbunden waren, haben die biblischen Speisegesetze, wie aus Lev 11 und Dtn 14 ersichtlich ist, folgende Bestandteil: ### a) Unter den Säugetieren sind nur die Wiederkäuer mit gespaltenen Hufen ####m Genuß erlaubt [sic! wobei bereits die insofern zutreffende Begrifflichkeit des ‚Gemießens‘ enthalten darf bis kann, dass Notlagen nicht fanatisiert sein/werden müssten; O.G.J.]. Diese Tiere müssen beide Eigenschaften haben. Hat ein 1ergespaltene Hufe, ist aber kein jWiederkäuer wie z.B. das Sehwein, gilt es als Verbote n, b) Fische müssen Schuppen und Flossen haben, um zum Essen erlaubt zu sein. Andere Seetiere, wie z.B. Hummern und Austern, gelten als verboten.
c) Bei Geflügel werden die verbotenen Arten, größtenteils Raubvögel, aufgezahlt. Erlaubt sind z.B. Hühner, Enten
und Gänse.
d) Streng verboten ist jeglicher Blutgenuß ( Lev 3, 17; 17, l0ff; Dtn 12, 16).
e) Der Genuß von Aas (d.h. Tiere, die tot aufgefunden werden) und „Zerrissenem“ (d.h. von anderen Tieren gelotete #### Tieren) ist untersagt (Ex 22, 30; Lev 17, 15; 22, 8).
f ) Die imal#### (Ex 23, 19; 34, 26; Dtn #####f l4, 21) wird in der Bibel das Kochen eimes Böckleins in der Milch seiner Mutter verboten.
g) Am alljährlichen Pesachfest darf nur ungesäuertes Brot gegessen werden. Auch heißt es, daß bei den Israelitten nichts Gesäuertes und kein Sauerteig während der sieben Tage des Festes gesehen werden darf (Ex 13, 7),
h) Der in Gen 32, 33 erwähnte altisraelitische Brauch, den Muskelstrang über (dem Hüftgelenk eines Tieres nicht zu ####Messen, wird im traditionellen Judentum als biblisches Verbot verstanden.
Rabbinische
Speisegesetze
Die Rabbinen im klassische n Zeitalter des Rabbinismus hätten gewiß verneint, daß sie die biblischen Speisegesetze durch zusätzliche Erschwerungen erweitert haben. Sie hielten sich für bloße Ausleger und Interpreten der biblischen Speisegesetze. Immerhin kann der unbefangene Leser in der rabbinischen Literatur Bestandteil der Speisegesetze finden, die in den biblischen Schriften nicht ausdrücklich erwähnt sind. Es handelt sich um:
a) die Forderung, daß das erlaubte Tier auf besondere Art #### (schechitah genannt) geschlachtet wird, so daß das Tier so schnell und schmerzlos wie möglich stirbt und auch eine große Ausblutung gleich bei der Tötung erfolgt. Diese Methode soll nach rabbinischer Auffassung (bHu l28a) bereitsinden biblischen Worten „wie ich dir befohlen Habe“ (Dtn 12, 21) angedeutet sein.
Wird
ein Tier auf andere Art getötet, dann gilt es als ein „Zerrissenes“ (###Hebr : terephah) und darf von Juden nicht gegessen
werden. (Zum Essen geeignetes Fleisch heißt kascher oder im Volksmund : koscher) ###
b) Nach dem Schlachten muß das Tier besonders die Lungen, untersucht werden, um festzustellen, ob es ein gesundes oder ein krankes Tier war das auch ohne die schechitah #### bald gestorben wäre. Im letzteren Fall würde es terephah sein.
c) Bevor das Fleisch gekocht oder gebraten werden kann, muß eie weitere Entfernung des Blutes stattfinden, die durch Salzen und wiederholtes Waschen mit Wasser erreicht wird.
d) Weit reichend ist die rabbinische Auslegung des Verbots, ein Böcklein in der Milch seiner Mutter zu kochen.
Da das Verbot dreimal gesehrieben steht, lehrten die Rabbinen, daß es sich hier nicht nur um ein in der Milch seiner Mutter gekochtes Böcklein handelt, sondern um jede Mischung von
irgendwelchem Fleisch mit Milch.
Eine solche Mischung darf weder hergestellt noch gegessen werden. Ist sie unbeabsichtigt entstanden, darf man keinen Nutzen von ihr haben. Auch dürfen Fleisch- und Milchspeisen nicht
bei der selben Mahlzeit servier t werden.
In einem rituell geführten jüdischen Haushalt gibt es verschiedene Töpfe, Geschirr und Bestecke für Fleisch- und Milchspeisen, wie auch eine Wartezeit zwischen dem Essen einer Fleischspeise und dem Essen einer Milchspeise (aber nicht umgekehrt) verlangt
wird,
e) Die Vorsicht, am Pesachfest nichts Gesäuertem ausgesetzt zu sein, führt zu der Forderung, daß man für das Pesachfest besonderes Gesehirr, Töpfe und Bestecke (für je „fleischig“ und „milchig“) hat, wie auch, daß die am Pesachfest zu genießenden Eßwaren unter besonderer rabbinischer Aufsicht hergestellt werden, damit nichts „Gesäuertes“ versehentlich beigemischt wird.
Motive
und Entwiclilung
Die verschiedensten Theorien über die ntstehung der Speisegesetze sind im Umlauf - von der Annahme hygienischer Gründe (es soll doch im Nahen Osten so heiß sein; vom Schweinefleischessen ### bekommt man Trichinosis usw.) bis zur psyehoanalytisehen Vermutung, daß es sich beiden verbotenen Tieren um die ehemaligen Totemtiere der primitiven israelitischen Stämme handelt. Diese Theorien, mögen einige von ihnen auch das Richtige treffen, übersehen den Stellenwert der Speisegesetze in der jüdischen Religion. Was immer auch der Ursprung- oder besser: die Ursprünge - der Speisegesetze sein mag, der einzige Grund, den die Bibel selbst für diese Gesetze angibt, ist die Forderung, daß die Israeliten „heilig“ sein sollen, wobei „heilig“ gleichbedeutend mit „abgesondert“ und z.T. auch mit „asketisch“ [sjc! Wenn auch dies eher in antitotalitärer Totalität; O.G.J. mit E.A.S., bis antignostisch] ist. Die Israeliten sollen sich vom Heidentum „absondern“ und sich auch in der Selbstdisziplin üben. Speisegesetze gab es übrigens auch beiden Priestern verschiedener anderer Völker in der Antike [sjc! Soweit nicht auch/schon des Altertums; O.G.J.]. Was die jüdischen Speisegesetze einzigartig macht, ist die Tatsache, daß sie dem ganze n Volk auferlegt wurden, das ja „ein Reich [sjc!] von Priestern und ein heiliges Volk“ (Ex 19, 6) sein soll. Vielleicht gab es sogar auch in Israel Speisegesetze, auf die zunächst nur die Priesterschaft verpflichtet war die dann aber als Verpflichtung für das ganze Volk verstanden wurden (vgl. Ez 44, . 31 ### mit Lev 17, 15).
Die Tendenz, priesterliche Weihe für das ganze Volk zu beanspruchen, ist besonders im rabbinischen Zeitalter bemerkbar indem vielleicht auch die Angst vor Mischehe und Polytheismus die gesellschaftliche Abgrenzung von dieser Umwelt als Notwendigkeit erscheinen ließ. Das mag zu einigen Erschwerungen der biblischen Speisegesetze geführt haben. Immerhin waren sich die Rabbinen des Heiligungszwecks der Speisegesetze bewußt, so wenn z.B. der babylonische Rabh ###(3. Jh. n. Chr.) lehrte: „Die Gebote wurden nur deshalb gegeben, um die Menschen zu läutern. Denn warum sollte sich Gott darum kümmern, wie man ein Tier schlachtet? [sjc! Vgl. allerdings bereits noachidischen Bundeschluss; O.G.J.] ,.. Dusiehst #### also, daß diese Gebote nur den Zweck haben, die Menschen zu läutern“ (BerR 44, 1, hrsg. von Theodor-Albeck, S. 424f).
Bedeutung
für heutige Juden
Im orthodoxen Judentum gelten sowohl die biblischen wie auch die rabbinischen Speisegesetze als von Gott geoffenbart und daher als ausnahmslos verbindlich. Im Prinzip gelten sie auch im konservativen Judentum Amerikanischer Prägung, obwohl sich das konservative Rabbinat bemüht hat, in gewissen Einzelheiten einige Erleichterungen zu schaffen. Das radikale Reformjudentum hat bereits im 19. Jahrhundert die Verbindlichkeit der Speisegesetze abgelehnt, da es sich bei ihnen - nach der reformierten Aufsassung - um einen Begriff der priesterlichen
Heiligung handelt, der dem modernen religiösen Bewußtsein nicht mehr entspricht undes bei dem sog. „Zercmonialgesetz“ ohnehin um menschliche, nicht von Gott selbst geoffenbarte Institutionen geht. In weniger radikalen Richtungen innerhalb des reformierten
Judentums wird es dem einzelnen überlassen, ob und wieweit er die Speisegesetze beobachtet, weil, selbst vom modernen Standpunkt aus gesehen, sich doch manches zur Befürwortung der Speisegesetze sagen läßt – wie z.B. das Positive der Selbstdisziplin, das Bewußtsein der geschichtlichen Tradition, die alle Juden verbindet, die Verklärung einer tierischen Funktion zu einem religiösen Akt, die Bereitschaft, einen Haushalt zu führen, in dem Juden alle r religiösen Richtung zu Gast kommen können usw. Doch wird es dem einzelnen nicht vorgeschrieben, wie er die Speisegesetze zu beobachten hat, und er kann seine eigene Auswahl treffen. Es gibt liberale Juden, die alle traditionellen Speisegesetze auf sich nehmen sowohl im eigenen Haus wie auch auswärts. Andere beschränken sich auf die biblischen Speisegesetze.
Wieder andere halten die biblischen
und rabbinischen Speisegesetze nur im
eigenen Haus, beschränken sich aber
auswärts auf die biblischen Gesetze.
Diese Auswahl wird heutz utage nicht
nur von bewußt liberalen Juden getroffen, sondern auch von vielen Juden, die
sich offiziell „orthodox“ oder „konservativ“ nennen mögen. Jedoch ist anzunehmen, daß sich die Mehrheit der
nicht-orthodoxe n Juden an gar keine
Speisegesetze hält - obwohl hier und
da eine gewisse Scheu vor Schweinefleisch
weiterbestehen mag. Zwar ist
das Schwein nur eins der vielen von
der Bibel verbotenen Tiere, aber in der
langen jüdischen Geschichte - auch
schon zur Makkabäerzeit (vgl. 2 Makk
6, 18-31) - ist die Abstinenz vom
Schweinefleisch oftmals zum Kriterium der Treue zum monotheistischen
Glauben geworden #jo#jojo#jo# und hat auch wiederholt zum Martyrium geführt.
Christlich-jüdisches
Gespräch
In der frühchristlichen Polemik gegen
das pharisäisch-rabbinische Judentum
scheinen die Speisegesetze eine große
Rolle gespielt zu haben, weil das Beharren auf den Speisegesetzen für die
Juden-Christen und die Dispensierung
der Heiden-Christen von diesen Gesetzen eine Tischgemeinschaft der beiden
Arten von Christen unmöglich gemacht hätte. S o wurden schließlich die
Speisegesetze aufgehoben (vgl. Mt
15, 1-20; Apg 10, 9-15), was ja auch
ohnehin mit der allgemeinen christlichen „Befreiung vom Gesetz“ geschehen wäre. Jedoch sollten Perikopen wie Mt 15, 1-20, in denen die Pharisäer
angegriffen werden, weil sie die
Speisegesetze höher als die moralischen Gesetz e einschätzen, von heutigen Christen als geschichtlich bedingte
Polemik der damaligen Zeit verstanden
werden, in der Christen und Pharisäer
einen Konkurrenzkampf führten, und
- 192 - - 1 9 3 -
S P F
I S E GESETZ E - STAAT ISRAEL
nicht als objektive Beschreibung d er
pharisäischen Religion.
Vom jüdischen Standpuntk aus gesehen, begeht der heutige Christ (und der
damalige Heiden-Christ!) keine Sünde [sjc! Verfehlung; O.G.J.],
wenn er Schweinefleisch und andere
verbotene Speisen ißt, weil ja der rituelle Teil der sinaitischen Offenbarung
gar nicht für die nichtjüdische Welt [sjc!] bestimmt war. Wird aber unter christlicher Ägide, etwa bei Gelegenheit
eine s christlich-jüdischen Gesprächs,
eine gemeinsame Mahlzeit von Juden
und Christen veranstaltet, empfiehlt es
sich für die christlichen Gastgeber den
Anweisungen des Paulus in Röm
14, 1. 3-23#### zu folgen und den jüdischen
Gästen am besten eine vegetarische
oder eine Fischmahlzeit zu bereiten.»
![]() (Jakob J. Petuchowski mit Cl.Th. im
Begegnungslexikon, S. 190-193, entsprechend Sp.- der Ausgabe 1989)
(Jakob J. Petuchowski mit Cl.Th. im
Begegnungslexikon, S. 190-193, entsprechend Sp.- der Ausgabe 1989)
Jedwede Überlegung
/ Reflektion, ‚soll, respektive (wieviel)
darf, ups ich (anstatt akker anderen) das (wann davon) essen?‘, hat –
neben immerhin rituell ‚verzögernd( zwar scheinend)en‘ (zumal nicht pausenlos – Kohlenhydrate/Zucker eher vier Stunden von
Fetten getrennt, anstatt halbe-halbe gemischt), gar konzentrativen bis
kontemplativen – durchaus (motivational,
bis physioogisch) einflussreiche Konsequenzen, doch längst nicht nur in
eine, und auch nicht immer in die selbe, (verhaltensfaktische) Richtung; O.G.J.  [Im einst
dogalen ‚Saal der Zeit/en‘ zu Venedig erinnert (manchmal / immerhin) eine weite(re) Repräsentation, des
alten, basal(st)en
mindestens Themas – (allerlei)
Mahlzeit]
[Im einst
dogalen ‚Saal der Zeit/en‘ zu Venedig erinnert (manchmal / immerhin) eine weite(re) Repräsentation, des
alten, basal(st)en
mindestens Themas – (allerlei)
Mahlzeit]
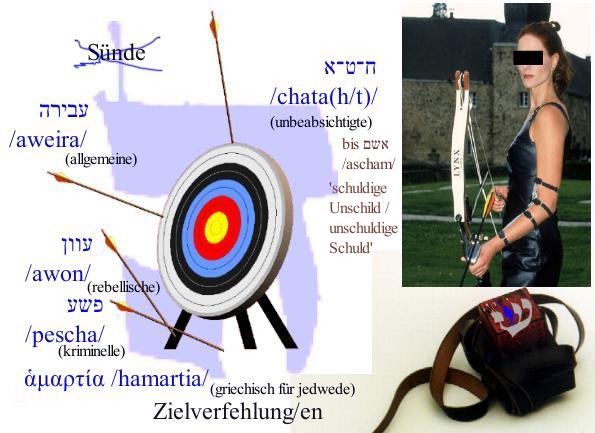 [Oh ja, das ‚Sünde‘-Begriffsfeld mag durchaus
besser (zumal aus
Bibelübersetzungen) gestrichen werden. Ups, nein – zu früg
gefreut / zu heftig empört, es bleibt durch jene der ‚Zielverfehlung/en‘ zu
ersetzen; die von/in der hebräischen Tora vierfach unterschieden, doch von in
der griechischen Übersetzung (Septuaginta
LXX) wie den apostolischen Schriften gleich genannt
werden. – Allerdings mag / muss sich der Bergpredigt / Feldrede ‚Seeligpreisung
der Einfalt / Einfachheit‘ – vgl. hebräisch gedacht (gar wortwörtlich,
oberflächlich, ausdrücklich)‚/pschat/ פשט bis/mit /pscha‘/ פשע – nicht militant itellektuellen(- oder wär’s juden)feindlich
verstehen / verwenden lassen.]
[Oh ja, das ‚Sünde‘-Begriffsfeld mag durchaus
besser (zumal aus
Bibelübersetzungen) gestrichen werden. Ups, nein – zu früg
gefreut / zu heftig empört, es bleibt durch jene der ‚Zielverfehlung/en‘ zu
ersetzen; die von/in der hebräischen Tora vierfach unterschieden, doch von in
der griechischen Übersetzung (Septuaginta
LXX) wie den apostolischen Schriften gleich genannt
werden. – Allerdings mag / muss sich der Bergpredigt / Feldrede ‚Seeligpreisung
der Einfalt / Einfachheit‘ – vgl. hebräisch gedacht (gar wortwörtlich,
oberflächlich, ausdrücklich)‚/pschat/ פשט bis/mit /pscha‘/ פשע – nicht militant itellektuellen(- oder wär’s juden)feindlich
verstehen / verwenden lassen.]
[Abb. Zahal Soldatinnen/Soldaten etwa sabres oder Parade] Die ‚Kriegsgesetze‘ der auch handgeschreiben überlieferten tora bedürfen besonders der Erwähnlung, da (jedenfalls außerhalb Jisraels) unbekannt ist (oder bleibt), dass – zumindest jüdische Gemeinwesen – den anderen (gleich gar vor ihnen anwesenden) zunächst, bis vorher, exakt spezifizierten Freiden anzubiten haben, und erst bei/nach Ablehnung (gleich riegesgar von Verhandlungen darüber) das Mittel des (gar Angriffs-)Krieges einsetzen dürfen. Doch nicht einmal da des ‚totalen‘, sondern sogar die einzelnen Soldaten – so namentlich bis heute, wenigstens jene der ZaHaL – gesetzlich verpflichtet sind (imd sogar werden) Menschenrechtsverletzungen zu verweigert / unterlassen. Gleichwohl und also ein gängiger Anlass / Aufhänger für propagandistische Aktionen, und manchmal sogar ethische Pflichtenkollisionen. [Abb. US-Navy Juisrenrem JAG im Namen der Ehre]
Kaum weniger heftig / gründlich verborgen bleiben / werden zumeist
auch verhaltensfaktisch Anwendungsaspekte semitischer ‚Strafgesetze‘ überhaupt. Das besonders
berüchtigte – in der Regel
irreführend zitierte / verwendete – angebliche Racheprinzip ‚Gleiches
mit Gleichem / Wie Du mir so ich Dir‘ im Sinne von ‚Zahn um Zahn‘ – ‚Auge um
Auge‘, bis eben ‚Leben um Leben‘ vergelten zu müssen (oder wenigstens ‚zu dürfen‘), wir ja
allenfalls vom propagandistisch-populären Einsatz der islamischer
Wegverwendungen / Schariavarianten (zumal/spätestens qua ![]() Figh)
übertroffen / überboten: Bei denen / Wider die sich beispielsweise zeigt, dass
sogar / gerade dem ‚archaischen‘ Rechtsverständnis genüge getan werden kann,
indem einem zumal toten Tier, anstelle eines wegen Diebstahls verurteilten
Menschen, eine Pfote abgetrennt wird. Während die Tora zwar durchaus
Körperstrafen, bis hin zu grausamer Todesstrafe, kennt, aber nicht einmal dazu
Verstümmelungsexzesse duldete, sondern eher den üblichen Sitten und Bräuchen der Ethnien
/ Kulturen, den Totalitarismen (vgl. Ernst A. Simon),
zumindest zivilisatorisch
begrenzend und regelnd (vgl.
etwa ‚wenn iIhr schon, bis überhaupt, Opfer bringen wollt – dann allenfalls …‘,
bis dass den/dem Menschen die Rache entzogen wird indem G’tt sie für/bei sich
monopolisiert), widerspricht. Während um
(und zwar ‚jeweils‘, anstatt
überraumzeitlich unveränderbar identisch konstant) ‚den Weg der verhaltensfaktisch gegangen werden soll‘ hebräisch
הלכה halacha (vgl.
später auch arabisch شريعة
Figh)
übertroffen / überboten: Bei denen / Wider die sich beispielsweise zeigt, dass
sogar / gerade dem ‚archaischen‘ Rechtsverständnis genüge getan werden kann,
indem einem zumal toten Tier, anstelle eines wegen Diebstahls verurteilten
Menschen, eine Pfote abgetrennt wird. Während die Tora zwar durchaus
Körperstrafen, bis hin zu grausamer Todesstrafe, kennt, aber nicht einmal dazu
Verstümmelungsexzesse duldete, sondern eher den üblichen Sitten und Bräuchen der Ethnien
/ Kulturen, den Totalitarismen (vgl. Ernst A. Simon),
zumindest zivilisatorisch
begrenzend und regelnd (vgl.
etwa ‚wenn iIhr schon, bis überhaupt, Opfer bringen wollt – dann allenfalls …‘,
bis dass den/dem Menschen die Rache entzogen wird indem G’tt sie für/bei sich
monopolisiert), widerspricht. Während um
(und zwar ‚jeweils‘, anstatt
überraumzeitlich unveränderbar identisch konstant) ‚den Weg der verhaltensfaktisch gegangen werden soll‘ hebräisch
הלכה halacha (vgl.
später auch arabisch شريعة ![]() scharia bis Kirchenrecht) zu gestalten / wählen / bestimmen, bereits die Sanhedrine jüdischer
Rechtsgelehrter (zumal basierend
auf ihrer umfassend archivierend, auch die bereits ‚ursprünglich‘
unvermeidlichen ‚mündlichen‘ Anwendungen göttlicher ‚Weisung und\aber Sache‘
berücksichtigenden, ‚Schriftgelehrtheit‘) die Anzahl der ‚todeswürdigen
Verbrechen‘ – gar (allerlei)
ups, auch entgegen dem oberflächlich auszugsweise lesenden /
buchstäblich-titierenden Wortlaut der Tamch / Bibel (mittels herade dieser
Primärquelle Deutungsunausweichlichkeit/en) – weiter reduzierten, und
Exekutionen ausgesetzt bzw. (bis
auf den
scharia bis Kirchenrecht) zu gestalten / wählen / bestimmen, bereits die Sanhedrine jüdischer
Rechtsgelehrter (zumal basierend
auf ihrer umfassend archivierend, auch die bereits ‚ursprünglich‘
unvermeidlichen ‚mündlichen‘ Anwendungen göttlicher ‚Weisung und\aber Sache‘
berücksichtigenden, ‚Schriftgelehrtheit‘) die Anzahl der ‚todeswürdigen
Verbrechen‘ – gar (allerlei)
ups, auch entgegen dem oberflächlich auszugsweise lesenden /
buchstäblich-titierenden Wortlaut der Tamch / Bibel (mittels herade dieser
Primärquelle Deutungsunausweichlichkeit/en) – weiter reduzierten, und
Exekutionen ausgesetzt bzw. (bis
auf den ![]() Eichmannprozess 1961) umgewandelt werden.
Eichmannprozess 1961) umgewandelt werden.
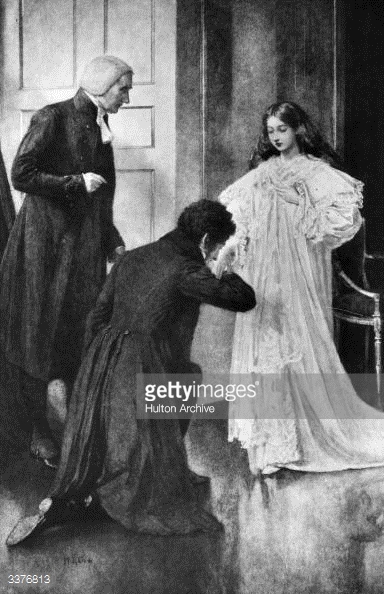
[Gleich gar gegen (zumindest eigenes) Widerstreben, gesellschaftliche. jedenfalls bezugsgruppenspezifische, Rollenerwartungen zu erfüllen – ist/wird bekanntlich nicht allein bei/unter/von Frauen regelnd erzwungen: Was / Welche davon auch interkulturell globalisiert (bis an/aus überraumzeitlich aktivierbaren Konfliktfeldern) , konsensfähig verfügbar anzutreffen, beeindruckt eher fundamentalistisch]
Wohl am problematischten ungezügelt, beliebig verfügbar,
erweist ‚sich‘ (erweisen
Menschen einander/sich)
allerdings und\aber nämlich  [Wem eine solche Winkgeste nur / hier ‚eigentlich‘ ein
Herbei-Kommen-sollen signalisiert, oder ob damit Wegbleiben bis –gehen des/der
Anderen erreicht werden soll?]
[Wem eine solche Winkgeste nur / hier ‚eigentlich‘ ein
Herbei-Kommen-sollen signalisiert, oder ob damit Wegbleiben bis –gehen des/der
Anderen erreicht werden soll?]
‚das (überlieferte) Brauchtum‘,
namentlich die einem zwar häufig selbstverständlich
vertraut (bis völlig eindeutig)
vorkommenden, doch von ‚Kulturraum‘ zu (bib)verbalem Sprachraum oder
Sozialgruppierungsgebiet, sehr unterschiedlich – nicht selten auch gerade gegenläufig – gestalteten / verstandenen‚
Umgangsformen‘ / Höflichkeitserwartungen,
bos etwa Opferleistungskonzepten.respektive ‚Sittengesetz‘, zumal soweit
es nicht, oder gar wo es ausschließlich, deckungsgleich mit häufig ‚Moral(gesetz)‘-Genanntem zusammengebracht wird.  [ … wo / ob diese Zeichen beispielsweise nördlich oder
südlich der Alpen sozialisieret / akulturiert korrekt gedeutet werden
[ … wo / ob diese Zeichen beispielsweise nördlich oder
südlich der Alpen sozialisieret / akulturiert korrekt gedeutet werden 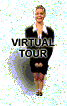 ]
]
‚Hypo nomon‘
lautet ja schon die geradezu fachbegriffliche, griechische Wortschöpfung
ausgerechnet, gerade des Apostels Pauls (dessen Arbeiten prompt
genau wi[e]derum eben dazu … ![]() Sie
wissen schon) für / gegen »in Unterwerfung unter das System, das aus der Entstellung
[überbietenden Stützung / Vergottung; O.G.J. mit Da.KM.] der Torah תורה
zur Gesetzlichkeit [zum Prinzip der/als תורת torat; O.G.J. ] entsteht« (David H. Stern übersetzt so präzise-ausführlich).
Sie
wissen schon) für / gegen »in Unterwerfung unter das System, das aus der Entstellung
[überbietenden Stützung / Vergottung; O.G.J. mit Da.KM.] der Torah תורה
zur Gesetzlichkeit [zum Prinzip der/als תורת torat; O.G.J. ] entsteht« (David H. Stern übersetzt so präzise-ausführlich). ![]() ‚beginnend‘ mit / basal den sieben (‚un- bis inwendig geschriebenen‘)
noachidischen
Pflichten (Kapitalverbrechen,
Raub/Diebstahl, Betrug, Unzucht, Götzendienst/Blasphemie und Grausamkeiten, jedenfalls
gegen Tiere [insbesondere zu deren Tötung/Verzehr], zu unterlassen, sowie ein
geordnet-durchschaubares Rechtswesen einzuführen) – den zusätzlich
unterscheidenden, beschneidenden und vertrauenden Spezifikationen Abrahams – den eben weitaus
mehr (inzwischen traditionell in 613
gefassten) des Mose,
auf und aus der heure noch auch
handschriftlichen Mitte (Levitikus
/ wajikra ויקרא
/ 3. Mos. 19:18) / dem jüdischen Zaun um das größte (gar/ups Doppel-)Prinzip der Tora:
‚G’tt ganz mit Allem (Deuteronomium
/ ele hadwarim אלה הדברים / 5.
Mos. 6:5) und\aber die Nächsten (zumal/immerhin ‚als sich selbst‘)
lieben/d‘ (gar nicht ausschließlich ‚den/die
‚lokal Nächste/n‘, bereits /reach/ רעך geheißen‚ also auch ‚für böse רע haltbar‘, sondern
alle Menschenheit betreffend; Genesis / bereschit בראשית
/ 1. Mos. 5:1), um
‚beginnend‘ mit / basal den sieben (‚un- bis inwendig geschriebenen‘)
noachidischen
Pflichten (Kapitalverbrechen,
Raub/Diebstahl, Betrug, Unzucht, Götzendienst/Blasphemie und Grausamkeiten, jedenfalls
gegen Tiere [insbesondere zu deren Tötung/Verzehr], zu unterlassen, sowie ein
geordnet-durchschaubares Rechtswesen einzuführen) – den zusätzlich
unterscheidenden, beschneidenden und vertrauenden Spezifikationen Abrahams – den eben weitaus
mehr (inzwischen traditionell in 613
gefassten) des Mose,
auf und aus der heure noch auch
handschriftlichen Mitte (Levitikus
/ wajikra ויקרא
/ 3. Mos. 19:18) / dem jüdischen Zaun um das größte (gar/ups Doppel-)Prinzip der Tora:
‚G’tt ganz mit Allem (Deuteronomium
/ ele hadwarim אלה הדברים / 5.
Mos. 6:5) und\aber die Nächsten (zumal/immerhin ‚als sich selbst‘)
lieben/d‘ (gar nicht ausschließlich ‚den/die
‚lokal Nächste/n‘, bereits /reach/ רעך geheißen‚ also auch ‚für böse רע haltbar‘, sondern
alle Menschenheit betreffend; Genesis / bereschit בראשית
/ 1. Mos. 5:1), um
die zehn
(vgl. griechisch ‚[he] Dekalog[gos
nomothesia – ‚aus zehn Worten bestehendes Gesetz‘]‘, und zwar zertrümmerter
[Ex. 20], unidentisch
‚kopierter‘ [Ex. 34], wiederholt( dem ersten Wortlaut nahezu gleich)er
[Deuteronomim 5], über zwei mahl sieben ‚Heiligkeitsgestz/e‘ [Leviticus / ויקרא / 3. Mos. 19]
bis zwölffachem ‚Dodekalog/Fluchdekalog‘ [‚dies die Reden‘ / 5. Mos. 27]
– ‚Stich‘-)Worte / ‚Aspekte‘,
doch / eben genauer hebräisch: /asäret ha-dibrót/ אשרת (עֶשֶׂר /‘eser/ ‚weiblich‘ – עַשָׂרָה /‘asara/ ‚männlich‘ –
zwar ausdrücklich ‚zehn‘ repräsentierend, doch gerade diese Normzahl / Zahlnorm
formell nicht felsenfest fixieren s/wollend)
immerhin die grammatikalisch rein ‚weibliche‘ Pluralform הדברות (vgl. tanachisch: Ps. 31:19
/hadowrot/) oder genderneutral /hadwarim/ הדברים gar zunächst von
‚G’ttes Finger/Hand‘ geschrieben (Exodus / schemot
שמות / 2. Mo. 32:6) [אנכי ה׳ /anoci he‘/ Ich (Eurer) Adonai; לא /lo/ nicht gezwungen (sein/werden)
יהיה /jihijä/
Gott (neben)
G’tt (äh
‚seien/haben‘); … תשא /tisa/ Ertragsgewinn (aus/mit G‘ttesnamen); זכור /sachor/ gedenke את /et/ des (Schabat); כבד /kabed/ ehre … (Eltern); לא /lo/ nicht müssen תרצח /tirtzach/ morden; … תנאף /tinaf/ betrügen; .. תגנב
/tignow/ stehlen/rauben; … תענה /ta‘anä/ falsch
bezeugen; … תחמד /tachmod/ begehren. Auch das den Verben
vorangestellte taw ת
adressieret hier durativ genderneutral das menschliche Gegenüber G’ttes (wenn auch eher im Sinne eines
englischen singular ‘you‘ als nur den deutschen ‚Du‘ entsprechend). – „Fünfte These:
Die Dekalog-Revisionen, die meistens als Dekalog-Überbietungen angetreten sind, als
‚höhere Moral‘, sind i.d.R. gescheitert: Die Übermenschen, die Überjuden, die
Überchristen erwiesen sich oft als Unmenschen.“ Daniel Kochmalnik] – von
König David in elf Leitsätze gefasst (Psalm / tehilim תהלים / 15) – durch Jesaja
in sechs (jescha’ajahu 33:15+16) – von Micha in drei (micha 6:8 מיכה)
– wiederum Jesaja in zwei (56:1 ישעיהו) –
durch Amos in einem ‚G’tt suchen‘ formuliert (amos 5:4 עמוס), doch mit / von Habakuk verdeutlichbar:
‚G’tt vertrauend‘ /emunah/ אמונה (cgawakuk 2:4 חבקוק) – durch Jeschua/Jesus
[אנכי ה׳ /anoci he‘/ Ich (Eurer) Adonai; לא /lo/ nicht gezwungen (sein/werden)
יהיה /jihijä/
Gott (neben)
G’tt (äh
‚seien/haben‘); … תשא /tisa/ Ertragsgewinn (aus/mit G‘ttesnamen); זכור /sachor/ gedenke את /et/ des (Schabat); כבד /kabed/ ehre … (Eltern); לא /lo/ nicht müssen תרצח /tirtzach/ morden; … תנאף /tinaf/ betrügen; .. תגנב
/tignow/ stehlen/rauben; … תענה /ta‘anä/ falsch
bezeugen; … תחמד /tachmod/ begehren. Auch das den Verben
vorangestellte taw ת
adressieret hier durativ genderneutral das menschliche Gegenüber G’ttes (wenn auch eher im Sinne eines
englischen singular ‘you‘ als nur den deutschen ‚Du‘ entsprechend). – „Fünfte These:
Die Dekalog-Revisionen, die meistens als Dekalog-Überbietungen angetreten sind, als
‚höhere Moral‘, sind i.d.R. gescheitert: Die Übermenschen, die Überjuden, die
Überchristen erwiesen sich oft als Unmenschen.“ Daniel Kochmalnik] – von
König David in elf Leitsätze gefasst (Psalm / tehilim תהלים / 15) – durch Jesaja
in sechs (jescha’ajahu 33:15+16) – von Micha in drei (micha 6:8 מיכה)
– wiederum Jesaja in zwei (56:1 ישעיהו) –
durch Amos in einem ‚G’tt suchen‘ formuliert (amos 5:4 עמוס), doch mit / von Habakuk verdeutlichbar:
‚G’tt vertrauend‘ /emunah/ אמונה (cgawakuk 2:4 חבקוק) – durch Jeschua/Jesus ![]() im Doppelkern ‚G’tt undװaber Menschen lieben‘ (3. Mo. 19:18) zitiert (alle kanonischen Evangelien)
– vom Jerusalemer Apostelkonzil (ja bereits aus Noachs Bund ברית mit auch Abrahams G’tt יה־ה – gar ‚anstatt‘, doch ‚inhaltlich‘ wie
gerade ebenfalls von, Mose)
übernimmt / komprimiert (vgl.
Apostelgeschichte Kapitel fünfzehn – ob
nun ‚sogar‘, oder ‚nur‘) für Nichtjuden auf folgende vier zu
vermeidende Verunreinigungen (Apg. 15:20) durch Götzen,
Unzucht, Ersticktes und Blut, als rechtschaffen (wohl eher zusätzlich über basal
interkulturell konsensfähige Kriminalitätsverbote hinausgehend, als solche,
oder geregelte obrigkeitliche /
hoheitliche Gerichtshöfe, ablehnen
sollend / müssend, zu verstehen) –
unübersehbar viele geschriebene §§ – so manch gefühlte, bis gelebte, שכינה
im Doppelkern ‚G’tt undװaber Menschen lieben‘ (3. Mo. 19:18) zitiert (alle kanonischen Evangelien)
– vom Jerusalemer Apostelkonzil (ja bereits aus Noachs Bund ברית mit auch Abrahams G’tt יה־ה – gar ‚anstatt‘, doch ‚inhaltlich‘ wie
gerade ebenfalls von, Mose)
übernimmt / komprimiert (vgl.
Apostelgeschichte Kapitel fünfzehn – ob
nun ‚sogar‘, oder ‚nur‘) für Nichtjuden auf folgende vier zu
vermeidende Verunreinigungen (Apg. 15:20) durch Götzen,
Unzucht, Ersticktes und Blut, als rechtschaffen (wohl eher zusätzlich über basal
interkulturell konsensfähige Kriminalitätsverbote hinausgehend, als solche,
oder geregelte obrigkeitliche /
hoheitliche Gerichtshöfe, ablehnen
sollend / müssend, zu verstehen) –
unübersehbar viele geschriebene §§ – so manch gefühlte, bis gelebte, שכינה 
[Der Normierung/en bedarf, bis ה־ל־ך /hallach/ische (Gerichtsurteils-)Entscheidungen über / aus /mitzwot/ מצוות und
Pflichtenerfüllungen zu treffen (immerhin/bereits
auch ohne torat תורת / prinzipielle
Doktrin daraus / dafür / dagegen mach zu müssen, vgl. zumindest apostolische
‚richtet nicht … [wenigstens, dass ihr nicht mit/an eben diesem Mass …]‘-Warnungen) vermag, ‚territorial‘, äh
zumal was ‚die Weisung, bis Sache, G’ttes‘ /tora wedawar adonai/ ![]() תורה ודבר ה׳ angeht, weitaus
weniger, als was / wovon sich Narratives,
zumal ה׀א־ג־ד /h\aggad(isv)h/ erzählen, bis komplementär/konträr meinen, äh
belehren,
ließe – und zwar ohne deswegen ‚rechtsfreie Räume‘ /
davon Vielgötterei befürchten zu müssen. – ‚Gesetzestreue
wäre schon genug – wider den Ethikboom‘ Friedrich W. Graf]
תורה ודבר ה׳ angeht, weitaus
weniger, als was / wovon sich Narratives,
zumal ה׀א־ג־ד /h\aggad(isv)h/ erzählen, bis komplementär/konträr meinen, äh
belehren,
ließe – und zwar ohne deswegen ‚rechtsfreie Räume‘ /
davon Vielgötterei befürchten zu müssen. – ‚Gesetzestreue
wäre schon genug – wider den Ethikboom‘ Friedrich W. Graf]
 Demgegenüber, was ‚im Namen der (öffentlich-äußerlichen
/ gemurmelten) Sicherheit & Ordnung
(ihrer Aufrechterhaltung, äh
dem vorgeblichen Wohlwollen der Gottheit, äh Sündenvermeidung und
Verfehlungsbestrafung, zuliebe)‘ an
Menschenfeindlichkeiten begangen wurde und wird – wozu (wer) was zu (er)tragen / fühlen / sagen, wann
wer wen (nicht) zu ‚heiraten‘ / was zu haben, was wem wozu darzustellen / zu
zeigen, pp. was eben überhaupt wann und wie (bis sonst, und wo, mit/gegen wem)
zu geschehen … – ,
Demgegenüber, was ‚im Namen der (öffentlich-äußerlichen
/ gemurmelten) Sicherheit & Ordnung
(ihrer Aufrechterhaltung, äh
dem vorgeblichen Wohlwollen der Gottheit, äh Sündenvermeidung und
Verfehlungsbestrafung, zuliebe)‘ an
Menschenfeindlichkeiten begangen wurde und wird – wozu (wer) was zu (er)tragen / fühlen / sagen, wann
wer wen (nicht) zu ‚heiraten‘ / was zu haben, was wem wozu darzustellen / zu
zeigen, pp. was eben überhaupt wann und wie (bis sonst, und wo, mit/gegen wem)
zu geschehen … – ,  drohen neben den
erheblichen Nutzen gruppenspezifischer, bis gesellschaftlicher, etwa
sprachlich-kultureller und verhaltenskoordinierender, bis rechtlicher, Regelungen
des Zusammenlabens, auch die Einsichten,
zu verblassen / verstellt zu werden:
drohen neben den
erheblichen Nutzen gruppenspezifischer, bis gesellschaftlicher, etwa
sprachlich-kultureller und verhaltenskoordinierender, bis rechtlicher, Regelungen
des Zusammenlabens, auch die Einsichten,
zu verblassen / verstellt zu werden: 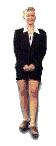
Dass stets auf eine durchaus bestimmbare (zumal kaum je alternativlose, allenfalls habitualisierte / einem verselbstverständlicht so, bis optimal, vorkommende) Art und Weise ‚gehandelt‘ (sich zumindest veralten) werden muss. Was nicht nur als zeremoniell empfunden / gedeutet (bis übertrieben und, gar prominent mit Fredericus Rex von Hohenzollern, wahlweise abgelehnt respektive geändert) werden kann [Abb. Zeichnung ‚Nein – nur keine Zeremonie!‘], sondern durch / von ritualen (nicht einmal allein / erst in außeralltäglichen Sonder- Extrem- und Wendesituationen des Lebens/verlaufs) auch wesentlich erleichtert sein / werden kann & darf.
|
1. Judentum |
|
|
|
|
Zercmonialgesetz ist ein Begriff, der dem traditionellen Judentum an sich fremd ist, obwohl die Unterscheidung zwischen mischpatim (Zivilgesetz) und huqqiin (rituelle Gebote) ### in der rabbinischen Literatur vorkommt (vgl. z.B. Sifra Ahhare Moth 13, 10: 10, hrsg. von Weiß, S, 86a). Beide galten aber im traditionellen Judentum als göttliche Offenbarung und daher als gleichartig verbindlich. |
|
|
|
|
Die prophetische Polemik gegen den Kult wurde so verstanden, daß die Propheten nur dann den Kult verurteilten, wenn sich diejenigen, die an ihm Teilnahmen, nicht gleichzeitig um ihre moralischen [sic! ethischen Mitzwot plus um, anstatt nur ‚zeremoniell. Äußerliche Formenkorreltheit/Buchstabentreue‘; O.G.J.] Pflichten kümmerten. Der ein negatives Werturteil beinhaltende Ausdruck „Zeremonialgesetz“ kam erst in der christlichen Polemik gegen das Judentum auf, wo bei, besonders im 19, Jahrhundert, einige protestantische Schriftsteller es in Verblümter [sic!] Weise nicht weniger auf den Katholizismus abgesehen hatten. Oft wird vom „Zeremonialgesetz“ im Zusammenhang mit der paulinischen Auffassung vom „Gesetz” gesprochen, obwohl es in der neutestamentlichen Wissenschaft noch gar nicht ausgemacht ist, ob ### Paulus' „Kritik des „Gesetzes“ sich nicht ebenso auf die moralische wie auf die zeremonielle Gesetzgebung bezieht und ob Paulus nicht vom jüdischen Konvertiten zum Christentum weiterhin die Beobachtung des Zeremonialgesetzes forderte. |
|
|
|
|
Wahrscheinlich vom Protestantismus beeinflußt, nahm im 19, Jahrhundert das reformierte oder liberale Judentum den Begriff „Zeremonialgesetz“ auf, in dem es den rituellen Gebräuehen des Judentums einen niedrigeren Rang als der Glaubenslehre [sic!] und den moralischen Pflichten zu wies undn ### in dem es sich erlaubte, das Zeremonialgesetz den Anforderungen der Zeit anzupassen - ohne allerdings auf „ansprechende“ und „inhaltsreiche“ Zeremonienjetotal #### zu verzichten. So wurde dann auch häufig in der innerjüdischen Polemik der Begriff „Zeremonialgesetz“ von religiös-liberaler Seite, ganz im „protestantischen“ Sinn, gegen die Orthodoxie ins Feld geführt. |
|
|
|
|
Die Rangordnung, die seiner Zeit dem „Zeremonialgesetz“ im reformierten und liberalen Judentum zugewiesen wurde, hat sich bis heute nicht geändert. Jedoch steht man dort in letzter Zeit aus historischem Bewußtsein und psychologischem Verständnis der Rolle des Zeremoniells viel positiver gegenüber; und der Kampfschrei „Zeremonialgesetz!“ ist aus der heutigen innerjüdischen Polemik vielfach verschwunden. Wird das Wort „Zeremonialgesetz“ von nichtjüdischen Beurteilern des Judentums gebraucht, dann reagiert der Jude, welcher religiösen Richtung er auch angehören mag, ziemlich empfindligh, da der polemische Unterton früherer Generationen noch nicht ganz vergessen ist. P |
|
|
|
[Bräuche und insbesondere ‚Sittengesetze‘ mögen zwar vielleicht, etwas weniger hoch angesehen scheinen, haben aber mindestens ebenso wesentliche Bedeutungen – gerade falls sie zeremoniell inauffälliger / alltäglicher unvermeidliche Handlungsweisen regeln. Gar nicht so wenige Leute erstaunen (beispielsweise auf Reisen) darüber, wie unterschiedlich ein und die selbe Verrichtung erledigt, wie verschieden allen Menschen gemeinsame Bedürfnisse in den ‚Kulturräumen‘ gesehen und gehandhabt, bis befridigt, werden. Zumal dabei neigt des indoeuropäische Singulatitäts(-, bis Gottes)verständnis zu einem erschrockenen (sich durch anwesend gelebte Alternativen – in der / als eigene Identität – bedroht fühlenden) ‚Was der Bauer nicht kennt, das (fr)isst er nicht‘-Trend; während sich etwa in Ostasien eher: ‚Was man nicht kennt ist pft super gut‘-Grundhaltungen antreffen lassen.]
![]() [Eine
Schwierigkeit, zumal sogenannter ‚Moralisierungen‘, besteht ja darin, wie leicht ge(- jedenfalls selbst ver)meint / behauptet
werden kann, ‚(selbsr)
gut(es Mädchen) / regelentsprechend‘
– gar (übererfüllend) besser als der/die andere/n
– zu sein, ohne dies unmittelbar belegen zu
müssen, oder auch nur / gar überhaupt zu können (vgl. ‚drei englische
Gentelem‘ in/bei ihrem Clubgespräch – so besteht qualifiziert Frömmigkeit
eher im/aus dem ‚Bewusstsein‘ / Wissen wie nahe jemand selbst sich der Zielverfehlung bewegt).
Hinsichtlich der Ernährungsfragen / ‚Speisegesetze‘, Kleidungsangelegenheiten
und ähnlichen ‚äißerlich‘, gar (für/als)
höflich (gehaltenen/erwarteten)
bis zerimoniell – zwischen /
von / unter ‚Kulturen‘, Regionen, Konfessionen und sonstigen raumzeitlichen
Bezugs- respektive Zugehörigkeitsgreuppen ja meist sehr verschiedenen
gestalteten –, leicht erkennbaren ‚Gebräuchen‘, verhält sich dies etwas
anders. – Folglich wird diesen Sitten (über so manche verstörende Ungleichheiten hinaus – ‚vergemeinsamend‘)
genau diese wichtige/unvermeidliche Äußerlichkeit als
bloss aufgesetzte, habitualisierte, kaum bedachte/unbewusste Oberflächlichkeit,
gar Schein bis Täuschung, vorgeworfen.]
[Eine
Schwierigkeit, zumal sogenannter ‚Moralisierungen‘, besteht ja darin, wie leicht ge(- jedenfalls selbst ver)meint / behauptet
werden kann, ‚(selbsr)
gut(es Mädchen) / regelentsprechend‘
– gar (übererfüllend) besser als der/die andere/n
– zu sein, ohne dies unmittelbar belegen zu
müssen, oder auch nur / gar überhaupt zu können (vgl. ‚drei englische
Gentelem‘ in/bei ihrem Clubgespräch – so besteht qualifiziert Frömmigkeit
eher im/aus dem ‚Bewusstsein‘ / Wissen wie nahe jemand selbst sich der Zielverfehlung bewegt).
Hinsichtlich der Ernährungsfragen / ‚Speisegesetze‘, Kleidungsangelegenheiten
und ähnlichen ‚äißerlich‘, gar (für/als)
höflich (gehaltenen/erwarteten)
bis zerimoniell – zwischen /
von / unter ‚Kulturen‘, Regionen, Konfessionen und sonstigen raumzeitlichen
Bezugs- respektive Zugehörigkeitsgreuppen ja meist sehr verschiedenen
gestalteten –, leicht erkennbaren ‚Gebräuchen‘, verhält sich dies etwas
anders. – Folglich wird diesen Sitten (über so manche verstörende Ungleichheiten hinaus – ‚vergemeinsamend‘)
genau diese wichtige/unvermeidliche Äußerlichkeit als
bloss aufgesetzte, habitualisierte, kaum bedachte/unbewusste Oberflächlichkeit,
gar Schein bis Täuschung, vorgeworfen.]
Auch für die christliche Seite bleibt die Frage bestehen, ob die Unterscheidung zwischen dem abgeschafften Zeremonialgesetz [sic! soweit/wo nicht gar auch ‚explizitter apostelkoniliarisch‘ auch den ‚Speisegesetzen‘; O.G.J.] und dem noch gültigen moramoralischen Gesetz einen fundamental-theologiselien Sinn liatoder ob ddadzrch die #### Einheit des Alten Testaments negiert wird. Mt 5, 17-48 würde eher die Untrennbarkeit bei der biblischer Aspekte suggerieren. Dort wird das Gesetz verschärft, und zwar unter moralischen (5, 21f, 27- . m . 38-42. 43-48), #### juridischen (5, 31f ) und zeremonialen (5, 23f, 33-37) Rücksichten, Auch wird gesagt, Jesus sei nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern es bis ins Detail zu erfüllen (5, 1 7-19).
Zwar gibt es keinen Sinn, nieht-jüdische Christen auf Tempelkult-Gesetze und auf Gebote der rituellen Reinheit [sic! Versuchungen der Toraüberbietung sind jedoch sowohl apostolischer als auch gerade christlicherseits durchaus belegt; I,G,J.] zu verpflichten. Anderseits muß der Christ, will er sich nicht dem Vorwurf der Doppelzüngigkeit und der markionitischen Häresie aussetzen, an der Integrität des Alten Testaments [sic!] als verbindlicher Offenbarungsschrift festhalten. Eine gewisse Hilfestellung angesehen ###ichts der dilemmatischen Situation bieten jüdische Wertung, wonach die Erzväter mit ihrer Intention (kawwana) #### die ganze Tora gehalten haben, obwohl diese noch gar nicht vorlag (Green 76-78), Auch Vorstellungen über eventuelle Änderungen der Tora in messianischer Zeit ######(Schäfer) könnten struktural dem Christentum angepaßt werden. Entscheidend aber ist, daß Christus, der als „das Ziel des Gesetzes“ (Röm 10, 4) bezeichnet wird, das ganze Gesetz gehalten und durchgetragen hat (Gal 4, 40 . Der Christ hält sieh im Anschluß an die kawwanci ### Christi an die Hebräische Bibel und sieht sich von Christus auch in jenen Geboten gedeckt, die er nicht einhalten kann oder nicht einzuhalten braucht. [Literaturangaben] T»
![]() (Beide
Autoren jeweils zusammen mit dem anderen für ihre Seite im Begegnungslexikon,
S. 225-, Sp.: verlinkende Hervorhebungen O.G.J.).
(Beide
Autoren jeweils zusammen mit dem anderen für ihre Seite im Begegnungslexikon,
S. 225-, Sp.: verlinkende Hervorhebungen O.G.J.).
|
|
« Begriffe |
|
|
|
[‚Geist‘ (gleich gar im summenverteilungsparadigmatischer entweder-oder-dichotomen Feindschaft gegen Materie/Energie, an liebsten ausdehnungslos und unbewegt, verstanden) sei יחיד ‚das ganz (vorbehaltlose, völlig reine, alleinige) nur bei sich selbst sein. (Indoeuropäische Handhabung האליל׀האלהה des Singulars)] |
Unter „Partikularismus“ versteht man - wenn es sich um die Beschreibung von Religionen handelt [wobei auch andere, gar kulturalistisch-überzeugten/bereiten, bis ‚egoistisch‘-beschuldigte, Personen/Figurationen nicht ganz ferne liegen/bleiben müssen; O.G.J. ] - die Besorgnis einer Religionsgemeinschaft [sic! |
bis eben jeglicher selbsterhaltungsorientierten Gemeinschaft, wo nicht sogar soziologischerweise jeglicher Art von Gemeinwesen; O.G.J.] |
[רוח – als /rewach/ erklingend ‚Raum‘ etc., als /ruwach/ vokalisiert ‚Wind‘ etc. repräsentierend – ermöglicht עזר כנגדו qualifizierten Gegenübermächte-Respekt.]
|
|
[Die Bindestrich-artige (orthographisch gar bald wenigstens durch Zusammenschreibung substituierten) Einheitsvorstellung löst alle(s) Beteiligte/n unwi[e]derbringlich in/zu einem (einzigen – allenfalls, bis hoffentlich immerhin חדש.neuen) Ganzen auf.] |
um sich selbst und ihre eigenen Interessen, unter [sic! vermeintlich; O.G.J.]totalem oder teilweisem Ausschluß der übrigen Menschheit. [Auch noch so ‘splended isolation‘ des Autarken, bis Autismus bewahren (zumal ‚global‘) nicht etwa vor sämtlichen (zumal als solche selbst unbemerkten – also im Ergebnis vorgegeben erscheineden) Wechselwirkungen; O.G.J.] |
|
[Eher an \ den / einen Schrägstrich erinnernde, bis senkrechte ו Konzepthacken des/mit waw װ verbinden (gar uns alle / Alles – jedenfalls
im/zum alef |
|
|
„Universalismus“ dagegen bedeutet die Besorgnis um und das Interesse an der nicht zur eigenen Religionsgemeinschaft [sic!] gehörigen Menschheit. |
[Kultur. Nation, Partei, Gruppe, Familie, Person etc. – eben mit den wesentlichen Fragestellugen wie das Verhältnis mit/zu ihnen definiert/vertanden wird: etwa vereinnahmend, unterwerfend, eher kiperativ bis der Vielfalten Vielzahlen…?O.G.J.] |
«Wirkliche
Menschen UND/aber wirkliche Vorstellungen |
|
|
Da es sich bei den heiligen Schriften der verschiedenen Religionen zunächst [sic? zumindest: ‚auch‘; O.G.J.] um Schriften handelt, die für die eigene Religionsgemeinschaft [sic!] bestimmt sind, überrascht es nicht [‚unbedingt (alle)‘ / ‚ausschließlich‘; O.G.J.], daß [sic! oder ‚falls‘ dementsprechend Ausdeutbars; O.G.J.] sich in diesen Schriften Stellen finden lassen, in denen der Partikularismus zum Ausdruck kommt. |
[O.G.J.: Dabei wäre und ist (jedenfalls ausgerechnet jüdischerseits) allerdings (meist) zu bedenken / bemerken (versucht worden), wie, bis ob (andere, irregehende pp.) Ab- bis Ausgrenzendes überhaupt stets kontrastmaximal diffamierend Unterschiede formuliert, plus ebenso buchstabengetreu exekutiert, sein/werden muss/soll? – So ‚ehrlich‘, ‚ermutigend‘, bis ‚heilig absondernd überzeugt / überzeugend‘, dies der jeweiligen ‚Eingengruppe‘ / Bezugsgruppe vielleicht auch vorkommen mag, so ‚direkt und deutlich (gegen)motivierend erweist es sich ja auch – gar absichtlich? – bei/unter jenen anderen.] |
|
|
|
Man sollte das als [sic? ‚üblich‘; O.G.J.] selbstverständlich betrachten und sich eher um den Grad [sic! die Art und Weise; O.G.J.] des Universalismus kümmern, der oft [sic! gar ‚logisch notwendigerweise, doch durchaus übersehbar‘ (umgebungshandhaberisch); O.G.J.] in „partikularistischen“ Religionen anzutreffen ist. Dazu kommt, daß, wenn man z.B. die monotheistischen Religionen betrachtet, von einem „reinen“ Partikularismus oder einem „reinen“ Universalismus, historisch gesehen, nicht die Rede sein kann. Diese Religionen - Judentum, Christentum, Islam - haben alle ihre partikularistische Basis [sic! |
benötigen jedenfalls personale Trägerschaft unter/von/durch lebendige, gar unvollkommene, Menschen plus/in deren Gemeinwesen auf Erden; O.G.J.] |
|
|
|
und auch, da sie ja an den einen Gott der ganz n Menschheit glauben [bis/also ihnen zugehörende Personen (sogar/gerade) mit ihm in Wechselwirkungsbeziehung/en stehen; O.G.J.], ihren universalistischen Ausblick. |
|
|
Spannungen
im Judentum
Der
Gebrauch von den Begriffen „Partikularismus” und „Universalismus“ setzt auch
oft ein Werturteil voraus
(„Partikularismus“ ist schlecht, „Universalismus“" ist gut [sic! vielleicht erweisen sich manch
umgekehrte Argumentationen eher als aktuell/intellektuell
weniger hoffähig / zeitweilig nicht öffentlich
anerkannte, zumal xenophobisch
gepanzert – also besonders virrulente / wütende
Antribe; O.G.J.]), das eher der religiösen Polemik [Latein für: ‚unsachlich
(verdeutlichende Trenn-)Schärfe‘] als dem religiösen [sic! bis etwa statt der
Gefolgschaft ups:‚zwischenmenschlichen /
wechselseitigen‘: O.G.J.] Verständnis dient. So lassen sich z.B. in der
Hebräischen Bibel Stellen finden, in denen von der intimen [sic! bis sogar durchaus
‚spezivischen‘ / gar ‚eifersüchtigen‘, gleichwohl nachrangige Kontakte zu und
mit anderen nicht (absondernd/entheiligend) negierende; O.G.J.]
Beziehung zwischen Gott und Israel die Rede ist. Dennoch hat der biblische Gott
Beziehungen zu Adam und Eva [sic!],
zu Noach und
Hiob, die alle keine Israeliten waren, und kümmern sich die Propheten (z.B.
Amos, Jona, Deutero-Jesaja) auch um nicht israelitische Völker [sic! bis
Individuen; O.G.J.]. Diees fruchtbare
Wechseln zwischen Partikularismus und Universalismus läßt sich auch im
rabbinischen und im modernen Judentum weiter verfolgen, wobei eine zweifache
Entwicklung zu beachten ist, die oft von den politischen [sic! zumal ‚lokalen‘, bis ‚überregionalen‘: O.G.J.] Umständen,
unter denen die Juden leben, abhängig ist. Werden Juden verfolgt, findet der
Partikularismus eine neue Betonung. Können Juden in Frieden mit ihren Nachbarn leben,
wird der Universalismus gestärkt. Trotzdem hat es nie ein Judentum gegeben, das entweder aus einem
„reinen“ Partikularismus oder aus einem „reinen“ Universalismus bestand. Typisch für das
Nebeneinander [sic! bis ‚wechselseitige Durchdringen solcher
Denktsphären/Vorstellungshüllen‘: O.G.J.] von Partikularismus und
Universalismus im Judentum ist das Alenu-Gebet, das an den jüdischen hohen
Feiertagen von allen Juden gesprochen, in seiner vollen Form etwa seit dem 14. Jahrhundert das Schlußgebet
eines jeden Gottesdienstes im aschkenasischen
(d.h. deutsch-polnischen) Ritus bildet. Es
besteht aus zwei Abschnitten. Im ersten wird Gott deshalb gepriesen, weil er
den Juden ein anderes
Schicksal hat zuteil werden lassen als den götzendienerischen Völkern [sic!]. Im zweiten Absatz wird die Hoffnung
ausgesprochen, daß bald die ganze Welt
durch [sic!] das Reich [sic!] des Allmächtigen [sic! vgl. dazu von ![]() /schadai/ bis
/schadai/ bis ![]() mittels dreifach qualifizierter Aufhebung der ‚Ohnmachts‘-Paradoxie
durch freie Gegenübermacht; O.G.J.]
verbessert werde und
alle Bewohner der Erde das [sic! gar ‚leichtere‘, jedenfalls ‚passendere‘, denn
des mensch(enheit)lichen, denn ihresgleichen; O.G.J.] Joch der
göttlichen Herrschaft auf sich nehmen. Das Judentum ist sich also seiner
besonderen Rolle im Heilsplan [sic!] Gottes bewußt, sehnt
sich aber danach, daß die gesamte Menschheit
zu [‚mit‘] Gott in dem selben [sic! jedenfalls – zumal ohne partikularistisch missionierend/‚erlösend‘
– in einem demensprechend/analog ‚nahen/unmittelbaren‘ תורתי; O.G.J.] Verhältnis stehen möge wie es selbst. [Was das ‚jud‘ deutlich von jenem,
eben gar unvermeidlichen (doch erkennbar selbst-überwindlichen)
Impuls-/Eindruck-‚resch‘ unterschiedet: sich selbst einzig/alleine יחידד näher bei (bis als) Gott zu
empfinden als alle anderen; O.G.J. mit La.Ku.]
mittels dreifach qualifizierter Aufhebung der ‚Ohnmachts‘-Paradoxie
durch freie Gegenübermacht; O.G.J.]
verbessert werde und
alle Bewohner der Erde das [sic! gar ‚leichtere‘, jedenfalls ‚passendere‘, denn
des mensch(enheit)lichen, denn ihresgleichen; O.G.J.] Joch der
göttlichen Herrschaft auf sich nehmen. Das Judentum ist sich also seiner
besonderen Rolle im Heilsplan [sic!] Gottes bewußt, sehnt
sich aber danach, daß die gesamte Menschheit
zu [‚mit‘] Gott in dem selben [sic! jedenfalls – zumal ohne partikularistisch missionierend/‚erlösend‘
– in einem demensprechend/analog ‚nahen/unmittelbaren‘ תורתי; O.G.J.] Verhältnis stehen möge wie es selbst. [Was das ‚jud‘ deutlich von jenem,
eben gar unvermeidlichen (doch erkennbar selbst-überwindlichen)
Impuls-/Eindruck-‚resch‘ unterschiedet: sich selbst einzig/alleine יחידד näher bei (bis als) Gott zu
empfinden als alle anderen; O.G.J. mit La.Ku.]![]()
Spannungen
im Christentum
Das Christentum, das sich oft in seiner polemischen Stellung dem Judentum gegenüber (mit Bezug auf Mt 28, 19ff; Lk 2) für weit „universalistischer“ hielt [sic! zumal ohne gleich gar pluralistisch das ganze Alles beanspruchend, sondern eher einheitlich (doch mit Vollständigkeitsanspruch) formuliert zu sein, während manche der Verkündigungsformel an die Hirten sogar den ‚aller Welt‘-Aspekt bestreiten da Jesus/Jeschua zu(erst) zu/wegen seiner eigenen Ethine gekommen – universalistisch qualifizierte Belegstellen der Apostolischen Schriften nennt dieses Begegnungenlexikon verteilt zu anderen Stichworten; O.G.J.], hat auch seine „partikularistischen“ Bibelverse aufzuweisen, in denen das Heil [sic!] allein den Christusgläubigen vorbehalten ist (vgl. z.B. Mt 12 , 30; Joh 14, 6). Kirchenväter wie Irenaus und Origenes lehrten, daß es außerhalb der Kirche kein Heil [sic!] gibt, eine Lehre, die später (1215) von dem 4, Laterankonzil als offizielle Lehre der Kirche proklamiert worden ist (DS 802), Dagegen nimmt die „Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen“ des Zweiten Vatikanischen Konzils eine etwas versöhnlichere und weitherzigere Stellung ein,
indem sie darlegt, daß die katholische Kirche nichts von all dem ablehnt, was in den nichtchristlichen Religionen „wahr und heilig“ ist; obwohl sie auch in dieser Erklärung weiter darauf besteht, daß die Kirche „unablässig“ Christus [sic!] verkündet und verkünden muß (Nostra aeate Nr 2). Was das Verhältnis zu den Juden betrifft, verlangt diese Erklärung sogar daß „die gegenseitige Kenntnis und Achtung“ zu fördern sei, „die vor allem die Frucht [sic!] biblischer und theologischer Studien sowie des brüderlichen Gesprächs [sic!] ist“ (ebd. Nr 4).
Ökumenische
Perspektiven
Im christlich-jüdischen Gespräch wird darauf zu achten sein, daß bei aller Bejahung des beiderseitigen Universalismus die Berechtigung des Partikularismus nicht geleugnet wird, denn ohne den Partikularismus könnten die einzelnen Religionen nicht fortbestehen [sic! wobei har nicht so wenige Missionsarten und Missionsbemühungen zumindest im Verdacht stehen und standen, genau dies zu beabsichtigen: O.G.J.] und keine Träger des Universalismus sein. Ohne den Universalismus würde der Gottesglaube [sic!] beider Religionen ebenfalls geschmälert und verzerrt werden. Das Aushalten der Spannung zwischen Partikularismus und Universalismus, und nicht ihre Auflösung in einem religiösen Synkretismus, gehört zu den Anforderungen, die ein kumenisches Zeitalter [sic!] an die Juden wie auch an die Christen stellt.»
![]() (Jakob
J. Petuchowski mit Cl.Th. im Begenungslexikon, S. 144f., wörtlich
übereinstimmend so bereits Sp. 277-280 in der Auflage vov 1989)
(Jakob
J. Petuchowski mit Cl.Th. im Begenungslexikon, S. 144f., wörtlich
übereinstimmend so bereits Sp. 277-280 in der Auflage vov 1989)
 [Schon, anstatt ‚erst‘ oder ‚allein‘, im
Kleidungsverhalten / Aussehen und Grüßen, bis sonstigen Äußerungen, Universalismusansprüche (für) aufgehoben (in Händen) haltend]
[Schon, anstatt ‚erst‘ oder ‚allein‘, im
Kleidungsverhalten / Aussehen und Grüßen, bis sonstigen Äußerungen, Universalismusansprüche (für) aufgehoben (in Händen) haltend]
Zwar mögen manche Kant, bis dieser Gelehrte selbst seinen ‚Kategorischen Imperativ‘, und/oder Jeschua/Jesus bis משיח /Erlösung, so verstanden haben / verwenden, äh berkennen, wollen: dass alle Dasselbe tun müssen, was sie, wir Euer Gnaden – äh Gott / Vernunft, ihres Erachtens – für richtig/nötig halten; – doch erlauben wir Ihnen/uns anderer, gar nicht allein/immerhin zusammenpassender komplementär / kompetetiv / oppositionell streitbarer-?, Ansichten, Auffassungen, Denk-Empfindungs- und Sichtweisen ab- und/oder zu(getan zu) sein/bleiben\werden.
 [Wobei und wozu sich,
bis mich, mamche unsere Schülerinnen fragen: ob
nicht wirksamer ‚Eifersuchten‘ ausschließendes Gegenteil von/zu allgemeingültigen
Universalismen sind/werden, als (schuld-ursächlich) partikular-verteilende Interessenlagen
und Unterscheidungsbedürfnisse]
[Wobei und wozu sich,
bis mich, mamche unsere Schülerinnen fragen: ob
nicht wirksamer ‚Eifersuchten‘ ausschließendes Gegenteil von/zu allgemeingültigen
Universalismen sind/werden, als (schuld-ursächlich) partikular-verteilende Interessenlagen
und Unterscheidungsbedürfnisse]
 Es stehet ‚geschrieben‘ … AlefBet-מא'
ועד ת'
, Bibel/Thorah,
Bilanz, court, Dichtung, Drama/Drehskript, Erinnern, Essay, Forschungsbericht, Futurum exactum, Gesetz, Habilitationsbuch, Heiligen-Text- من
الألف إلي
الياء , Herz/en, Hymnus, Ideal, Jahren, Kanon, Klageschrift(-Erwiderung),
Klang, Labor, Lehrwerken,
Logos, Mythos, Norm/en, Offenbarung, Orderbeleg,
/pardes/-פרד״ס , Protokoll, Qualen, Quelle/n,
Referat/Report, Roman, Schrägstrichen-וו׀זז , Schrecken, Schwarz,
Schweigen, Sonstwie/-wo, Spiel, Stein, Tempel, Urteil, Verfassung/Vertrag,
Wahrheit/en, Weissen,
XYZ-? [Aus
/ Gegenüber / in / unter Barock,
Bekenntnis, Bezugsgruppe/n,
Gemeinwesen, Milieus, Publikum, Überzeugungsgemeinschaft, Zeitengenossenschaft
gefallen]
Es stehet ‚geschrieben‘ … AlefBet-מא'
ועד ת'
, Bibel/Thorah,
Bilanz, court, Dichtung, Drama/Drehskript, Erinnern, Essay, Forschungsbericht, Futurum exactum, Gesetz, Habilitationsbuch, Heiligen-Text- من
الألف إلي
الياء , Herz/en, Hymnus, Ideal, Jahren, Kanon, Klageschrift(-Erwiderung),
Klang, Labor, Lehrwerken,
Logos, Mythos, Norm/en, Offenbarung, Orderbeleg,
/pardes/-פרד״ס , Protokoll, Qualen, Quelle/n,
Referat/Report, Roman, Schrägstrichen-וו׀זז , Schrecken, Schwarz,
Schweigen, Sonstwie/-wo, Spiel, Stein, Tempel, Urteil, Verfassung/Vertrag,
Wahrheit/en, Weissen,
XYZ-? [Aus
/ Gegenüber / in / unter Barock,
Bekenntnis, Bezugsgruppe/n,
Gemeinwesen, Milieus, Publikum, Überzeugungsgemeinschaft, Zeitengenossenschaft
gefallen] 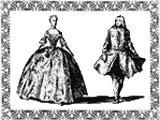 Ich sei/wäre zwar
‚bekenntnissehaft‘ nicht (länger/mehr
‚treu‘ japhetisch) allein, nur, rein von
Ich sei/wäre zwar
‚bekenntnissehaft‘ nicht (länger/mehr
‚treu‘ japhetisch) allein, nur, rein von
![]() Verbalinspiration überzeugt, doch auch gerade
dann/wenn verhaltensfaktisch wesentlich nachgefragt – na
klar Grammatika & Co,:
Verbalinspiration überzeugt, doch auch gerade
dann/wenn verhaltensfaktisch wesentlich nachgefragt – na
klar Grammatika & Co,:
 Selbst / Sogar, und eben gerade, falls / da-wo / soweit wir uns darauf
verständigen könn(t)en:
welche ‚heiligen‘ – zumindest aber
kanonischen, zumal rechtsgültigen – Schriften
Selbst / Sogar, und eben gerade, falls / da-wo / soweit wir uns darauf
verständigen könn(t)en:
welche ‚heiligen‘ – zumindest aber
kanonischen, zumal rechtsgültigen – Schriften  allem / allen zugrunde liegen (welche Wortlaute, bis Lesarten,
wir verwenden s/wollen), bleiben die
entscheidenden Fragen:
allem / allen zugrunde liegen (welche Wortlaute, bis Lesarten,
wir verwenden s/wollen), bleiben die
entscheidenden Fragen:
Ob diese Quellen
 (‚partikularistisch‘, ‚kulturalistisch‘, ‚subjektiv‘, ‚individuell
/ intersubjektiv‘, ‚blasphemisch‘, ‚polemisch‘
oder wie auch immer sonst
gescholten)
(‚partikularistisch‘, ‚kulturalistisch‘, ‚subjektiv‘, ‚individuell
/ intersubjektiv‘, ‚blasphemisch‘, ‚polemisch‘
oder wie auch immer sonst
gescholten)
nur so zu verstehen / verwenden sind: wie ich / wir es aktuell tue / sagen,  [Shell /
Will we]
[Shell /
Will we]
äh wie Sie /
Euer Gnaden dies jeweils / seit-je-her bestimmen
wollen / müss(t)en –  [Did / Do we]
[Did / Do we]
oder doch deutungsbedürftig
verhaltensfaktische
Anwendungen bleiben (sollen
oder müssen, bis dürfen)?  [Reklamiert gar G’tt in durchaus ähnlichen
Weisen ‚Eifersucht‘ wie ‚Rache‘ für sich – gar des ‚armen‘ /resch/ רש wohl unvermeidlich ‚erlaubten‘ Empfindens (‚selbst
näher bei / einziger mit IHM, der
Wahrheit, dem Richtigen befindlich zu sein, als alle/s
andere/n überhaupt‘)
בראשית hinterfragend / abgeben
[Reklamiert gar G’tt in durchaus ähnlichen
Weisen ‚Eifersucht‘ wie ‚Rache‘ für sich – gar des ‚armen‘ /resch/ רש wohl unvermeidlich ‚erlaubten‘ Empfindens (‚selbst
näher bei / einziger mit IHM, der
Wahrheit, dem Richtigen befindlich zu sein, als alle/s
andere/n überhaupt‘)
בראשית hinterfragend / abgeben ![]()
![]() dürfend] Reflex-Übersprung-Reverenzen gefragt-?
dürfend] Reflex-Übersprung-Reverenzen gefragt-?
Jedes ‚Aha‘-Erlebnis / ‚Heureka‘-Entdecken, welche Erfahrungs-, respektive Offenbahrungs- bis (gar ein- oder sogar wechselseitige) Selbsterschließungsquellen עיניים auch immer (wie mehr oder minder unvermittelt auch immer) beteiligt / herangezogen / verwendet – zumal über- bis außerraumzeitlich( anerkannte, also auch nicht nur, gar intersubjektiv konsensfähig /z.B.\theoretisch aspektisch-modal / lückenhaft modelliert qualifizierten Sinne/n für Wahrhaftigkeit / Wesentlichkeit / Wirksamkeiten gehalten werdend)e Kenntnisse inklusive – ausgerechnet innerraumzeitliche Aspekte und Konsequenzen hat, gleich wo diese übersehen, oder falls sie geleugnet / weggehofft werden.
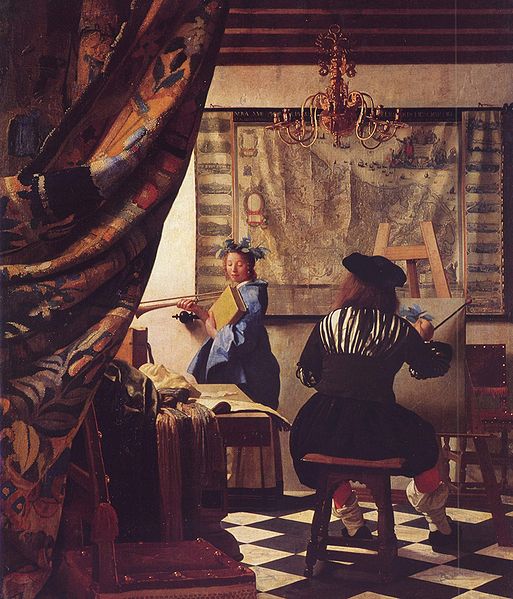 [‚Innerraumzeitliches‘, namentlich
‚Historie abschaffen / erlösen
/ beenden zu s/wollen‘ steht hier
nämlich im/unter herrschaftlichem Verdacht: ‚recht gehabt haben …‘ – zumal Wer-Frage betreffend]
[‚Innerraumzeitliches‘, namentlich
‚Historie abschaffen / erlösen
/ beenden zu s/wollen‘ steht hier
nämlich im/unter herrschaftlichem Verdacht: ‚recht gehabt haben …‘ – zumal Wer-Frage betreffend]
Geschichte mag sich durchaus als ‚Testlabor‘ der Ideen (unter, bie, für und gar
von Menschen) erweisen: Unter denen jene jüdische/n
Hoffnung/Erwartungen, ‚dass sich (irgendwann, bis schließlich) alle erkannt von undװaber erkennend auf jenen G’tt/Gott beziehen, dessen
‚Einzigkeit‘ /jaxied/ יחיד schon, oder dennoch, bereits im hebräischen mit/unter über
70 Namen (mithin gar einen für/von jede/r Ethnie – der
emblematischen/symbolischen Vollzahl[!] der ‚Kulturkreise‘ entsprechend) mit
den (waw-)vollständigen (beide jud verbindenden) alef präzieser als der/die/das
EINE אחד - אחת adressiert, bis (Anderheitsabstand/Unterschied) respektiert, wird. – Derzeit/Bis auf weiteres genügte jedoch, dass der Gött, ja
sogar Götze, Grundstz pp. bis Rechtsfolgegrund, bei dem jemand anderes sich
selbstverpflichten, sanktionsbewährt schwört, insofern mit dem eignen (jenen
aller Vertragsparteien) kompatiebel anerkannt wird, dass verbindliche
(wechselseitig auf dagegen Willkürakte verzichtende) ברית Bündins-/Vertragsvereinbarungen א־מ־ן zustande kommen sowie durchgesetzt,
bis (erneuernd
חדש) fortentwickelt/vollendet,
werden (dürfen/sollen). 
|
Zu den (für so manche gar ganz besonders bitteren ?/!
blauen) Früchten äh Geheimnissen
gehört ja, dass ob ‚Leere mit ‚Dehnungs- ‚e‘ oder ‚Lehre mit ‚Dehnungs-He‘
– nicht einmal wo bzw. falls
sie/Sie gar nicht ganz / absolut
leer sein/werden sollten – längst
keinen, so wesentlichen, wie ja immerhin grammatikalischen, Unterschied machen. |
|
So manche verhaltensfaktische Konsequenzen des ‚Vierweges‘ der Hermenutik / des פרד״ס PaRDeS-Gartenkonzeptes (ob nun Obst-, Apfel-, Bezauberungs-, Nuss-,
Tier-, Wunder-, Zitrusfrücje- und/oder was auch immer sonst für eine, gar und in welchem Sinne ‚paradiesische‘
Parkanlage Pate/Allegorie stehen mag)
verschwinden nicht durch deren Ignoranz oder mittels noch so überzeugter
Bestreitung / Überflüßigkeits- bis Überwundenheitsbehauptung (derart selektierender
und begrenzter Vorgegensweisen,
falls nicht sogar unausweichlicher Notwendigkeit). 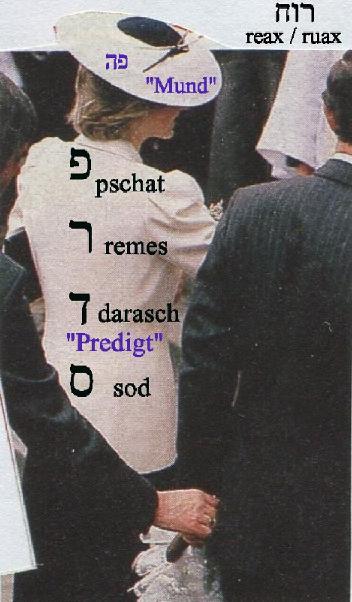 [פשט
‚abstrakt‘, ‚entkleiden‘ /pe/
פ
[פשט
‚abstrakt‘, ‚entkleiden‘ /pe/
פ
רמז ‚Hinweis‘, ‚Referenz‘
/resch/ ר
דרש ‚Forderung‘, ‚Predigt‘ /dalet-daled/ ד
סוד ‚Geheimnis‘,
‚Mitbeteiligung‘ /samech/
ס]
Pschat פשט – steht mnemotechnisch für die (keineswegs verwerflicherweise)
oberflächliche/‚spontan‘-habitualisierte, ‚einfach‘-genannte (doch eben, zumal in semitischen Sprachen, immer
mehrdeutige) ohnehin nie ohne Zusammenhänge
vorhandene/verstehbare Ausdrucks- bis Text(be)deutung.
Wozu allerdings immer auch gegebene (etwa ‚nonverbale‘, situative) Hinter- *bis (etwa des Verborgen, bis alternativ/anders eben
nicht, oder aber überhaupt gar nicht,
Gesagten/Dastehenden) Untergrund
gehören/kommen, deren häufige/übersehene Unterschlagung nicht mit unvermeidbar
wichtigen Komplexitätsreduktionen zu entschuldigende Verfehlungen (allenfalls ein
‚Buchstabe‘ unterscheidet /pscha‘/ und /pschat/)
sein/werden können (statt immer müssen). ![]()
 Denn ausgerechnet bei
dem was, nicht allein jüdischerseits, bestenfalls unvollständig, als ‚das
Gesetz‘ verstanden, und auch mit dem griechischen ‚Bibel‘-Gedanken allenfalls
teilweise übereinstimmend erfasst, wird handelt es sich um keinen, in dem
Sinne, monolithischen, in / aus Stein gehauenen, Block, dass es – da ja unveränderlich (gar
beinahe von/durch G’tt höchst selbst) so festgeschrieben steht – für und schon immer, von allen, genau gleich (zucdem konflikfrei,
logisch zwingend stringent pp.) wahrzunehmen
wäre. – Gerade da / (bereits) falls die Torah alles
wesentliche enthält bedarf sie/es der jeweils passenden – gar eher teilweisen,
aspektischen, als gleichzeitig vollständiger –
Entfaltung/Hinein- äh Herausarbeitung.
Denn ausgerechnet bei
dem was, nicht allein jüdischerseits, bestenfalls unvollständig, als ‚das
Gesetz‘ verstanden, und auch mit dem griechischen ‚Bibel‘-Gedanken allenfalls
teilweise übereinstimmend erfasst, wird handelt es sich um keinen, in dem
Sinne, monolithischen, in / aus Stein gehauenen, Block, dass es – da ja unveränderlich (gar
beinahe von/durch G’tt höchst selbst) so festgeschrieben steht – für und schon immer, von allen, genau gleich (zucdem konflikfrei,
logisch zwingend stringent pp.) wahrzunehmen
wäre. – Gerade da / (bereits) falls die Torah alles
wesentliche enthält bedarf sie/es der jeweils passenden – gar eher teilweisen,
aspektischen, als gleichzeitig vollständiger –
Entfaltung/Hinein- äh Herausarbeitung. 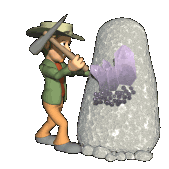 [Zumal
sich die Analogie ‚vom Bearbeiten eines Teiges‘ eher eignen möge – wo/da das
steinmetzartige CHeRuT so viel mit Freiheit (des/der
Anderen – von/vor meiner Willkür/Ungeheuerlichkeit,
ich Ihnen/Euch also
implizit ebenfalls …?), bis gar
Kreativität/en …]
[Zumal
sich die Analogie ‚vom Bearbeiten eines Teiges‘ eher eignen möge – wo/da das
steinmetzartige CHeRuT so viel mit Freiheit (des/der
Anderen – von/vor meiner Willkür/Ungeheuerlichkeit,
ich Ihnen/Euch also
implizit ebenfalls …?), bis gar
Kreativität/en …]
|
Bereits das (zudem nicht mit
einem ט
tet beginnende) von seiner sprachlichen
Herkunft her, in einem Ausdruck, am ehesten mit/als
‚Weisung‘ zu begreifende, anstatt damit / darin vollständig umfasste /
überblickte, (nebenstehende) hebräische Wort |
Torah תורה mit offenem He
הא (dem geringstmöglichen Hauch Lebendigen /
Wahrnehmens überhaupt) am Ende(!/links), und\aber
seine, für (unter)stützungsbedürftig gehaltene (sprich / bemerke /
verschweige: ‚abschließend-geschlossene‘),
meist kombiniert mit/als ‚(in νόμος/normiert-unbeweglicher
Treue)‚fest( da stehend)er Lehre/n Lógos logika‘ verwendete, in
einem (zweiten
/ doppelnden) Tav תו (dem Zeichen der Note, Klang bis Notiz, die/das
G-tt und Mensch/en gemeinsam teilen – Ursprung
aller Grammatik)
endende, Form תורת Torat enthält/ergeben
die lexikalische (auszugsweise nachstehende)
Bedeutungsfülle: |
|
Tora [to·ra || 'təʊrə /'tɔːrə]
n. Tora, (Japanisch) "Tiger", chinesisches Tierkreiszeichen. Torah [to·rah || 'təʊrə /'tɔːrə]
n. Thora, das Gesetz Moses, Pentateuch, Fünf Bücher Mose; Lederrolle auf der
das Pentateuch geschrieben ist; jüdische Schriften und Lehren (schriftlich
und mündlich übertragen). Torah [tɔa]
|
תורה
nf. Torah (the Pentateuch);
law, doctrine, ism [method, outlook, principle]; theory, science, lore [compilation
of traditional knowledge or beliefs about a particular subject; knowledge
gained through education, learning];
teaching, gospel (להורות
v. to teach, instruct;
command; rule; indicate, point). Tora [to·ra || 'təʊrə /'tɔːrə]
n. (Japanese) "tiger", Chinese zodiac sign.
Tora nf. Torah, first of three parts of the Hebrew Bible, Pentateuch,
Five Books of Moses; leather scroll on which the Pentateuch is inscribed;
entire body of Jewish Scriptures and teachings (including Written and Oral
Laws). |
Torah
[to·rah || 'təʊrə /'tɔːrə] n. la Torah, la Bible composée des cinq
livres du Pentateuque, Le Pentateuque (Judaïsme); ensemble formé par les
livres du canon biblique et le Talmud. |
Tora
[to·ra || 'təʊrə /'tɔːrə] (ש"ע[noun] ) טורה[column, file, row, rubric, queue, rank,
sequence, series; progression (math.)] , (יפנית |
![]() [In G’ttes Buch סֵפֶר
-תּוֹרָה kommen Menschen vor – /haschem/ השם interessiert was Sie davon halten / damit
machen / … ] Vielleicht
kommt in der, manche gar überraschenden, Ausformulierung eines
Rabbiners/Romanciers wenigstens
ein Eindruck vom dialogisch gemeinten Ansatz – immerhin G’ttes – zur/der jeweiligen (gar, per angehängtem jud, wi[e]dereöffneten) תורתי /(‘et-)toratij/ (vgl.
insbesondere Jeremia 31: 31-34) zustande:
[In G’ttes Buch סֵפֶר
-תּוֹרָה kommen Menschen vor – /haschem/ השם interessiert was Sie davon halten / damit
machen / … ] Vielleicht
kommt in der, manche gar überraschenden, Ausformulierung eines
Rabbiners/Romanciers wenigstens
ein Eindruck vom dialogisch gemeinten Ansatz – immerhin G’ttes – zur/der jeweiligen (gar, per angehängtem jud, wi[e]dereöffneten) תורתי /(‘et-)toratij/ (vgl.
insbesondere Jeremia 31: 31-34) zustande:
„Das [sic! jedenfalls und immerhin Gemeinsame
sämtlicher Richtungen im/am; O.G.J.] Judentum
ist eine Religion [sic1] der Bücher.
Die gesamte
Tradition fußt auf
einem Roman: Am Berg Sinai übergibt Gott
den
entlaufenen Sklaven (die einmal Juden
werden
sollen, was
sie aber
noch nicht wissen) etwas, das einmal die Fünf Bücher
Mose heißen wird.
»Hier«, sagt Gott, »nehmt es mit nach Hause [sic!]
und lest es
durch. Natürlich [sic? ‚Na
klar‘; O-G.J.] kommt ihr auch darin vor. Es handelt von euch und von mir.
Deshalb will ich unbedingt wissen, was ihr davon haltet.« Die
jüdische Theologie,
insofern es eine gibt [gar eher Halacha und H/Aggada zusammen; O.G.J. mit
J.J.P.], ist die Reaktion der Juden auf
den göttlichen Roman, dessen Protagonisten sie sind; deshalb nennt man die Juden das »Volk
des Buches«. Das ist
auch das Eigentümliche am jüdischen Fundamentalismus [sic! ihres
‚antitotalitären Totalität/en‘; O.G.J. mit E.A.S.]. Da die Juden die Worte der Tora für göttlich
erachten, sind sie überzeugt, dass jedes Wort, das der Quelle
allen
Sinns
entspringt, natürlich [sic?
logischerweise notwendig
erwartbar – doch eben mit
nicht-randlosen, gar nur geheuerlich-Menschengleichen / völlig deterministisch
berechenbaren, jedenfalls für [immanent]
überschau- bis beherrschbar
gehaltenen, Absolutheitenvorstellungen kollidierend; O.G.J.] eine unendliche Zahl von Bedeutungen
aufweisen muss. Und so wird der Sohar —
ebenfalls
ein Roman, der sich als ein Kommentar zu Gottes Roman ausgibt — unerschöpflich.“ (La. Ku. Kabbala 2006, S. 153;
verlinkende Hervorhebungen O.G.J.) 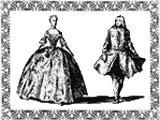 Der/Einer sowohl ernue[r]ten als auch einer, bis der,
dennoch[igen] Wi[e]deraufnahme interaktiven,
(gar sowohl
individuellen als auch kollektiven. jedenfalls)
persönlich(
elementar betreffend)en,
durch wechselseitige Selbsterschließung qualifizierten (folglich bekanntlich eben überhaupt nicht
erzwingbaren, durch zwingende Gewaltandrohung oder Anwendung, notwendigerweise
zerstörten, jedenfalls unter- bis abgerbrochenen), Zwiegesprächs (zumal Mensch-Mensch, bis Dyade- respektive Menschenheit-G‘tt). – ‚Verloren gegangen‘ (vgl.
Konservatismus, mit/als lateinisiert ‚Religion‘ bis und/aber als Progression) respektive zu suchen/finden/erwarten ist/wäre nämlich
nicht etwa
Der/Einer sowohl ernue[r]ten als auch einer, bis der,
dennoch[igen] Wi[e]deraufnahme interaktiven,
(gar sowohl
individuellen als auch kollektiven. jedenfalls)
persönlich(
elementar betreffend)en,
durch wechselseitige Selbsterschließung qualifizierten (folglich bekanntlich eben überhaupt nicht
erzwingbaren, durch zwingende Gewaltandrohung oder Anwendung, notwendigerweise
zerstörten, jedenfalls unter- bis abgerbrochenen), Zwiegesprächs (zumal Mensch-Mensch, bis Dyade- respektive Menschenheit-G‘tt). – ‚Verloren gegangen‘ (vgl.
Konservatismus, mit/als lateinisiert ‚Religion‘ bis und/aber als Progression) respektive zu suchen/finden/erwarten ist/wäre nämlich
nicht etwa die Alleineinzigkeit יחיד /jaxid/ (woran dem gerade dadurch in zwei jud, bis resch, zerfallenden
alef, seinװdas waw-Hacken fehlt) Identität/Selbigkeit aller und von allem (oder wenigstens meine) zurück in Gott als ganzheitliches, kosmisch (schönes anstatt irgendwie, pfui
ausgedehntes, entfernbares, unvollständig determinierbares, vollendungsfähiges) Überhaupt (Etwas bis/und Jemand) / Leeres
Nichts (gar
nicht einmal ‚reines Sein‘ oder ausschließliches nur ‚Werden‘).
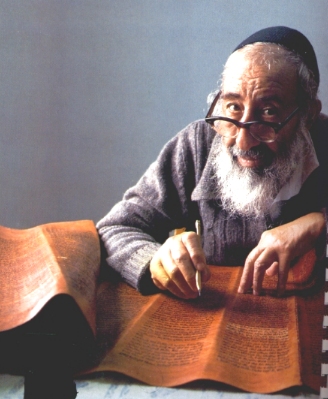 In dem 79.980, bis heute auch handschriftlich – mit besonderer
Sorgfalt, von einer ununterbrochenen Kette von Zeugen, persönlich – überlieferten,
‚Zeichen‘ (eben sowohl Ziffernsysteme als auch Buchstaben
und zumindest Lautrepräsentationen: /ora schebiktav/) תורה
שבכתב der schriftlichen Tora im
engsten Sinne (auch als Pentateuch,
‚Fümfnuch/er des Mose‘, bekannt), kommt das Wortfeld pe/fe-resch-dalet-samech
ausdrücklich so פרדס zwar nicht einmal vor (schon
gar nicht im/als ‚Garten Eden‘/גן-עדן
der Genesis/bereschit), in der übrigen hebräischen Bibel (schriftliche Tora im
weiteren Sinne des תנ׳ך Tanach/Tenach
aus Mose/ תורה, Propheten/
נביאיםund Schriften/
כתובים) steht das, warum auch immer verwechselte und sogar
lexikalisch gleichgesetzte (auf die assyrische
Erfindung von Beeindruckungspark- bis Betörungsanlagen, zumindest mit
botanisch-zoologischen ‚Wunderdingen‘/Exoten, zur – gar schreckenden/nimrodischen
– Beherrschung der Bevölkerung, bei vergleichsweise
‚schlaraffenlandartiger‘ Lage der Herrschenden, zurückgehende) Wort immerhin im Hohenlied 4:13 (in manchen
‚Zählungen‘/Unterteilungsweisen Vers 14) genau so /pardes/ und flektiert in
Prediger/kohelet 2:5 im Plural פרדסים /fardesim/
sowie in Nehemia 2:8 הפרדס /hapardes/ auch als ‚des
Waldes‘ respektive ‚der Festung‘ verstehbar,
geschrieben.
In dem 79.980, bis heute auch handschriftlich – mit besonderer
Sorgfalt, von einer ununterbrochenen Kette von Zeugen, persönlich – überlieferten,
‚Zeichen‘ (eben sowohl Ziffernsysteme als auch Buchstaben
und zumindest Lautrepräsentationen: /ora schebiktav/) תורה
שבכתב der schriftlichen Tora im
engsten Sinne (auch als Pentateuch,
‚Fümfnuch/er des Mose‘, bekannt), kommt das Wortfeld pe/fe-resch-dalet-samech
ausdrücklich so פרדס zwar nicht einmal vor (schon
gar nicht im/als ‚Garten Eden‘/גן-עדן
der Genesis/bereschit), in der übrigen hebräischen Bibel (schriftliche Tora im
weiteren Sinne des תנ׳ך Tanach/Tenach
aus Mose/ תורה, Propheten/
נביאיםund Schriften/
כתובים) steht das, warum auch immer verwechselte und sogar
lexikalisch gleichgesetzte (auf die assyrische
Erfindung von Beeindruckungspark- bis Betörungsanlagen, zumindest mit
botanisch-zoologischen ‚Wunderdingen‘/Exoten, zur – gar schreckenden/nimrodischen
– Beherrschung der Bevölkerung, bei vergleichsweise
‚schlaraffenlandartiger‘ Lage der Herrschenden, zurückgehende) Wort immerhin im Hohenlied 4:13 (in manchen
‚Zählungen‘/Unterteilungsweisen Vers 14) genau so /pardes/ und flektiert in
Prediger/kohelet 2:5 im Plural פרדסים /fardesim/
sowie in Nehemia 2:8 הפרדס /hapardes/ auch als ‚des
Waldes‘ respektive ‚der Festung‘ verstehbar,
geschrieben.
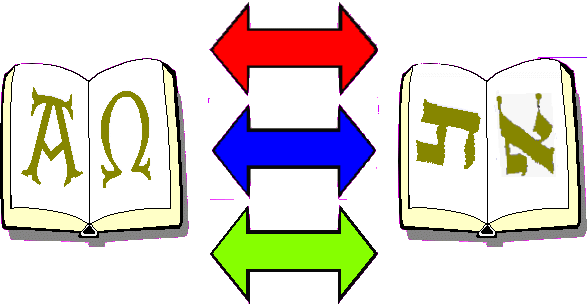 Dazu (zum gar ‚schwarzen Feuer‘ des Geschrieben/Gesagten/Getanen/Geschehen) kommt und .damit (als ‚rückseitigs‘
gar ‚weißes Feuer‘) zusammen gehört aber
immer.
(vgl. bereits drunten den ‚als-Charkter‘ jedes Erkennens), eben ‚von Anfang
(nicht etwa
erst/immerhin ‚dem
Sinau/Horeb‘) an‘, ja auch ohne
geschriebener Zeichen, bis Texte, Vorliegen, mittels Alefbet von את alef-bis-taw, übersetzlich in/aus ‚Alpha und Omega‘, ‚A
bis Z‘ etc. /mealef (we)adtav/ מא׳ ועדת׳ alles das was sich überhaupt in/mit Sprachen (gar nicht alleine/zumindest verbalen/akustisch) ausdrücken/repräsentieren
läßt .von/durch resch-waw-chet רוח nämlich sowohl vom ‚Raum‘
/rewach/ des (gar
Respekts-)Abstandes (etwa von/zu benachbarten Zeichen/Signalen, ggf.
zum/vom Pergamentrand oder Bucheinband, mindestens jedoch zum/vom wahrnehmenden Menschen), als auch vom ‚Wind(brausen)‘
/ruach/ der Verbreitung und Deutung, bis Wirkung, umgeben:. Weder notwendigerweise (für wen oder was auch immer) zutreffend beobachtend / gedeutet oder verwendet / wirkend(e Grammatik), noch ‚irgendwie, gar magisch, von selbst /
automatisch, bis inspiriert, derart alternativlos ein(ein)deutig zwingend,, habitualisiert / gelernt / akulturiert
bis geradezu überwältigend, wie ‚es‘/Erkenntnis einem Interaktion häufig (passend/hinreichend –
mithin unauffallend) vorkommt.
Dazu (zum gar ‚schwarzen Feuer‘ des Geschrieben/Gesagten/Getanen/Geschehen) kommt und .damit (als ‚rückseitigs‘
gar ‚weißes Feuer‘) zusammen gehört aber
immer.
(vgl. bereits drunten den ‚als-Charkter‘ jedes Erkennens), eben ‚von Anfang
(nicht etwa
erst/immerhin ‚dem
Sinau/Horeb‘) an‘, ja auch ohne
geschriebener Zeichen, bis Texte, Vorliegen, mittels Alefbet von את alef-bis-taw, übersetzlich in/aus ‚Alpha und Omega‘, ‚A
bis Z‘ etc. /mealef (we)adtav/ מא׳ ועדת׳ alles das was sich überhaupt in/mit Sprachen (gar nicht alleine/zumindest verbalen/akustisch) ausdrücken/repräsentieren
läßt .von/durch resch-waw-chet רוח nämlich sowohl vom ‚Raum‘
/rewach/ des (gar
Respekts-)Abstandes (etwa von/zu benachbarten Zeichen/Signalen, ggf.
zum/vom Pergamentrand oder Bucheinband, mindestens jedoch zum/vom wahrnehmenden Menschen), als auch vom ‚Wind(brausen)‘
/ruach/ der Verbreitung und Deutung, bis Wirkung, umgeben:. Weder notwendigerweise (für wen oder was auch immer) zutreffend beobachtend / gedeutet oder verwendet / wirkend(e Grammatik), noch ‚irgendwie, gar magisch, von selbst /
automatisch, bis inspiriert, derart alternativlos ein(ein)deutig zwingend,, habitualisiert / gelernt / akulturiert
bis geradezu überwältigend, wie ‚es‘/Erkenntnis einem Interaktion häufig (passend/hinreichend –
mithin unauffallend) vorkommt.
Zumindest und zumal was die geschrieben-stehende Tora
angeht haben, jedenfalls Juden versucht ihre zumal ‚mündlich‘
verkündeten/angewandten, daher תורה
שבעל פה /tora schebeal pe/,
Einsichten, Verständnisse, Schlüsse und Deutungen – gleich gar die
strittigen, und was den (gar eher kleineren) koordinationsbedürftig
verhaltensrelevanten Bereich /halachah/ ‚des Weges der gegangen werden soll‘,
angeht verbindlich (doch je zweitgenö0isch und lokal begrenzt/vorläufig), meist
per Mehrheitsentscheidungen, geregelt –
ebenfalls ‚archivierend und studierend‘, nicht erst in beiderlei
Talmudim (dem
jerusalemer/palästinensischen [pT] und dem deutlich umfangreicheren
babylonischen Taimud) und inzwischen weit
darüber hinaus, mit-zu-überliefern, offengelegt, erleutert und unerschöpflich, (ups
selbst)kritisch
weiter zu entwickeln / kommentieren / entdecken.  So
kommt das Merkwort פרד״ס ausdrücklich und insbesondere angewandt,
ohne dazu der Erwähnung zu bedürfen, diese Verwendung gar selbst nicht einmal bemerken (oder leugnen/übersehen) müssend, gar nicht allein nur der jüdischen, oder
religiösen, ‚Literatur‘ (seither) ständig,
jedenfalls bis eher teilweise, zum Einsatz:
So
kommt das Merkwort פרד״ס ausdrücklich und insbesondere angewandt,
ohne dazu der Erwähnung zu bedürfen, diese Verwendung gar selbst nicht einmal bemerken (oder leugnen/übersehen) müssend, gar nicht allein nur der jüdischen, oder
religiösen, ‚Literatur‘ (seither) ständig,
jedenfalls bis eher teilweise, zum Einsatz:  [Reverenz – Annäherung durch Erhöhung der Respektsdistanz]
[Reverenz – Annäherung durch Erhöhung der Respektsdistanz]
Remez (ach
ja zu Deutsch mit s-Laut empfunden) רמז – steht erinnerlich für Hinweis/e, eben
Reverenz/en, bis gar solchen
lateinisch mit vav, aus der Vielfalten Vielzahlen sowohl auf andere
Fundstellen/Zusammenhänge (bekanntlich kann, wer genügend
Zeit/Konzentrationsformenwechsel mit mindestens zwei unzusammenhängende
Gedanken hat/nimmt gar nicht anders als Verbindungen zu finden/schaffen) der erwähnten Begrifflichkeiten / Gedanken / Dinge /
Ereignisse / Personen, als auch auf Reichweitenunterschiede (respektive
Wahrnehmungsdifferenzen bis Empfingsungshorizobteverschiedenheiten mehr oder
minder) gemeinsames repräsentierender ‚Zeichen‘/Semiotika (zwischen diese
verwendenden und/oder beobachtenden Menschen) plus übertragend,
allegorisch-gleichnishaft damit Angesprochenem/Gemeintem. Nicht
so ganz ohne die zusätzliche Schwierigkeit, ‚kaum auf etwas von dem hinweisen
zu können, was einem selbst nicht bekannt/vertraut/verfügbar‘ – durchaus mit,
zumal ungeheuer( anderheit)lichem, Potenzial für/von Aha-Erlebnisse(n des למד Lernens) bis hin – gar zu gerne
– gleich ‚Offenbarung‘ Genanntem. 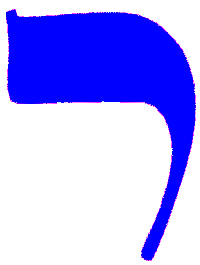
Daresch דרש – steht (eben mit דלד
oder aber דלת beginnend
‚beabsichtigt bemerklich‘ gemeint / gemacht), gar wesentliche Türen-öffnend äh
verschließend, für die mit den (insbesondere Schreib-/Sprech-)Akt der Interaktion beabsichtigte (gleich gar motivationale
bis Handlungs-)Wirkung (erst recht der/einer
‚Predigt‘): Etwa vom Brechen/Verhindern des
Schweigens (einer
möglichen nämlich der verbalen/tonalen Form des Aufnehmens bzw. Unterbrechens
von Begrü0ungen/Verabschiedungen, Segnungen/Verfluchungen,
Beglückwünschungen/Belastungen, Danksagungen/Entmutigungen,
Bedrohungen/Ermunterungen, synchronisierende
Einstimmungen/komplementär Verbindungen etc.),
über‘s ‚Geöffnet-/Geschlossen‘-Bekommen
eines ‚Fensters‘ (oder dementsprechender
Vorsicht/Rücksicht, bis ‚Genehmigung/Verweigerung‘), über Mitteilungsabsichten (etwa zur Abbildung/Erfassung,
Erklärung/Bestreitung, Deutung von Sach- oder gar Personenverhalten,
Belehrung/Beschulung, Planungen, Koordinierungen, Entscheidungen – eben
insbesondere zu Überzeugungs[änderungs]- und/oder Überredungsarbeit),
bis zu – gar
formellen – Prüfungen, Ernennungen,
Eröffnungen, Warnungen, Urteils- respektive Heilsverkündungen, Befehlen
etc. pp.. ![]()
Sod סוד – steht schließlich (gar mahnend) erinnernd,
insofern geradezu nochmal, für jene ganzen übergroßen Bereich/e der ‚einem unbekannten/übersehenen Bedeutungsumgebungen‘, des einem (zumal gemeinsam) immerhin in der Art
und Weise bekannten Spektrums, dass
daraus –
auch, bis gerade dann – gewählt wurde – wenn
und wo einem dies gar nicht auffiel, als alternativlos einzigmöglich/eindeutig
erschien. – Nicht zu verstehen / ‚Wissen‘ warum und wozu G’tt etwas empfohlen, bis
angeordnet, hat verhindert immerhin Wege zu finden
dieses Ziel auf eine andere Art und Weise erreichen zu können. 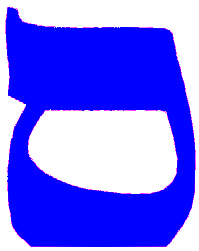
Zumindest umfassend, bzw. gleichzeitig, lässt sich also/eben selbst mit allen derzeit ‚zugänglichen‘/verfügbaren Semiotiken, darunter insbesondere Mathematik und (sonstige) verbale Sprachen, aber auch nonverbale Behavioremen, ‚Musik‘, ‚Darstellungs- und Abbildungskunst‘, Ästhetik/Wahrnehmung pp. nicht, oder noch nicht, ‚Alles‘ ausdrücken/repräsentieren. – Fragen (gar zu/von diesen Antworten) liegen bekanntlich gleich nebenan bzw. droben/drunten im Turm; qualifizierte Artigkeiten (zumal im Unterschied zu ‚bravem, Folgsamkeit/Gefolgschaft meinenden bis wollenden, Gehorsam‘) und gar Schönheit / Selbst- und Anderheitsresonanz, auch unten und ‚hier‘ drüben.
 Manche bilden sich eben/tatsächlich
ein: ‚Damit leben‘ zu können/dürfen, wenn sie (mal) nicht ... (na
klar «servierend» – wie denn sonst?) ... bei wem / für was auch immer, kniet.
Manche bilden sich eben/tatsächlich
ein: ‚Damit leben‘ zu können/dürfen, wenn sie (mal) nicht ... (na
klar «servierend» – wie denn sonst?) ... bei wem / für was auch immer, kniet. 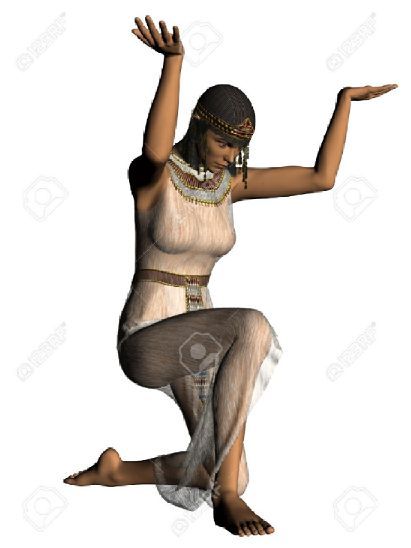
![]() Aber bitte Vorsicht: Schon wer Vorstehendes /lo/
לא bemerkt, wird damit rechnen können,
erwarten dürfen, deswegen ‚der
schlimmsten Verbrechen bezichtigt zu
werden‘ – gar andere Gemeinschaft, jedenfalls
ein anderes Publikum …
Aber bitte Vorsicht: Schon wer Vorstehendes /lo/
לא bemerkt, wird damit rechnen können,
erwarten dürfen, deswegen ‚der
schlimmsten Verbrechen bezichtigt zu
werden‘ – gar andere Gemeinschaft, jedenfalls
ein anderes Publikum …
c Sogar ‚ihrer‘ darf Können. [‚Zurück*‘ gar qualifiziert /tsimtzum/ צימצום –
immerhin ‚Pfingstkuppel‘
der goldenen Basilika
Venedigs]
Sogar ‚ihrer‘ darf Können. [‚Zurück*‘ gar qualifiziert /tsimtzum/ צימצום –
immerhin ‚Pfingstkuppel‘
der goldenen Basilika
Venedigs]  Ajin עין und zwar
durchaus gerade mit ע ‚Auge‘ geschrieben, eben die (Ziffer sic!) Siebzig – oder: Ob, bis gleich
gar was, wir –
zumindest Juden, bis die Menschenheheit
überhaupt – ‚seit / mit / von ‚der
Ajin עין und zwar
durchaus gerade mit ע ‚Auge‘ geschrieben, eben die (Ziffer sic!) Siebzig – oder: Ob, bis gleich
gar was, wir –
zumindest Juden, bis die Menschenheheit
überhaupt – ‚seit / mit / von ‚der ![]() Septuaginta
(latinisiert
– LXX)‘, immerhin dem 4./3. Jahrhundert vor der bürgerlichen Zeitrechnung,
dazu gelernt haben könnten & dürfen
(anstatt
Septuaginta
(latinisiert
– LXX)‘, immerhin dem 4./3. Jahrhundert vor der bürgerlichen Zeitrechnung,
dazu gelernt haben könnten & dürfen
(anstatt müssen)?
– Verdichtet lässt sich die wenigstens ‚Legende‘ von der, insofern ‚ersten‘, bekannten /
vollständig erhaltenen, Übertragung des
hebräischen Tanach-Ttextes in die / als eine
griechische Bibel bekanntlich wie
folgt erzählen:
Wieder einmal war
ein judenfeindlciher Tyrann ‚an die
Schalthebel der
Macht‘ gelangt: diesmal – oder (zumal sofern ‚das
Land Gosen‘ daselbst gelegen) ‚schon wieder‘ –
gerade in Alexandria. Doch war dieser ‚übernatürlich‘ / von Unerwartetem
beeindruckbar, und also (zumal vielleicht ‚überlegenen Mächtenj‘ gegenüber, bis wegen) vorsichtig genug, lieber wissend
verstehen/überwach(end verwend)en
zu wollen: Was hebräisch in der Tora – und gleich gar ob es überraumzeitlich
von/durch/über Gott da – geschrieben steht? So wurden siebzig Schreiber (gar einer für jede
Sprache bzw. die symbolische Gesamtanzahl
Ethnien
/ Völker), manche meinen es seinen sogar
noch zwei, drei Gelehrte mehr (‚in Reserve‘ oder ‚ersatzweise‘ – konsensfähig ‚immerhin
mehere‘) gewesen: einzeln mit dem hebräischen
Toratext isoliert, eingesperrt, und mussten diesen ins Grichische übersetzen.
Hinterher, von dem exakt übereinstimmenden Resultat der
Ergebnisse bei / von allen Schreibern, war der Diktator – was auch immer ihm das
bedeutet / bewiesen haben mag – immerhin so betroffen, dass jener damals auf Pogrome verzichtet
habe.
Aus der/den eins-zu-eins Übersetzungsliste/n der Schreiber
für derartige Fleißarbeiten linearer, (gar auswendig gelernten, bis habituell
verinnerlichten) einzelnen
Wort-für-Wort-Übertragung aus dem
Hebräischen ins Griechische (wie ja heute noch so manche Schulkinder, bis Computer
vorgehen – wo sie ‚Übersetzen‘/vewrstehen s/wollen) hier noch(mal) drei der wohl wichtigsten, da am
folgenreichsten, Beispiele:
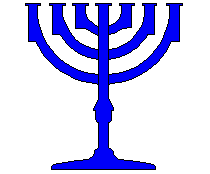 [Falls/Wem
geleugnet / unterschlagen,
äh
‚übersehen‘ ist/wird, dass/wie/wo Normatives weniger (äh
nicht alleine einzig ohne) als Narratives
wirksam – entstehen Eindrücke / Überzeugtheiten: es müsste nur endlich mal klar genug
aufgeklärt/gesagt/gezeigt werden ‚was Fakt/Wahrheit ist‘ und alle seien/würden bekehrt … Sie/Euer
Gnaden ‚wissen-ja-schon‘-Knicks]
[Falls/Wem
geleugnet / unterschlagen,
äh
‚übersehen‘ ist/wird, dass/wie/wo Normatives weniger (äh
nicht alleine einzig ohne) als Narratives
wirksam – entstehen Eindrücke / Überzeugtheiten: es müsste nur endlich mal klar genug
aufgeklärt/gesagt/gezeigt werden ‚was Fakt/Wahrheit ist‘ und alle seien/würden bekehrt … Sie/Euer
Gnaden ‚wissen-ja-schon‘-Knicks]
תורה /thorah/ entspreche/sei νόμος /nomos/ (gar ohne/so
manchen bis gegen) lógos –
einem in/von semitischen
Weisungen ja nicht weniger wesentlich
‚thematisierten‘ Teil; vgl. iwrit/hebräisch
auch: thorat bis et torati – versus theoria) – was eben zumal ‚Gesetz‘
und (gutes/richtiges
Benehmen mit nicht etwa weniger hallachischem/zu-hütendem
Verbindlichkeitsanspruch emblematisiert/suvstituiert durch und von:) ‚Sitte/n‘ heißt,
bis heute (fast nur noch) so unvollständig und allenfalls
einseitig weiterverwendet/gebraucht, und was teilverstanden, für’s/als
Ganze/s – /unwandelbar /
‚auslegungsfrei geistgewirkt‘) determiniert endlich zu vollziehen – gehalten/genommen,
wird; wie es nicht allein, oder nicht erst,
einem (den griechischen ‚hyponomos‘-Begriff dagegen erschaffenden) bis den Apostel/n (namentlich im/mit/um
dem johannäischen Prolog
[zur/anstatt Genesis/bereschit-?]), ergehend-erging. [Nicht empörend genug, dass im ‚Roman‘ äh
‚Gesetz‘ G’ttes beiderlei (הלכה Halacha und H/Aggada א׀הגדה)
enthalten/nötig – erfährt Beides,
zumal (gerade ‚offenbartes‘/dies beanspruchende) Gottes-Wort innerraumzeitlich auf Erden, von und unter
Menschen, anwendende,
äh als Einzahl/singulär
betrachtet optionale/widereinander
wechselnde, Auslegungen/Deutungen] 
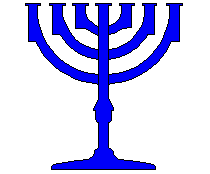 [Auch der Grammatik japhetisch-semitische-Disputationen
sind älter(/tiefergehend-?) als einerseits das christlich-jüdische-Schisma (namentlich
in Sachen; Erlösungsformen äh
Rettungsbedarf aus Gefangenschaft / Schuldsklaverei – ‚gnostisch‘
verschlimmbessert) auf Noa(ch)s
Erbe/Söhne der Menschenheit zurückverweisende
basale/überhaupt Bundesangelegenheit mit/gegenübermächtig äh partnerschaftlich G’tt / הַשֵּׁם – weitereseits ähnlichst(!)
anlässlich geeignet für/wider
Reverenzen oder mehr]
[Auch der Grammatik japhetisch-semitische-Disputationen
sind älter(/tiefergehend-?) als einerseits das christlich-jüdische-Schisma (namentlich
in Sachen; Erlösungsformen äh
Rettungsbedarf aus Gefangenschaft / Schuldsklaverei – ‚gnostisch‘
verschlimmbessert) auf Noa(ch)s
Erbe/Söhne der Menschenheit zurückverweisende
basale/überhaupt Bundesangelegenheit mit/gegenübermächtig äh partnerschaftlich G’tt / הַשֵּׁם – weitereseits ähnlichst(!)
anlässlich geeignet für/wider
Reverenzen oder mehr]
ברית /berit/ entspräche
διαθήκη ![]() /diatheke/,
was zwar griechisch (ähnlich teilzutreffend,
kontrastmaximierend) auch einen
‚Bundesvertrag‘ benennen kann, aber zudem (formell, bis hauptsächlich) die letztwillige Bedeutung
betont, bis hinzufügt, so dass – ebenfalls (bis) heute –
zumeist von ‚Testament‘ (neuem [gar lieber absichtlich-?, äh] wie[der vermeintlich] altem
– anstelle von ‚verhaltensfaktisch ‚wie‘/auf und in
welche/n Arten und Weisen gelebten Bündnissen‘) ‚die Rede/Tat‘ ist – eben innerraumzeitlich beerbbare Tote ... verstellen/verdunkeln
den Blick auf/für beschränkender Selbstverpflichtungen
zuverlässige Erweiterungsauswirkungen. [Die (N. Eliades) Grundstrukltur des Mythos lehrt allerdings, dass Menschen
der Göttersklaven (falls/wem/wo diese tot … Sie wissen schon um/vom emblematisch-iconographischen
Namensänderungen – zumal für/gegen Ähnliches/Schlimmeres), und Frauen … Euer
Gnaden erfahren/erprobem längst selbst] Weder
die ‚christlichen‘, noch die ‚jüdischen‘, noch die ‚muslimischen‘, noch
‚staatsrechtlichen‘ Bündnisvarianten (in einer ihrer, der manche eher überraschenden,
Enstehungsreihenfolgen gelistet) läsen den/die
noachidischen (gar
‚Nimrodisches Paradais‘) auf – überbieten
s/wollen sie (ihn / Thorah anscheinend) allerdings alle.
/diatheke/,
was zwar griechisch (ähnlich teilzutreffend,
kontrastmaximierend) auch einen
‚Bundesvertrag‘ benennen kann, aber zudem (formell, bis hauptsächlich) die letztwillige Bedeutung
betont, bis hinzufügt, so dass – ebenfalls (bis) heute –
zumeist von ‚Testament‘ (neuem [gar lieber absichtlich-?, äh] wie[der vermeintlich] altem
– anstelle von ‚verhaltensfaktisch ‚wie‘/auf und in
welche/n Arten und Weisen gelebten Bündnissen‘) ‚die Rede/Tat‘ ist – eben innerraumzeitlich beerbbare Tote ... verstellen/verdunkeln
den Blick auf/für beschränkender Selbstverpflichtungen
zuverlässige Erweiterungsauswirkungen. [Die (N. Eliades) Grundstrukltur des Mythos lehrt allerdings, dass Menschen
der Göttersklaven (falls/wem/wo diese tot … Sie wissen schon um/vom emblematisch-iconographischen
Namensänderungen – zumal für/gegen Ähnliches/Schlimmeres), und Frauen … Euer
Gnaden erfahren/erprobem längst selbst] Weder
die ‚christlichen‘, noch die ‚jüdischen‘, noch die ‚muslimischen‘, noch
‚staatsrechtlichen‘ Bündnisvarianten (in einer ihrer, der manche eher überraschenden,
Enstehungsreihenfolgen gelistet) läsen den/die
noachidischen (gar
‚Nimrodisches Paradais‘) auf – überbieten
s/wollen sie (ihn / Thorah anscheinend) allerdings alle. 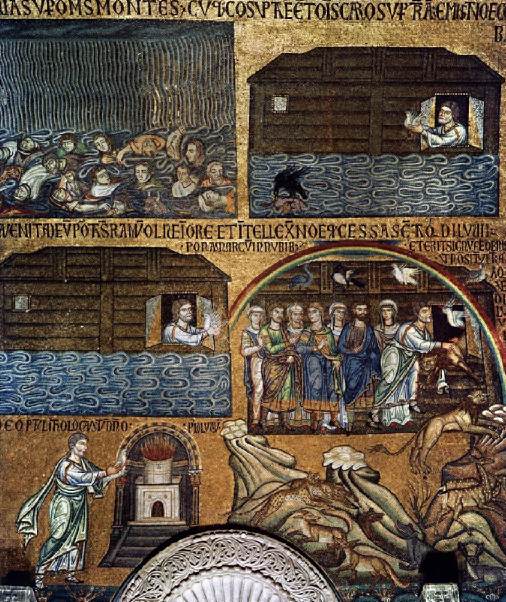
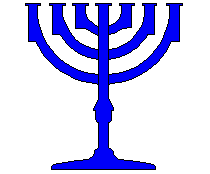 [Ansprüche, Bedürfnisse und Notwendigkeiten ‚der
Herrschaftsausübungen des und/oder der über den und\aber die Menschen‘ sind
nicht dumm/naiv genug auf ihren berühmt
begründenden ‚Markenkern/Wert‘: Fehler, (zumal/zumindest denkerische/theoretische) Unvollkommenheiten
und\aber begangen( festgestellt)e Verfehlungen
– zu verzichten, gar Koordinationsnach-
und Sophrosynevorteile des Zusammenlebens auf Erden eher (erschweren, äh erleichtern s/wollend – ebend) verstellend] Sind kuschittische/meine
Dienstmädchenreflexe noch da-!/?
[Ansprüche, Bedürfnisse und Notwendigkeiten ‚der
Herrschaftsausübungen des und/oder der über den und\aber die Menschen‘ sind
nicht dumm/naiv genug auf ihren berühmt
begründenden ‚Markenkern/Wert‘: Fehler, (zumal/zumindest denkerische/theoretische) Unvollkommenheiten
und\aber begangen( festgestellt)e Verfehlungen
– zu verzichten, gar Koordinationsnach-
und Sophrosynevorteile des Zusammenlebens auf Erden eher (erschweren, äh erleichtern s/wollend – ebend) verstellend] Sind kuschittische/meine
Dienstmädchenreflexe noch da-!/?
Und\Aber zum dritten bleiben
beide Überzeugtheiten Zielverfehlungen: Wofür/Wogegen/Wozu eben das
griechische ἁμαρτία ![]() Hamartia/Hamartie, zwar reduktionistisch, äh (jedenfalls scheinbar holzschnittartig-kontrastmaximal,
bis /t[h]ora[h]/-überbieten s/wollend
klar-/umzäunend-interessiert) ‚vereindeutigend‘, alle
fümf hebräischen Begrifflichkeiten (פשע – עוון – עברה
– חטא
– אשם)
ersetzte – allerdings und immerhin (noch, bis/oder doch-?)
ohne die basalste Sinnverfälschung, äh Deutung,
in/als/zur existenzielle/n
Verfehlung durchs (menschlichen, /he/-basierten-ה zumal da innerraumzeitlich gemeint ‚weltanschaulich‘
gezielten) überhaupt-Daseins – (von
Anderheit / בראשית / Schöpfung – mindestens/sogar mit dem (vom
germanischen Partizip des Seins) ‚Sünde‘
genannt/‚gnostifiziert‘ / ‚Weiblichkeit‘-beschuldigend.
Hamartia/Hamartie, zwar reduktionistisch, äh (jedenfalls scheinbar holzschnittartig-kontrastmaximal,
bis /t[h]ora[h]/-überbieten s/wollend
klar-/umzäunend-interessiert) ‚vereindeutigend‘, alle
fümf hebräischen Begrifflichkeiten (פשע – עוון – עברה
– חטא
– אשם)
ersetzte – allerdings und immerhin (noch, bis/oder doch-?)
ohne die basalste Sinnverfälschung, äh Deutung,
in/als/zur existenzielle/n
Verfehlung durchs (menschlichen, /he/-basierten-ה zumal da innerraumzeitlich gemeint ‚weltanschaulich‘
gezielten) überhaupt-Daseins – (von
Anderheit / בראשית / Schöpfung – mindestens/sogar mit dem (vom
germanischen Partizip des Seins) ‚Sünde‘
genannt/‚gnostifiziert‘ / ‚Weiblichkeit‘-beschuldigend.
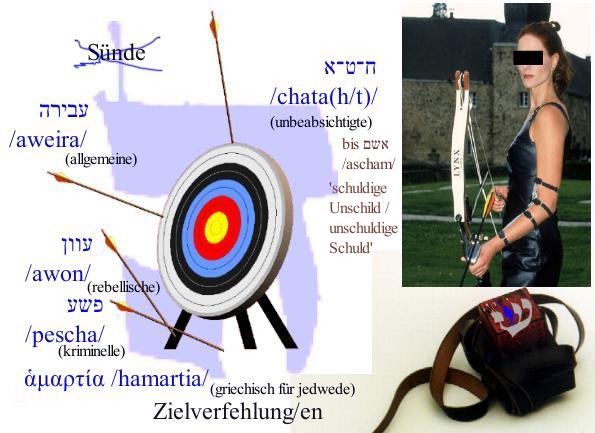 [Unsere gar heftigste der Grafiken sei eben
‚bereits‘ anderswo erläutert/erörtert
worden anstatt entschuldigt] Sogar gerade
unterlassene Reverenzen lassen sich/uns missdeuten!
[Unsere gar heftigste der Grafiken sei eben
‚bereits‘ anderswo erläutert/erörtert
worden anstatt entschuldigt] Sogar gerade
unterlassene Reverenzen lassen sich/uns missdeuten!
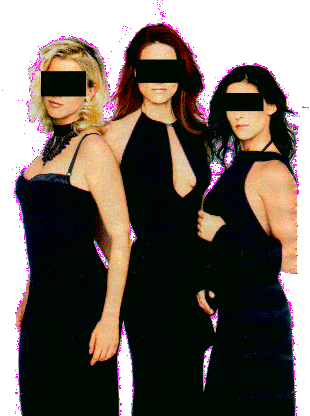 Dass/Falls Menschen lernfähige Versager (Mi.Ko.), ist den/der Einen ‚Lösung‘ und der/des Anderen ‚Problem‘; Dritte setzen auf Versagen, Vierte
hoffen auf LaMeD, äh Andersherums erfahren; doch weiterseits handelt es sich dabei gar
nicht immer nur/allein um dieselben Leute.
Dass/Falls Menschen lernfähige Versager (Mi.Ko.), ist den/der Einen ‚Lösung‘ und der/des Anderen ‚Problem‘; Dritte setzen auf Versagen, Vierte
hoffen auf LaMeD, äh Andersherums erfahren; doch weiterseits handelt es sich dabei gar
nicht immer nur/allein um dieselben Leute.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sie haben die Wahl: |
||||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
Goto project: Terra (sorry still in German) |
|
|||
|
Comments
and suggestions had always been welcome (at webmaster@jahreiss.eu) Kommentare und Anregungen waren jederzeit willkommen (unter: webmaster@jahreiss.eu) |
|
||||
|
|
|||||
|
|
|
||||
|
|
|
|
|||
|
|||||
|
by
|