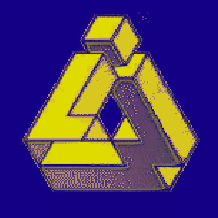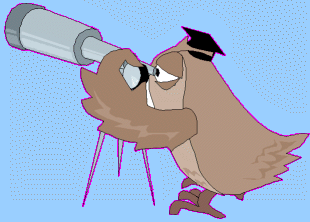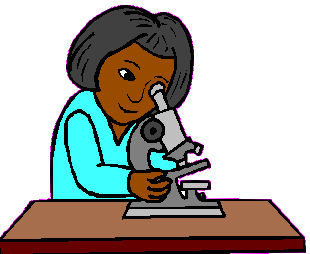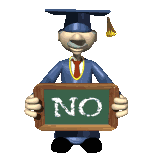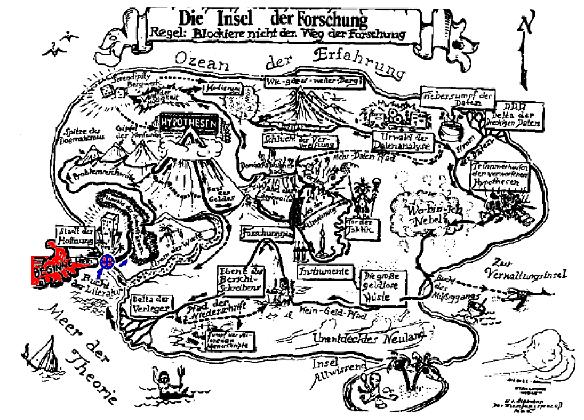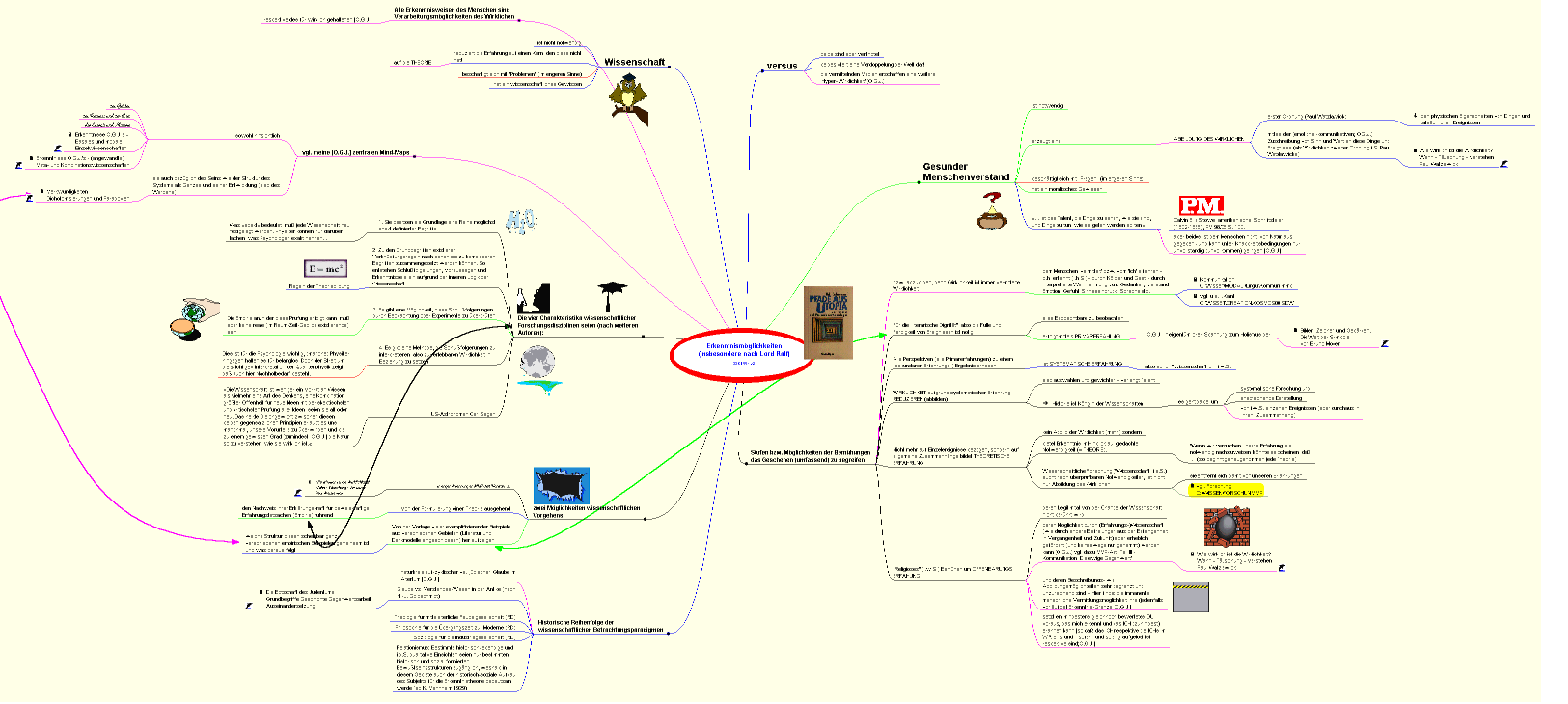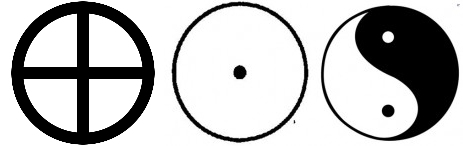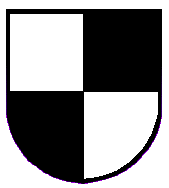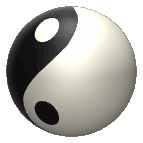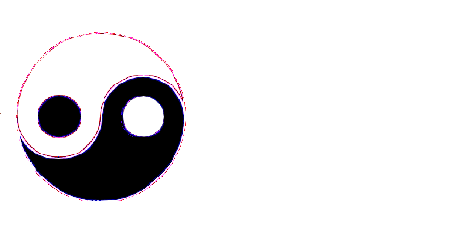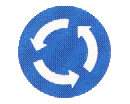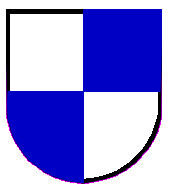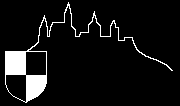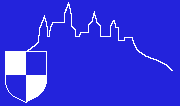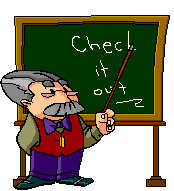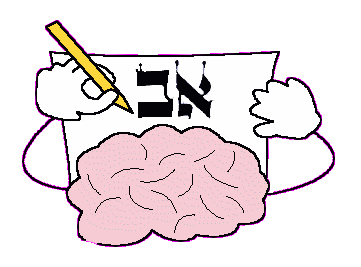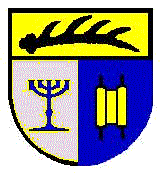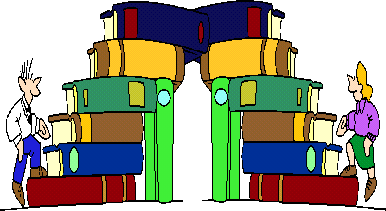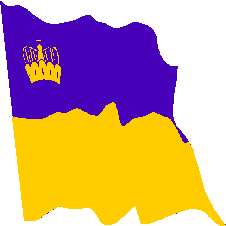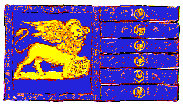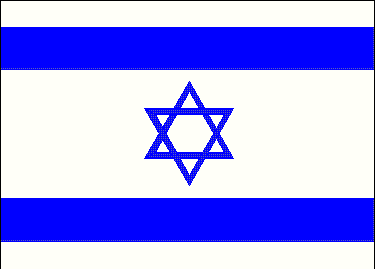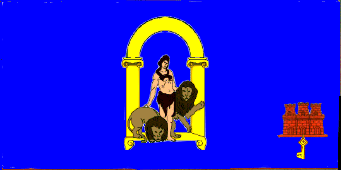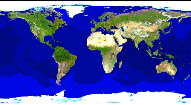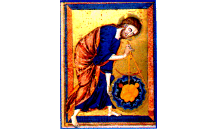Roter Salon 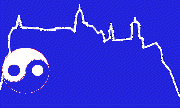 und (zwischen weißem bis schwarzem Rauschen, immerhin rose) Korridore
und (zwischen weißem bis schwarzem Rauschen, immerhin rose) Korridore
|
Analytische Modalität – des Zugeständnisses
bis Vergehens, dass immerhin der ordnende/geordnete Mensch
all das Vorfindliche / Empirische zu dem
er, und gar alle, selbst auch mit gehören
könnte/n, denkend und/oder handelnd (womöglich unausweichlich) in
(‚immerhin‘
|
Gleich bis stets mehrere 'Zugänge' ermöglichen (gar Bewusstheit/en) in diesen, jedenfalls aber aus diesem, gar durchaus mehrerseits und verschieden lichten, Empfangsraum zu gelangen. Und insbesondere respektive zumindest, sogar türlos offen bleibend, durch das/sein analytisches Rot hindurch in's Schwarzgrau und eben auch affirmativ von unvermeidlichen, allenfalls reflektierbaren Gefühlen her - sowohl einen der roseroten Koridore und/aber (quasi/scheinbar 'entgegengesetzt') komplementär, narrativ in die/aus der Historie ('Gegenwart/en').zu (i.w.S.) 'denken'. |

 [Ob das, immerhin Rauch-dichte, Schiebetürenportal zwischen den beiden lebensgroßen
[Ob das, immerhin Rauch-dichte, Schiebetürenportal zwischen den beiden lebensgroßen ![]() Bildern mit dem Schwarzen
Salon geschlossen gehalten …]
Bildern mit dem Schwarzen
Salon geschlossen gehalten …]
|
Nein, wer – gerade besonders streng
wissenschaftlich – forscht,
muss dazu/dabei nicht notwendigerweise Erkenntnistheorie betreiben / muss kein qualifiziertes Wissen
über das Erkennenkönnen schaffen. |
Auch uneingestandenermassen, bis
geradezu peinlicherweise, genügt (anstatt erübrigte) es, sich dafür tradierten
Denkformen und anerkannten Metoden zu unterwerfen, äh (diese dabei/damit) zu bedien. |
Nur wer dabei/dazu aber – namentlich indem und wo Aussagen über das Gamze empirisch Vorfindliche (oder gar überhaupt Mögliches) gemacht, bis behauptet
werden – Erkenntnisthorie betreibt, sollte dabei
sehr vorsichtig sein – wenigstens die philosophischen
Regeln nicht selektiv passend (zu) verachten. |
 [Sogar gelehrt belehrte ... können ‚wissen‘/erkennen,
dass der Rote Salon des abgebildeten
[Sogar gelehrt belehrte ... können ‚wissen‘/erkennen,
dass der Rote Salon des abgebildeten ![]() analogisierten Schlosses, als typisches Werk Emanuel von Seides, des Baumeisters des neuen Ostflügels von
1895/96 gilt: Sieben Gemälde an hellroten Wänden und
jene/s blaue/n der Decke,
mindestens drei sogar erkennbare Türöffnungen und
analogisierten Schlosses, als typisches Werk Emanuel von Seides, des Baumeisters des neuen Ostflügels von
1895/96 gilt: Sieben Gemälde an hellroten Wänden und
jene/s blaue/n der Decke,
mindestens drei sogar erkennbare Türöffnungen und  ein Kamin unterm Relief, kontemplativ lachender Gelehrter, im Blickfeld ihrer (auch
wissenschaftlichen) Majestät der Geschichte, ‚zwischen‘ vier
wohlgepolsterten Sitzbänken mit Instrumentenfächern,
ein Kamin unterm Relief, kontemplativ lachender Gelehrter, im Blickfeld ihrer (auch
wissenschaftlichen) Majestät der Geschichte, ‚zwischen‘ vier
wohlgepolsterten Sitzbänken mit Instrumentenfächern,  an
den Längsseiten des Raumes – könnten verschieden erklärt, bis mehrfach – und/oder (dürfen sogar!)
widersprüchlich – verstanden, werden]
an
den Längsseiten des Raumes – könnten verschieden erklärt, bis mehrfach – und/oder (dürfen sogar!)
widersprüchlich – verstanden, werden]

 [… oder
geöffnet – unter- bis entscheidet über so manch Wesentliches
[… oder
geöffnet – unter- bis entscheidet über so manch Wesentliches ![]() mit] Ordem(sfigur) in der Abendhandtasche-!/?/-/.
mit] Ordem(sfigur) in der Abendhandtasche-!/?/-/.
 ‚Ups‘-Klämge
und Ein- bis Missstimmungen und sonstige Peinlichkeiten kaum auszuschließen.
‚Ups‘-Klämge
und Ein- bis Missstimmungen und sonstige Peinlichkeiten kaum auszuschließen.
 Spätestens da
/ Jedenfalls wenn Realität(en) – zumindest was unsere /
teilnehmend beobachtenden
Spätestens da
/ Jedenfalls wenn Realität(en) – zumindest was unsere /
teilnehmend beobachtenden ![]() Wahrnehmung/en angeht – von aspektischem
Charakter, (gar manchen erstaunlich) unabhänig davon, ob, bis wie, über immerhin
Wahrnehmung/en angeht – von aspektischem
Charakter, (gar manchen erstaunlich) unabhänig davon, ob, bis wie, über immerhin ![]() grammatisch(
repräsentiert)e Vorfindlichkeiten hinausgehend (so dass manch philosophisches Schisma weniger wesentlich), sind Reduzierungen / Fokusierungen darauf möglich, bis
nützlich, oder ups-nötig. Weder
notwendigerweise immer nur auf
einzelne Aspekte konzentriert, noch stets rundum auf alle – wobei bis wogegen,
beides durchaus (oft strittig, bis zumeist ‚logisch‘-widersteitend
grammatisch(
repräsentiert)e Vorfindlichkeiten hinausgehend (so dass manch philosophisches Schisma weniger wesentlich), sind Reduzierungen / Fokusierungen darauf möglich, bis
nützlich, oder ups-nötig. Weder
notwendigerweise immer nur auf
einzelne Aspekte konzentriert, noch stets rundum auf alle – wobei bis wogegen,
beides durchaus (oft strittig, bis zumeist ‚logisch‘-widersteitend ![]() empfunden/gedacht
empfunden/gedacht![]() ) behautet / vermeint
) behautet / vermeint
![]() wird.
wird.
[‚Damaliger‘![]() Bekleidungsangelegenheiten
– hier
namentlich ihrer ‚weiten Röcke/Individualdistanzen‘
Hoheitlichem
Bekleidungsangelegenheiten
– hier
namentlich ihrer ‚weiten Röcke/Individualdistanzen‘
Hoheitlichem ![]() (Ein- bis Übergreifen?)
gegenüber /kenegdo/ – wegen
hatten bekanntlich einst höchstens/doch drei ‚passend
bekleidete Frauen‘ gemeinsam
Platz, auf #einer# der beiden großen# ‚Bänke‘, in
diesem – beinahe ‚zentralen‘ –
immerhin Warteraum, ‚vor‘ (bis denkempfindbar sogar/gerade ‚über‘) dem
(Ein- bis Übergreifen?)
gegenüber /kenegdo/ – wegen
hatten bekanntlich einst höchstens/doch drei ‚passend
bekleidete Frauen‘ gemeinsam
Platz, auf #einer# der beiden großen# ‚Bänke‘, in
diesem – beinahe ‚zentralen‘ –
immerhin Warteraum, ‚vor‘ (bis denkempfindbar sogar/gerade ‚über‘) dem ![]() zentralen Speisezimmer
tastsächlich fientisch bund zusammenfallenden Geschehens]
zentralen Speisezimmer
tastsächlich fientisch bund zusammenfallenden Geschehens] 
Der insofern ‚spärlich, respektive meist nur an
den Wänden möbilierte‘ Raum, wirke besonders großzügig – zumal leer /
unvorhanden erscheint was dieses ![]() ‚paradoxe (beinahe)
Zentrum‘ ausmacht/einimmt.
‚paradoxe (beinahe)
Zentrum‘ ausmacht/einimmt.
 [Der /
kaum-ganz-so-singuläre \ menschenheitliche Verstand zerlege jene/s Ganze/n,
dem, bis denen, er/Sie selbst
(in Anlehnung
an C.F.v.W.) ‚zugehörig‘, in (zumal Vernunften-)Teile um-zu sie/Es, bis
sich, begreifend
zu-um verstehen]
[Der /
kaum-ganz-so-singuläre \ menschenheitliche Verstand zerlege jene/s Ganze/n,
dem, bis denen, er/Sie selbst
(in Anlehnung
an C.F.v.W.) ‚zugehörig‘, in (zumal Vernunften-)Teile um-zu sie/Es, bis
sich, begreifend
zu-um verstehen]  Sphärenblasenanalogien
interessierter Denkunterteilungs- und Einteilungsverhalten. [Analytische Philosophie/Theologie untersucht inzwischen
Sphärenblasenanalogien
interessierter Denkunterteilungs- und Einteilungsverhalten. [Analytische Philosophie/Theologie untersucht inzwischen ![]()
![]() ‚Sprachen / Repräsentationen
‚Sprachen / Repräsentationen
![]() (im weitest-umfassendsten Sinne)‘,
(im weitest-umfassendsten Sinne)‘, ist weder Ontologie, noch
Erkenntnistheorie, sondern auch diese bemerkend/befragend ![]() ] ‚Geist versus Materie‘ und
umgekerte
] ‚Geist versus Materie‘ und
umgekerte ![]() pistische Hyperkonfrontationen – zumal von (entweder
beobachtet/fühlbar) Konkretem wider (begrifflich/denkerisch) Abstraktem – verstellen und verdunkeln Menschen als beeinflussende
und\aber beeinflusst werdende Aktionszentren gegenüber
Empirischem aus all dem Gemeinten.
pistische Hyperkonfrontationen – zumal von (entweder
beobachtet/fühlbar) Konkretem wider (begrifflich/denkerisch) Abstraktem – verstellen und verdunkeln Menschen als beeinflussende
und\aber beeinflusst werdende Aktionszentren gegenüber
Empirischem aus all dem Gemeinten. 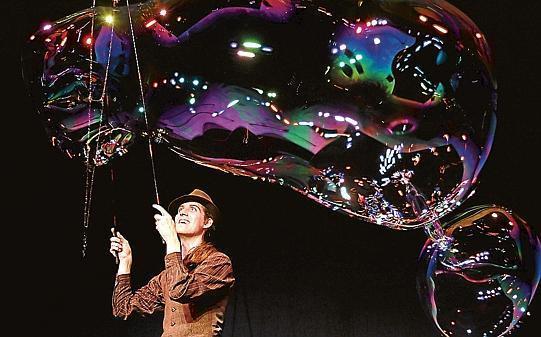
 [
[![]() ‚Klatsch
/ KGB-Majorin Amasova (schauspielerisch
1976 Barbara Bach) als Triple-X
mit Wesentlichkeiten-
‚Klatsch
/ KGB-Majorin Amasova (schauspielerisch
1976 Barbara Bach) als Triple-X
mit Wesentlichkeiten-![]() -Ordensfigur des Seins/werdens‘]
-Ordensfigur des Seins/werdens‘]  Grammatikalische
Ref/verenzen zwar nicht
los geworden, doch bereits weder ‚seine Magd‘ noch ‚Atistoteles‘ selbst,
Grammatikalische
Ref/verenzen zwar nicht
los geworden, doch bereits weder ‚seine Magd‘ noch ‚Atistoteles‘ selbst, ![]()
mussten ‚begriffliche‘
Ahnungen bemerkend anerkennen/ablehnen ![]() – schon gar nicht
deckungsgleich übereinstimmend. [Zumindest ‚scheinbar‘
so mit J.O.y.G., andere etwa Materealismen meinen ‚anscheinend‘ –
hängen/kommen
Technologien ‚causal‘ mit-בְּ Reduktionismen der/von
Komplexitäten zusammen/vor]
– schon gar nicht
deckungsgleich übereinstimmend. [Zumindest ‚scheinbar‘
so mit J.O.y.G., andere etwa Materealismen meinen ‚anscheinend‘ –
hängen/kommen
Technologien ‚causal‘ mit-בְּ Reduktionismen der/von
Komplexitäten zusammen/vor] ![]() #jojo
#jojo 
 [«Honi soit qui mal y pense»]
[«Honi soit qui mal y pense»]
Gewährsmann japhetischen![]() [ sprachkultursphärisch ‚abendländisch‘ zumal ]griechischen Denkens / Philosophierens
für das – später zumeist #hier
[ sprachkultursphärisch ‚abendländisch‘ zumal ]griechischen Denkens / Philosophierens
für das – später zumeist #hier![]() Willhelm von Ockham
uigeschreibene – #hier
Willhelm von Ockham
uigeschreibene – #hier![]() Rassiermesserprinzip ‚in der / für die Wissenschaft
möglichst wenige(! anstatt
Rassiermesserprinzip ‚in der / für die Wissenschaft
möglichst wenige(! anstatt keine) axiomatisch voraussetzende
Annhemen machen zu s/wollen‘,bemerkte,
unterschied und (aner)kannte (דעה bis ת)דע viererlei דלד׀ת verschiedene Causa
formalis (‚Formursache‘). Causa materialis (‚Stoffursache‘). Causa effiziens
(‚Wirkuesache‘) und Causa finalis (‚Ziel-
respektive Zweckursache‘) der/für ‚Kausalitätsfanier‘/Menschenheit.
 [Bemerkte erst, äh schon, Aristoteles ‚Okkhams Rassiermesser‘ – wider
‚Ideenwirbel‘]
[Bemerkte erst, äh schon, Aristoteles ‚Okkhams Rassiermesser‘ – wider
‚Ideenwirbel‘]

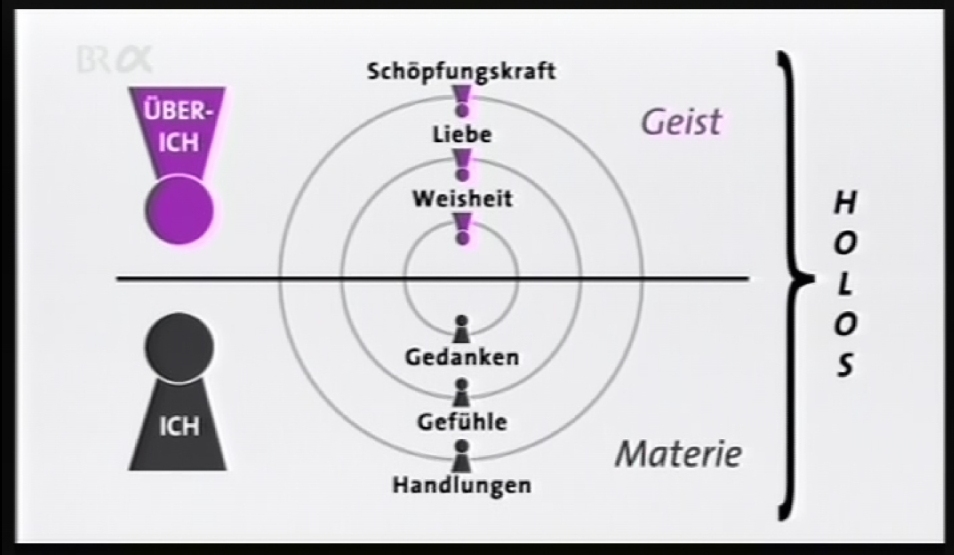 [Holzschnittartig
kontrastklare, schattenrisshafte Deutlichkeit/en
werden nicht nur von Dingen/\Worten
gegnüber/vor Umgebung(srausch)en erwarttet – bis durch Kontrastfolien
suggeriert, sondern auch mit Ereignissen oder zumindest Einflüssen darauf vermischt/verwechselt]
[Holzschnittartig
kontrastklare, schattenrisshafte Deutlichkeit/en
werden nicht nur von Dingen/\Worten
gegnüber/vor Umgebung(srausch)en erwarttet – bis durch Kontrastfolien
suggeriert, sondern auch mit Ereignissen oder zumindest Einflüssen darauf vermischt/verwechselt]
![]() [Allerdings
bleibt ausgerechnet
Mathematik eine
Geisteswissenschaft]
[Allerdings
bleibt ausgerechnet
Mathematik eine
Geisteswissenschaft] 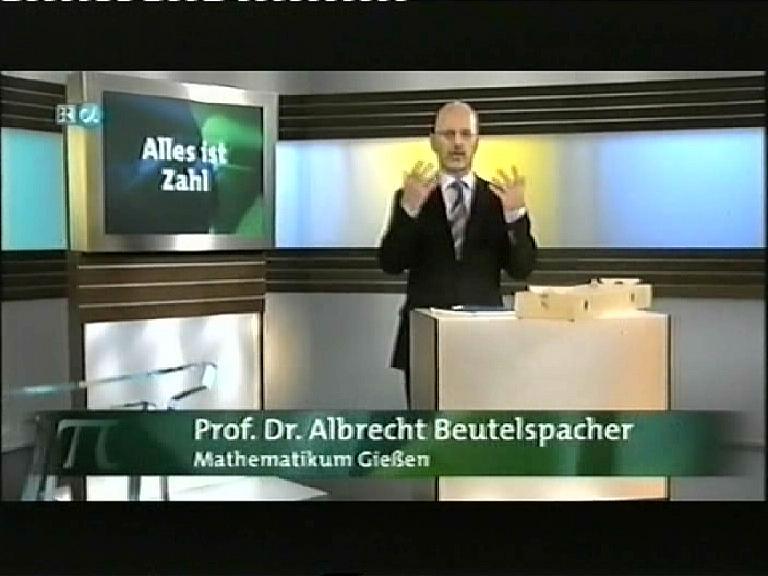
Abb,ROB-kniend-sooping
Noch so artiges/vollendetes ‚Denken‘ läuft (zumal ‚sich & andere‘, äh göttliche / partikuläre
/ vernünftige / universelle Prinzipien) weiter (‚indoeuropäisierende
/ vereinzigende‘: Kernaxiomatik, äh Bekenntnisreflex-/ErKennungsformel: ‚Alles ist Zahl / Sprache / Grammatik‘) Gefahren, äh/ups
Gewissheiten, sein Wissen bis und/folglich Können für (jedenfalls bald) allumfassend
vollständig(en Überblick – des im [eigen bis gemeinsam]
verfügbaren Licht Findbaren) zu
haltem. [‚Aus/Im/Durch‘, einander zumal methodisch
und begrifflich wechselseitig (vielleicht bis aufinnen-s09.html
![]() sogenannte
‚Natuirwissenschaften‘, oder immerhin in Staasexamina) bestreitbaren /
abgesprochenen ‚Einleuchten / Lichtkegel‘]
sogenannte
‚Natuirwissenschaften‘, oder immerhin in Staasexamina) bestreitbaren /
abgesprochenen ‚Einleuchten / Lichtkegel‘]
Dass, nein ‚wie sehr‘
ursächlich, der Reduktionismus keine (blose – da Alternativen zulassen dürfend/e) Sichtweise sei,
leuchtet immerhin jenen ein (bis ‚und heim‘),  die absolut
/ vereinzigend davon überwältigt, äh überzegt,
sind / werden: keine Wahl zu haben / treffen!
die absolut
/ vereinzigend davon überwältigt, äh überzegt,
sind / werden: keine Wahl zu haben / treffen!
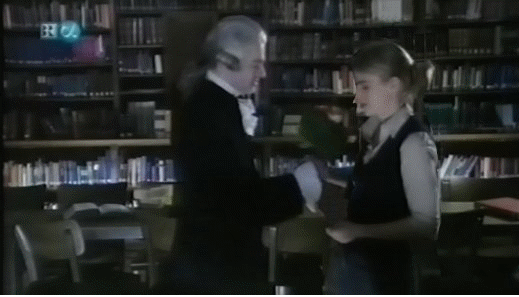 Mancher
punktartig beginnender Kellerfalte linke und rechte Seite werden auch wieder
zusammengeführt – bleiben nur an manchen Beinkleider unten getrennt. [Die
strengste Genauigkeit / Disziplin der Kellerfalte-Emblematik kamm und muss
nicht verbergen, dass ‚sie‘ immer bereits zwei Falten ‚aufteilt / verbindet‘]
Mancher
punktartig beginnender Kellerfalte linke und rechte Seite werden auch wieder
zusammengeführt – bleiben nur an manchen Beinkleider unten getrennt. [Die
strengste Genauigkeit / Disziplin der Kellerfalte-Emblematik kamm und muss
nicht verbergen, dass ‚sie‘ immer bereits zwei Falten ‚aufteilt / verbindet‘]
‚Geist und
Materie‘ / ‚Denken
und (sonstiges)
Handeln‘ sind weder (logisch rein zweiwertiges / dual vorausgesetztes) Entweder-Oder, noch ‚polare‘ Summenverteilung oder ‚spektrale‘ Verdrängungsprozesse: Manchen Menschen konnte bereits
Immanuel Kant zeigen, dass weder purer
‚Empirismus‘ (nicht nur
von manchen Anhängerinnen/Gegnern für ‚nakte Fakten
/ objektive Tatsachen‘ gehalten,
oder eben ‚bestritten‘) noch purer ‚Idealismus‘ (nicht allein bei/seit Plato,
respektive Sokrates, gar ‚asketisch‘
mit ‚reinen Ideen-Welt‘-Lehren vermischt) ausreichen.
 [Wohl am Wesentlichsten /
Wichtigsten dienen dreifache Reduzierungen / Teilmengen der ups Meinungen
dem Anspruch zu qualifiziertem Erkentnissen, bis Wissen (im engeren Sinne
– eben überzegt behaupteten und denk-logisch begründetem plus realita widerlegbasrem. Gar in mamcher Analogie mit/zu ‚systemtheoretisch‘
unterstelltem Meinens), gelangen zu können] ‚Naturgesetze‘
& Consaorten seind weder (die) Gesetze (der), noch jene für/wider (die), Natur
– sondern fortschreitende Denkergebnisse
menschlicher Regelmäßigkeiten-Beobachtung/Mustererkennungen.
[Wohl am Wesentlichsten /
Wichtigsten dienen dreifache Reduzierungen / Teilmengen der ups Meinungen
dem Anspruch zu qualifiziertem Erkentnissen, bis Wissen (im engeren Sinne
– eben überzegt behaupteten und denk-logisch begründetem plus realita widerlegbasrem. Gar in mamcher Analogie mit/zu ‚systemtheoretisch‘
unterstelltem Meinens), gelangen zu können] ‚Naturgesetze‘
& Consaorten seind weder (die) Gesetze (der), noch jene für/wider (die), Natur
– sondern fortschreitende Denkergebnisse
menschlicher Regelmäßigkeiten-Beobachtung/Mustererkennungen. 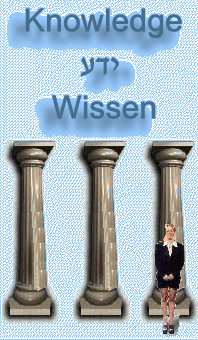 Auch da/falls
es sich bei Wissen (und gleich gar Wissemschaften) eben nicht um
jenen gesicherten, mmolitischen, ontoöogischen Autoritätsblock handeln kann –
den spätestens ‚anleitende Medien‘ (genauer: ‚Politik und Publizistik‘ – inklusive
wissenschaftstheoretisch widerlegter Literatur falscher, also weiter
vorherschender, Wissenschaftserwartungen und Forschungsvorstellungen, zumal gebildeter und infornierter,
Bevölkerungen) weiterhin darin sehen / daraus, bis dazu, zu machen
trachten. [Verstöbdlicher allerdings
Herrschaftsbedarf – zumal angesichts dessen, wie veile Leute ihre eigene(r
Bezugsgruppe-)Meinung, wie häufig auch wider besseres
Wissen (Können bis Tun), besser gefällt / verhaltensrelevant]
Auch da/falls
es sich bei Wissen (und gleich gar Wissemschaften) eben nicht um
jenen gesicherten, mmolitischen, ontoöogischen Autoritätsblock handeln kann –
den spätestens ‚anleitende Medien‘ (genauer: ‚Politik und Publizistik‘ – inklusive
wissenschaftstheoretisch widerlegter Literatur falscher, also weiter
vorherschender, Wissenschaftserwartungen und Forschungsvorstellungen, zumal gebildeter und infornierter,
Bevölkerungen) weiterhin darin sehen / daraus, bis dazu, zu machen
trachten. [Verstöbdlicher allerdings
Herrschaftsbedarf – zumal angesichts dessen, wie veile Leute ihre eigene(r
Bezugsgruppe-)Meinung, wie häufig auch wider besseres
Wissen (Können bis Tun), besser gefällt / verhaltensrelevant] 
Warum und
wozu auch immer, welcher / wessen Wissenserwerb hiermit und von
‚Strumpfbändern‘ kyperrealisiert / symbolisiert wird.  Recht dicht gefolgt vom später Willkem von
Ockham, als ‚Rassiermesser‘ zugeschrieben, bei/seit Aristoteles streitbar
belegten, Prinzip, als und für Erklärungen / eine
Theorie immer nur die minimalst notwendigen, am wenigsten weitgehenden Hypothesen annahmen / finden
/ prüfen zu dürfen(!);
Recht dicht gefolgt vom später Willkem von
Ockham, als ‚Rassiermesser‘ zugeschrieben, bei/seit Aristoteles streitbar
belegten, Prinzip, als und für Erklärungen / eine
Theorie immer nur die minimalst notwendigen, am wenigsten weitgehenden Hypothesen annahmen / finden
/ prüfen zu dürfen(!);  obwohl bis wogegen (nicht alleine etwa aus
polizeilichen Ermittlungen von Tathergängen) bekannt, dass wenig Repräsentiertes, bis nichts
Reales, so einfach ist, wie es Abbildungen / Begreifen / Denken / Reden / Verständnisse
manchmal, bis häufig, scheinen lassen s/wollen,
bis mögen.
obwohl bis wogegen (nicht alleine etwa aus
polizeilichen Ermittlungen von Tathergängen) bekannt, dass wenig Repräsentiertes, bis nichts
Reales, so einfach ist, wie es Abbildungen / Begreifen / Denken / Reden / Verständnisse
manchmal, bis häufig, scheinen lassen s/wollen,
bis mögen. 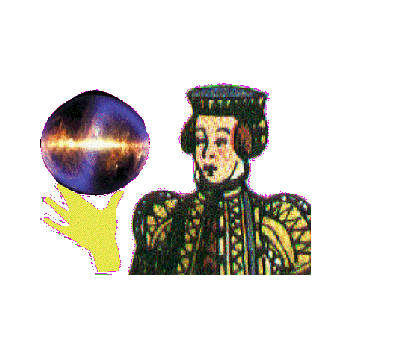 [‚Höherverschachtelungen‘ / ‚Offenheiten‘ gleich gar aus flachländisch auf ‚schwarz# oder/auf Rückseite
weiß‘ reduzioerten Holzschittkontrastklarheiten
fallen allzumeist schwehr]
[‚Höherverschachtelungen‘ / ‚Offenheiten‘ gleich gar aus flachländisch auf ‚schwarz# oder/auf Rückseite
weiß‘ reduzioerten Holzschittkontrastklarheiten
fallen allzumeist schwehr]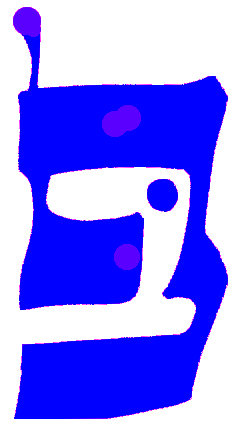
 Sprachanalytisch
kommen solche
Sprachanalytisch
kommen solche ![]() [Grammatika/Sprachen] auch ohne (den/einen/jeden/alle grammatikalische/n) Artikel und ohne Einzahl (wenn auch nummerierfähig)‚aus‘ /
daher; Ist/Wird alles überhaupt Vorfindliche, oder
bereits das!( Alls&teils!) davon immerhin Erkennbare, Menschen
derart zu-viel, dass sie ‚vom/von
Ganzen‘ zu denken / reden trachten-!/?/-/. [Daran ‚vor lauter Bäumen den Wald nicht zu
sehen‘ ist allerdings – für manche (zumal
‚Idealisten‘, äh
[Grammatika/Sprachen] auch ohne (den/einen/jeden/alle grammatikalische/n) Artikel und ohne Einzahl (wenn auch nummerierfähig)‚aus‘ /
daher; Ist/Wird alles überhaupt Vorfindliche, oder
bereits das!( Alls&teils!) davon immerhin Erkennbare, Menschen
derart zu-viel, dass sie ‚vom/von
Ganzen‘ zu denken / reden trachten-!/?/-/. [Daran ‚vor lauter Bäumen den Wald nicht zu
sehen‘ ist allerdings – für manche (zumal
‚Idealisten‘, äh ![]() ‚lückenhaft-stückweisem Erlennen‘) erstaunlich – wenig/nur
falsch/parttikular Umgebungen (dauerhaft punktförmig folusiert)
zu ‚übersehen‘! Empirisch sind nämlich
bekanntlich
‚lückenhaft-stückweisem Erlennen‘) erstaunlich – wenig/nur
falsch/parttikular Umgebungen (dauerhaft punktförmig folusiert)
zu ‚übersehen‘! Empirisch sind nämlich
bekanntlich ![]() viele (respektive weniger, oder
zumindest andere, werdende) Bäume und sonstige (zu bestimmende – ebenfalls
individuell sterbliche) Lebewesen ‚im Gelände‘
viele (respektive weniger, oder
zumindest andere, werdende) Bäume und sonstige (zu bestimmende – ebenfalls
individuell sterbliche) Lebewesen ‚im Gelände‘ ![]() vorzufinden;
vorzufinden; ![]() und-וו weitgehend unabhängig davom (doch durch Verhaltenssubjekte durchaus darauf ein- bis
rückwirkend) existierende / eingeführte
und-וו weitgehend unabhängig davom (doch durch Verhaltenssubjekte durchaus darauf ein- bis
rückwirkend) existierende / eingeführte ![]() Begrifflichkeiten
/ Beobachrtungen / Messwerte dafüt/davon (nicht einmal notwendigerweise
im Singular, wie etwa sino-tibetische Denkweisen/Sprachen belegen) brauchen nicht bestriiten, oder verborgen, zu werden,
Begrifflichkeiten
/ Beobachrtungen / Messwerte dafüt/davon (nicht einmal notwendigerweise
im Singular, wie etwa sino-tibetische Denkweisen/Sprachen belegen) brauchen nicht bestriiten, oder verborgen, zu werden, ![]() obwohl
‚darüber‘ (‚Molekül‘, … ‚Baum‘, ‚Berg‘ pp.) hinausgehende Emergenzen,
wie ‚Wald‘ oder ‚Gebirge‘, immerhin in/auf Karten und sonstigen Dokumenten
verzeichnet (und ‚in Landschaften auf Erden‘) zu finden sind,
obwohl
‚darüber‘ (‚Molekül‘, … ‚Baum‘, ‚Berg‘ pp.) hinausgehende Emergenzen,
wie ‚Wald‘ oder ‚Gebirge‘, immerhin in/auf Karten und sonstigen Dokumenten
verzeichnet (und ‚in Landschaften auf Erden‘) zu finden sind, ![]() und/aber so
etwas wie wissenschaftlich ‚Biotop‘- oder ‚Ökosysteme‘-Genanntes, gedadezu bedrohbar erscheinen, äh gefährdet sind (gilt das/deren/dies Überlebensisiko
den botanischen/humanoiden/zoologischen Bewohnerinnen und
Bewohnerm daselbst [individuell und zusammen], bis überhaupt)] Zudem verzeichnen etwa Karten nicht notwendigerweise nur terreswtrische
Territorien: Also wo liegen nochmal die ‚Langhanschen Inseln‘?
und/aber so
etwas wie wissenschaftlich ‚Biotop‘- oder ‚Ökosysteme‘-Genanntes, gedadezu bedrohbar erscheinen, äh gefährdet sind (gilt das/deren/dies Überlebensisiko
den botanischen/humanoiden/zoologischen Bewohnerinnen und
Bewohnerm daselbst [individuell und zusammen], bis überhaupt)] Zudem verzeichnen etwa Karten nicht notwendigerweise nur terreswtrische
Territorien: Also wo liegen nochmal die ‚Langhanschen Inseln‘? 
Eine
veritable Schwierigkeit
(Morbus, gar mono-)kausalitischer,
doch gerade auch unabwendlich
bemötigter, Verinfachung/en (פשע äh פשט – aus
ein-eindeutig genormter, äh
genommener, Wortwörtlichkeiten) liegt ja darin, die maximal
kontrastklar erreichte punktförmige Fokusierung / Konzentration (zumal auf den einzelnen Bildpunkt
des Monitors oder der Netzhautzelle des Auges) nicht durch prinzipielles mehr-desselben-Reduktionismus höherverschachtelnd verlassen zu können/dürfen/wollen.
Eine der wesentlichen ‚hollistischer‘,
sich ‚ganzheitlich‘ gebendender / empfindender
Argumentationsmuster-Schwierigkeiten
verfängt sich in der bliebten Falle: zu erwähnen, ‚dass das alles sehr
viel komplizoerter sei (zumal als man denke / als
all die anderen dächten)‘; un dann zu enthüllen, ‚dass es (in Tat
und Wahrheit) vielmehr an ‚xy‘, eben an/wem anderem – doch keineswegs weniger
vereinzelt, bis monadisch, reduziert gedacht/gemacht – liege – anstatt wenigstens
die (wohl fünfzehn – darunter eben analythische Wahloptionen selbst) modalen
Aspekte abarbeitend zu refkektieren / den eigenen Überblick (namentlich in seinen/meinen
Begrenzheiten – äh viel zu zeitaufwendig und angeblich längst allen ‚Gutwilligen‘
hinreichend vollständig bekannt) offenzulegen.
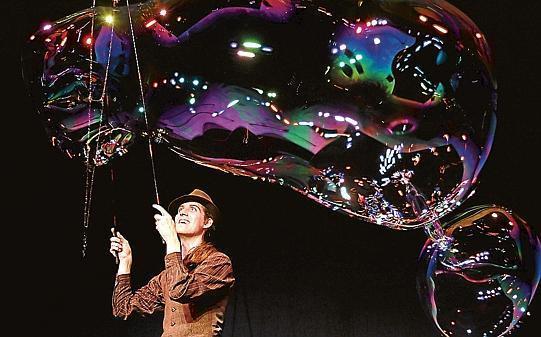 [Bekanntlich vemerkte
[Bekanntlich vemerkte ![]() Carl Friederich v. Weizäcker: „Es ist
der menschliche Verstand, der jenes Ganze zu dem er selbst
gehört in Tiele zerlebt, um es“, und zwar durchaus in/mit der „begreifend“-Ergänzung,
etwa Richard Heinzmanns, „zu vesrtehen.“/verwenden]
Weder aufgrund
von Genesis 3,
noch weil ‚sie‘ gefärden (können) und irren (dürfen) sind / werden ‚Erkentnisse‘
/ Menschen – oder manch( bestimmbar)e
davon äh falsche – unzulässig. Abb.-Klemmsteine-Hovercraft-auf-grund-Land-gefahren??
Carl Friederich v. Weizäcker: „Es ist
der menschliche Verstand, der jenes Ganze zu dem er selbst
gehört in Tiele zerlebt, um es“, und zwar durchaus in/mit der „begreifend“-Ergänzung,
etwa Richard Heinzmanns, „zu vesrtehen.“/verwenden]
Weder aufgrund
von Genesis 3,
noch weil ‚sie‘ gefärden (können) und irren (dürfen) sind / werden ‚Erkentnisse‘
/ Menschen – oder manch( bestimmbar)e
davon äh falsche – unzulässig. Abb.-Klemmsteine-Hovercraft-auf-grund-Land-gefahren??
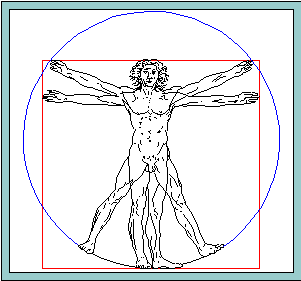
[waw װ
#hier https://de.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci ![]() der
Universalgelehrte bemerke: „Gib einen Menschen zwei unzusammenhängende Gedanken und etwas Zeit, so
wird er eine Verbindung finden – er kann gar nicht anders.“
der
Universalgelehrte bemerke: „Gib einen Menschen zwei unzusammenhängende Gedanken und etwas Zeit, so
wird er eine Verbindung finden – er kann gar nicht anders.“ ![]()
![]()
![]()
![]()
![]() .......
.......![]()
![]() ..
..![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ]
]
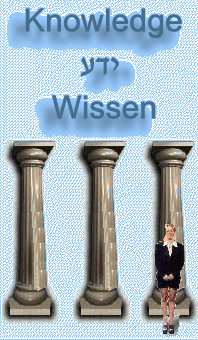 Durch dreierlei Begrenzungen qualifiziertes
wissen ‚besteht‘ mindestens zu den beiden Teilen meig oder minder kontrasklar
deutlich dargestellen überzeugten und\aber zumal trotz Gegenargumenten
begründeten Meines. aus/in denkerischen Aspekten, wobei und wohu ja auch seine empirische
wiederlegbarkeit in/an Realitäten nicht so ganz ohne kognitives Wahrnehmen aus-
oder zustande kommt (gleich gar ignoranntes oder sogar
unmöglihes/ausgeschlossenes ‚berücksichtigend‘).
Durch dreierlei Begrenzungen qualifiziertes
wissen ‚besteht‘ mindestens zu den beiden Teilen meig oder minder kontrasklar
deutlich dargestellen überzeugten und\aber zumal trotz Gegenargumenten
begründeten Meines. aus/in denkerischen Aspekten, wobei und wohu ja auch seine empirische
wiederlegbarkeit in/an Realitäten nicht so ganz ohne kognitives Wahrnehmen aus-
oder zustande kommt (gleich gar ignoranntes oder sogar
unmöglihes/ausgeschlossenes ‚berücksichtigend‘). 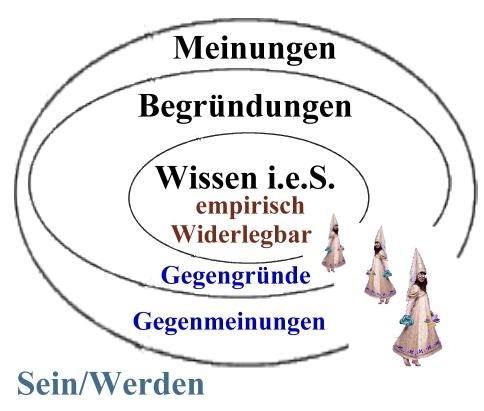
#file:///C:/www.jahreiss-og.de/pic-hz/rotergig210876800CWtHfv_fs.jpg

#file:///C:/www.jahreiss-og.de/pic-hz/rotersig210876800CWtHfv_fs.jpg








file:///C:/www.jahreiss-og.de/pic-hz/rotersigrot-sig016b.jpg








![]() Unter dem großen, von vergoldetem Stuck
umrahmten, Deckengemälde – eines, durch
Unter dem großen, von vergoldetem Stuck
umrahmten, Deckengemälde – eines, durch ![]() barocke (inzwischen also
weitgehend drüben verdunkelte bis vergessene) Perspektiventechnik beobachtungsrichtungsabhägnig ‚drehend‘,
stets davon/voran galoppierenden Pferdes, mit (etwa der Erfahrungs- bis Forschungs-)Lanze
‚haltender‘, voller, womöglich ‚bemenschter‘, Ritterrüstung,
vor blauen Himmeln(!) – von #hierKnochel,
das immerhin und ausgerechnet Kinder
so beeindruckte, dass sie eienr erstaunten Fürstin (die dies selbst noch nie bemerkt hatte) hinterher ‚von ihrem Höhepunkt‘
der Schlossbesichtigung erzählten. –
Jener (drüben/historisch
barocke (inzwischen also
weitgehend drüben verdunkelte bis vergessene) Perspektiventechnik beobachtungsrichtungsabhägnig ‚drehend‘,
stets davon/voran galoppierenden Pferdes, mit (etwa der Erfahrungs- bis Forschungs-)Lanze
‚haltender‘, voller, womöglich ‚bemenschter‘, Ritterrüstung,
vor blauen Himmeln(!) – von #hierKnochel,
das immerhin und ausgerechnet Kinder
so beeindruckte, dass sie eienr erstaunten Fürstin (die dies selbst noch nie bemerkt hatte) hinterher ‚von ihrem Höhepunkt‘
der Schlossbesichtigung erzählten. –
Jener (drüben/historisch ![]() ‚Barock[periode]‘
‚Barock[periode]‘ ![]() genannten) Zeit von deren, sich damals
reflektiert entwickelnden Denken, jene inzwischen
als alternativlos selbstverständlich
unreflektierbar/vergessenen – etwa emotionalen bis intuitiven –
Grundstrukturen heutiger (sich gar ‚modern‘ bis ‚postmodern‘ vorkommender) Menschen, massgeblich
beeinflusst wurden.
genannten) Zeit von deren, sich damals
reflektiert entwickelnden Denken, jene inzwischen
als alternativlos selbstverständlich
unreflektierbar/vergessenen – etwa emotionalen bis intuitiven –
Grundstrukturen heutiger (sich gar ‚modern‘ bis ‚postmodern‘ vorkommender) Menschen, massgeblich
beeinflusst wurden.
Wie einer eindrucksvoll, doch oder also gar eher wenig bekannte, tiefenpsychologische, bis womöglich anthropologische, Theorie, sogar zu erklären versucht, bis vermag, dass die meisten ‚heutigen Leute‘, die damalige Kunst nicht (mehr ohne [sic!] fachkundige) Anleitung verstehen – sich also ‚ihres eigenen Verstandes, für sich alleine‘, nicht so ganz zureichend (wie etwa © Immanuel Kant dies vermocht) ‚bedienen zu‘ können scheinen.
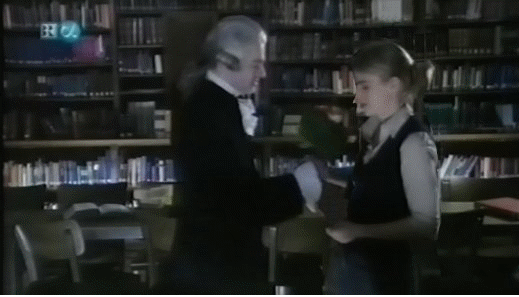
#hierfoto
#hierfoto


[Abb.]

Das Portrait #hierEitel-Friederichs III. von Hohenzollern, dem wie auch immer überlieferten Vater des ersten a-priorischen äh hohenzollerischen
Bewohners, seit 1535 dieser wenigstens bis in ![]() die
römische Antike zurückgehenden Felsenschlosses
der Wadenberger Grafen, entstammt der brühmten
Holbeinschule (dem Balinger Renaissance
-Mahler Joseph Weiß zugeschrieben, zeitweise auch mit dem Meister von Meßkirch interveriert). Apriorische Kategorien (vgl. auch Meter) zumindest
von Aristoteles bis Kant auch an den Wänden zur/mit/von
die
römische Antike zurückgehenden Felsenschlosses
der Wadenberger Grafen, entstammt der brühmten
Holbeinschule (dem Balinger Renaissance
-Mahler Joseph Weiß zugeschrieben, zeitweise auch mit dem Meister von Meßkirch interveriert). Apriorische Kategorien (vgl. auch Meter) zumindest
von Aristoteles bis Kant auch an den Wänden zur/mit/von ![]() historischen
Modalität, oder wohin auch immer. Bis weit in's 19.
Jahrhundert hinein wurde – seit mindestens zweihundert Jahren abendländischer
Geistesgeschichte und Verhaltenspraxis – nicht bestritten, dass Denken
gar nicht ohne Gefühle stattfinden kann.
historischen
Modalität, oder wohin auch immer. Bis weit in's 19.
Jahrhundert hinein wurde – seit mindestens zweihundert Jahren abendländischer
Geistesgeschichte und Verhaltenspraxis – nicht bestritten, dass Denken
gar nicht ohne Gefühle stattfinden kann.
Dieser Sohn Karls L. selbst ist 1535 mit der Grafschaft belehnt worden und heiratete bekanntlich (und sei es wie auch immer zu verstehen ‚dazu‘) Anna, Markgräfin von Baden, die Witwe des letzten Wadenberger( Herrn)s.
[Abb.]#hierfoto



Ein anders Portrait ‚zeigt‘, zwischen den Fenstern, vorgeblich gar Ägypten's Hermes Trismegistos, äh Johans, den ersten der Reichsfürsten durch Kaiser Ferdinand II. seit 1623 zweier ‚schwäbischer‘ Linien des Geschlechts / des Holismus (die burggräflich fränkischen Hohenzollern waren ja bereits seit zwei Jahrhunderten zu Reichsfürsten erhoben worden).
Neben einer der Türen, ein Bild von Kaiser Karl V. Taufpate seines Vertrauten, Diplomaten und Reichshofratspräsidenten Karl I. (1516-76). Dieser erbte 1558 auch die hohenzollerische Stammgrafschaft und vereinigte alle schwäbischen Territorien in seiner Hand. Nach und von ihm her bildeten sich die drei Linien Hechingen (bis 1869), Haigerloch (bis 1634) und Sigmaringen (bis heute – neben der brandenburgisch-preußischen) des Adelshauses aus.
Die Zeichnung des Forschungsprozesses
immerhin virtuell, hier an der ebenfalls
roten Wand, bei bis hinter der Türe zum roseroten
Korridor/Treppenhaus des Physe  und zum schwarzen
Salon der Psyche, hinterm großen goldenen Rahmen (verborgen gedacht),
stammt von Allemann, und zeige [nein
– genauer
genommen ‚repräsentiert auch diese Darstellung bereits‘ (anstatt: ‚
und zum schwarzen
Salon der Psyche, hinterm großen goldenen Rahmen (verborgen gedacht),
stammt von Allemann, und zeige [nein
– genauer
genommen ‚repräsentiert auch diese Darstellung bereits‘ (anstatt: ‚bloß/nur‘)]![]() wichtige
Stationen des
‚ordentlichen Weges‘ jener
Insel auf.
wichtige
Stationen des
‚ordentlichen Weges‘ jener
Insel auf.
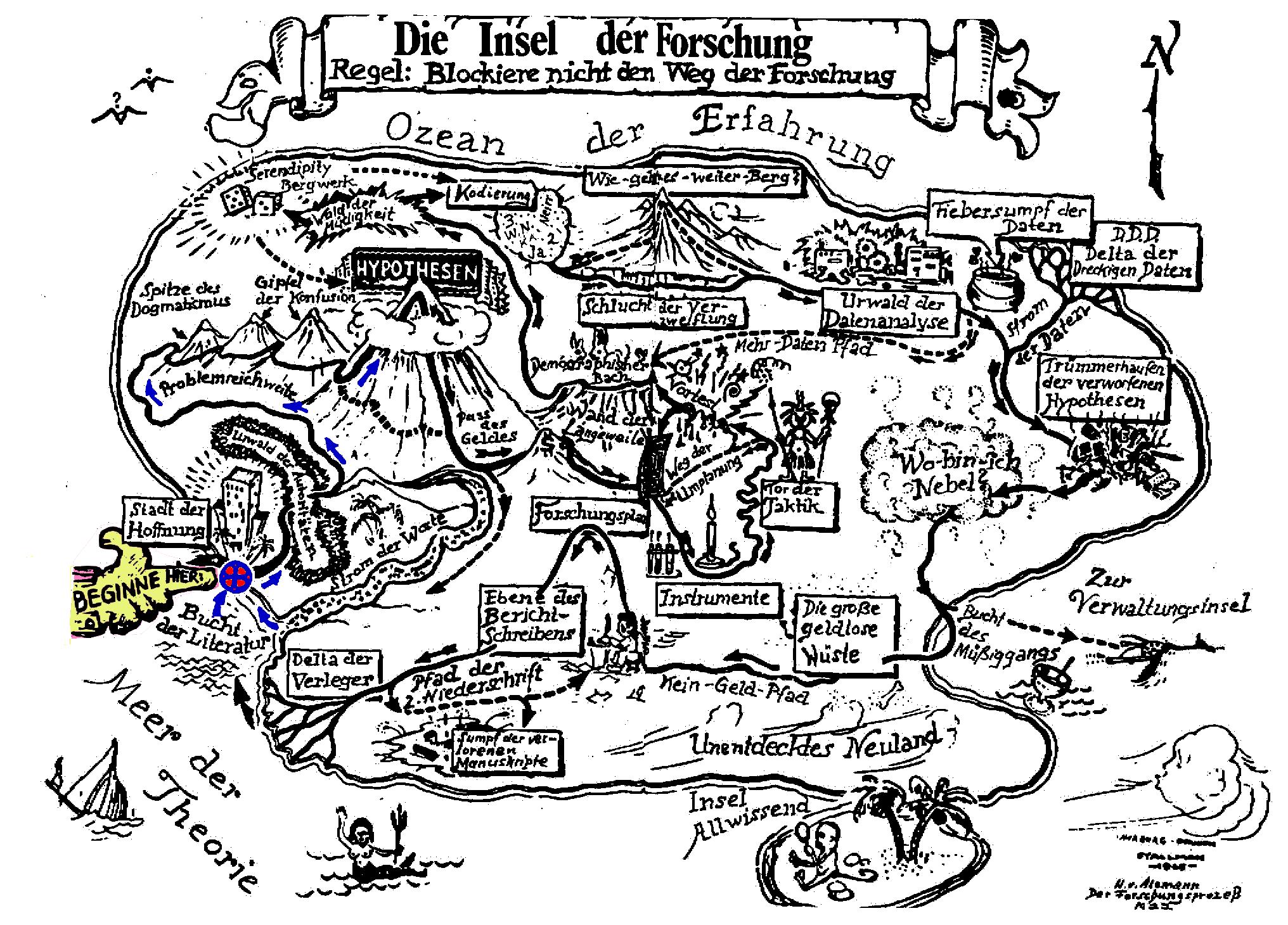
Und die ‚Wissenschaft versus
Menschenverstand‘ Gedankenkarte (gar
desselben Durchstiegs)  darunter bis darüber, ‚zeigt‘ mit Lord Ralf Gustav insbesondere Stufen
bzw. Möglichkeiten der Bemühungen,
das Geschehen (umfassend) zu begreifen, auf.
darunter bis darüber, ‚zeigt‘ mit Lord Ralf Gustav insbesondere Stufen
bzw. Möglichkeiten der Bemühungen,
das Geschehen (umfassend) zu begreifen, auf.
Denn
den ![]() kompositorisch-kreativen Piano/Flügel – hier im (einen /
quasi ‚öffentlichen‘) ‚Musikzimmer des
Schlosses‘ der erlebnisseweltenlichen Stadt Komposition –
und die übrigen (Mess- bis Konzert-)Instrumente nehmen (bis wollen) gar nicht immer
alle Leute überhaupt wahr (haben. [Abbs. Chelistin und Flügelreferenzen gar auch mit v-Laut]
kompositorisch-kreativen Piano/Flügel – hier im (einen /
quasi ‚öffentlichen‘) ‚Musikzimmer des
Schlosses‘ der erlebnisseweltenlichen Stadt Komposition –
und die übrigen (Mess- bis Konzert-)Instrumente nehmen (bis wollen) gar nicht immer
alle Leute überhaupt wahr (haben. [Abbs. Chelistin und Flügelreferenzen gar auch mit v-Laut]
 Abbs.Piano-flügel-Reverenzen??
Abbs.Piano-flügel-Reverenzen??
 Denkerische Konzepte, deren (eher selten ‚nur/allein [so
nonokausal], doch mindestens, überlebens‘
Denkerische Konzepte, deren (eher selten ‚nur/allein [so
nonokausal], doch mindestens, überlebens‘ ![]() interessiert
[und sei/scheine diesbez+gliches
fehlerhaft] auslegendes / verschieden bis wählbar filternd deutendes)
interessiert
[und sei/scheine diesbez+gliches
fehlerhaft] auslegendes / verschieden bis wählbar filternd deutendes) ![]() ‚Bemerken‘
wirksamer,
‚Bemerken‘
wirksamer, ![]() [Kern-These] mithin
wirklicher, als (andere/sonstige – gar ‚erster Ordnung‘,
bis ‚Reinheit/en von‘ oder ‚der Denkempfinden‘,
[Kern-These] mithin
wirklicher, als (andere/sonstige – gar ‚erster Ordnung‘,
bis ‚Reinheit/en von‘ oder ‚der Denkempfinden‘,
![]() zugeschriebene/genannte) Fakten/Zeichen!
zugeschriebene/genannte) Fakten/Zeichen! 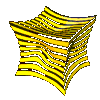 [Was
/ Obwohl / Auch wenn
[Was
/ Obwohl / Auch wenn ![]() mehrere Leute (Es)
zusammenpassend benennen /
mehrere Leute (Es)
zusammenpassend benennen / ![]() beurteilen
/ fühlen (sollten) / hören / messen / sehen / tanzen / wiegen / zählen … beeinflusst Es/Vorfindliches mur (quantenphysikalisch
oder) handelnd, respektive
diese (teilnehmend
beobachtenden) Menschen mindestens
beurteilen
/ fühlen (sollten) / hören / messen / sehen / tanzen / wiegen / zählen … beeinflusst Es/Vorfindliches mur (quantenphysikalisch
oder) handelnd, respektive
diese (teilnehmend
beobachtenden) Menschen mindestens ![]() sozial-psychologisch
sozial-psychologisch![]() , nicht einmal alles/immer
physiologisch, allenfalls
beschäftigungsrelevant]
, nicht einmal alles/immer
physiologisch, allenfalls
beschäftigungsrelevant] 
 ‚Furchten‘ und ‚Respekt‘
nicht etwa
‚Furchten‘ und ‚Respekt‘
nicht etwa ausgeschlossen.
[Abb. Kontemplatives Lachen] «Und/Aber
jene dunkle, immerhin vorgebliche sogar Para- bis
Pseudo-Ecke dort, der ‚lachenden‘, äh verschwommenen,
Paradoxafallen, ersparen ja vielleicht namentlich Sie
mir, bis
sich, hier, heute bitte nicht wieder?» 

 Zu den besonders gut verborgenen,
bis gegenwärtig verlorenen, Geheimnissen
–
wenigstens aber den tiefen Rätseln – gehört anscheiend,
dass das Analytische weder allein, oder nur, reduktionistisch
sein/werden muss, noch ohne – gar
‚emotionale‘/gefühlte – Vorstellungen der Bewusstheiten,
und wenigstens motivierende Unklarheiten, zu haben ist.
Zu den besonders gut verborgenen,
bis gegenwärtig verlorenen, Geheimnissen
–
wenigstens aber den tiefen Rätseln – gehört anscheiend,
dass das Analytische weder allein, oder nur, reduktionistisch
sein/werden muss, noch ohne – gar
‚emotionale‘/gefühlte – Vorstellungen der Bewusstheiten,
und wenigstens motivierende Unklarheiten, zu haben ist.
 «Den [anti-reduktionistischen; O.G.J.] Gedanken hatte schon / auch
Immanuel Kant. In seiner komplexen Redeweise, ich [Di.Ha.] mache es einfach: „Was man beweisen soll können, muss man auch als Objekt vor sich haben.
Und was man widerlegen soll können, muß man auch als Objekt vor sich haben. Indem
man sagt ‚existiert nicht‘ oder ‚existiert‘. Eine Eigenschaft, [aber] die von vorne herein a-piorisch
eine Eigenschaft des Subjektes ist, entzieht sich der Beurteilung durch ‚ja und nein‘.
«Den [anti-reduktionistischen; O.G.J.] Gedanken hatte schon / auch
Immanuel Kant. In seiner komplexen Redeweise, ich [Di.Ha.] mache es einfach: „Was man beweisen soll können, muss man auch als Objekt vor sich haben.
Und was man widerlegen soll können, muß man auch als Objekt vor sich haben. Indem
man sagt ‚existiert nicht‘ oder ‚existiert‘. Eine Eigenschaft, [aber] die von vorne herein a-piorisch
eine Eigenschaft des Subjektes ist, entzieht sich der Beurteilung durch ‚ja und nein‘.
Sie zeigt sich höchstens
in der ‚Welt[!] von Ja und Nein‘, das konnte ... Kant
nicht sagen. Aber gut, wir leben [bereits nach dem] Jahre 205 nach seinem Tode,
und deshalb können wir vielleicht doch etwas ... über Kant hinausgehen und eine
seiner Einsichten noch verbessern:
Nämlich
Freiheit ist in der Natur [in Raum und
Zeit überhaupt; O.G.J.] indirekt anschaubar. Er [Kant] hat
ja gesagt, es sei nur ein Ereignis, ein Faktum der Vernunft. Aber es [Freiheit]
ist anschaubar indirekt.» (Di.Ha., 2009; schriftartige und verlinkende
Hervorhebungen O.G.J.)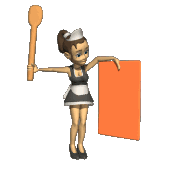 Aber – (weiß
bis erinnert das schwarz-weiß) mindestens (immerhin
handelnder Domestiken) zur Ehrenrettung des Reducktionismus – es war und bleibt Aufgabe/Daseinsberechtigung
von Wissenschaften überhaupt, die
bereits potenziell unendlichen Ozeane der Erfahrungen
des, und zumal der ganzen (sie
zumindest dokumentarisch festgehallten/überliefert habenden), Menschen
– auf jenen ‚theoretisch‘-
Aber – (weiß
bis erinnert das schwarz-weiß) mindestens (immerhin
handelnder Domestiken) zur Ehrenrettung des Reducktionismus – es war und bleibt Aufgabe/Daseinsberechtigung
von Wissenschaften überhaupt, die
bereits potenziell unendlichen Ozeane der Erfahrungen
des, und zumal der ganzen (sie
zumindest dokumentarisch festgehallten/überliefert habenden), Menschen
– auf jenen ‚theoretisch‘-![]() genannten
genannten ![]() Kern/‚Anteil‘
ihrer-so-Notwendigkeit-zu-komprimieren, den diese Erlebnismengen/Ereignisse
in dieser Weise sonst nicht/allein denkerisch
haben, bzw. eher heteronomistisch manipulierend verstellt bekommen
sollen.
Kern/‚Anteil‘
ihrer-so-Notwendigkeit-zu-komprimieren, den diese Erlebnismengen/Ereignisse
in dieser Weise sonst nicht/allein denkerisch
haben, bzw. eher heteronomistisch manipulierend verstellt bekommen
sollen. 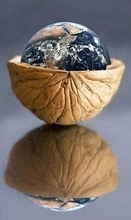 Denn
spätestens in der Literatur
insgesamt –
wie ja auch schon innerhalb größerer Werke so
manch berühmter Urheberschaften zitierend – läßt sich (irgendwann) jede Erzählung
überhaupt, und aber/dann mindestens
auch noch ein Gegenteil davon, vorfinden. – Was zu dem gerne mit ‚wirklich‘
atributierten (wie und wo, in welcher
Weise) Notwendigkeitsproblem gerade dieser Erfahrung/Erlebnisse
gehört/(zurück)führt.
Denn
spätestens in der Literatur
insgesamt –
wie ja auch schon innerhalb größerer Werke so
manch berühmter Urheberschaften zitierend – läßt sich (irgendwann) jede Erzählung
überhaupt, und aber/dann mindestens
auch noch ein Gegenteil davon, vorfinden. – Was zu dem gerne mit ‚wirklich‘
atributierten (wie und wo, in welcher
Weise) Notwendigkeitsproblem gerade dieser Erfahrung/Erlebnisse
gehört/(zurück)führt. ![]() Eben
dieses Roten Salons, äh der analytischen Modalität Emblem. [‚Zirkelschlüssige‘
und sonstige Beleidigungen,
bis Drohungen, greifen ‚zu kurz‘ / neben ‚blauen Humor‘]
Eben
dieses Roten Salons, äh der analytischen Modalität Emblem. [‚Zirkelschlüssige‘
und sonstige Beleidigungen,
bis Drohungen, greifen ‚zu kurz‘ / neben ‚blauen Humor‘]
 [Abbs.
Barnaby Schülerinnen und Rasenbetreten?]
[Abbs.
Barnaby Schülerinnen und Rasenbetreten?]
«Na, da haben wir ja schon mal 'ne Arbeitsgrundlage. - Das ergibt doch Alles keinen Sinn:
„Auf meinem Weg, von da nach dort, traf ich 'nen Mann, der gar nicht war. Auch heut war wieder er nicht dort. Ich wollt, ich wollt, er ginge fort.“
Nun also noch einmal, oder
überhaupt offiziell, bis endlich: ![]() Herzlich – oder immerhin oberflächlich, bjs sogar formell
– willkommen in einem, der wenigstens heimlichen, respektive
unheimlich( ausmittig)en, Zentren des Wissbaren / Ostflügels: Im Unterschied bis Widerspruch zu den spätestens antiken Möglichkeiten, klassisch von unten, oder immerhin
von oben herab, beginnender Schlossführungen,
wäre und ist virtuell (denkbar) das Ganze, in
diesem Schloss hier
repräsentierte Denken, gerade von
diesem Standort/QTH aus, besonders sinnvoll (doch auch
dies nicht unbedingt ‚leicht‘ oder ‚gleich/allgemein‘) zugänglich.
Herzlich – oder immerhin oberflächlich, bjs sogar formell
– willkommen in einem, der wenigstens heimlichen, respektive
unheimlich( ausmittig)en, Zentren des Wissbaren / Ostflügels: Im Unterschied bis Widerspruch zu den spätestens antiken Möglichkeiten, klassisch von unten, oder immerhin
von oben herab, beginnender Schlossführungen,
wäre und ist virtuell (denkbar) das Ganze, in
diesem Schloss hier
repräsentierte Denken, gerade von
diesem Standort/QTH aus, besonders sinnvoll (doch auch
dies nicht unbedingt ‚leicht‘ oder ‚gleich/allgemein‘) zugänglich.
Der Modalitäten-Schlossbegehung/en, also von der Psyche (nebenan) her, folgend ist bereits die erste Paradoxie des analytischen Möglichkeitenraumes – jene typische von schwarz(er) oder rot(er Uniformjacke) – immerhin in neurologischer Hinsicht, und zeitlich vor dem 18. Jahrhundert selbst im gebildeten Abendland, nur eine scheinbarer Antagonismus, dafür und daher also besonders wirkmächtig/folgenreich:
Die eigentümliche Abwesenheit einer logisch, und gleich gar empirisch, durchgehenden Trennwand, mit einer von hier aus abschließbaren Türe, zwischen, gleich gar schwarzen, Gefühlen und diesem, sei es auch nur bzw. immerhin dem analytischen, Denken, unter seiner eiskalt-blauen Allgemeinheitsdecke, rot brodelnder Hitze äh Genauigkeit.
Die An- bis Einsicht widerspricht den vorherrschenden Managementkonzepten, den nominellen Selbstverständnissen – jedenfalls der eigenen – Person in und Position im akademischen Disput äh 'Dialog', für ‚männlich‘ gehaltener bzw. erklärter Rationalität etc. pp. ganzer Kulturen [vgl. etwa
#hiertfoto
Ge.Gi.
bis In.Fi.], #fotogirls die sehr ernsthaft (gar bis zum Blutvergießen
entschlossen) davon ausgehen, dass sich rationale Vernunft, in einer/der Weise von Gefühlen / Psychologie unterscheide,
dass sie nichts damit zu tun haben könne und
dürfe: So dass sich diesseits des Übergangs der modalen Schlossräume
Unfähigkeiten einstellen mussten, die unverzichtbaren Einflüsse von Gefühlen auf Denken wahrnehmen
und reflektieren/analysieren und gar beeinflussen bis beherrschen zu können
(anstatt sich davon beherrschen zu lassen, ohne dies zu bemerken).
#fotogirls die sehr ernsthaft (gar bis zum Blutvergießen
entschlossen) davon ausgehen, dass sich rationale Vernunft, in einer/der Weise von Gefühlen / Psychologie unterscheide,
dass sie nichts damit zu tun haben könne und
dürfe: So dass sich diesseits des Übergangs der modalen Schlossräume
Unfähigkeiten einstellen mussten, die unverzichtbaren Einflüsse von Gefühlen auf Denken wahrnehmen
und reflektieren/analysieren und gar beeinflussen bis beherrschen zu können
(anstatt sich davon beherrschen zu lassen, ohne dies zu bemerken).



#hierfotos

 [Abb.] «Im abendländischen Denken war
einmal Intuition die direkte Auffassung von Zuständen der Welt [sic!],
oder auch des anderen [sic! nicht auch solchen des Selbsts?
O.G.J.]. Ein direkter Zugang und das hatten z.B. Engel und andere
überirdische Wesen, nicht unbedingt wir gewöhnlichen [Menschen].
[Abb.] «Im abendländischen Denken war
einmal Intuition die direkte Auffassung von Zuständen der Welt [sic!],
oder auch des anderen [sic! nicht auch solchen des Selbsts?
O.G.J.]. Ein direkter Zugang und das hatten z.B. Engel und andere
überirdische Wesen, nicht unbedingt wir gewöhnlichen [Menschen].
Aber das wurde so gesehen als das [anzustrebende] Ziel.
Dann, im Zuge [geradezu des Banns; E.B.] der [vereinfachend popularisierten; O.G.J.] Aufklärung, bekam Intuition diese Rolle [sic!] des Zweifelhaften, des Zweitklassigen, unter der Ratio [gemäß jener hierachisierenden Denkform, nach der seither auch die a-üriorische Bezeihungsrelationssphäre qualifizierten ‚Glaubens‘ der ‚inhaltlichen‘ Sachverhaltsshpäre des (immerhin hinterher) ‚Wissbaren‘ zu unterwerfen versucht wird; R.H.]. Und man stellte Intuition unter Ratio, genauso wie man, schon seit langem, Männer über Frauen geszellt hatte. Und dadurch kam auch dieses Bild, dass Frauen Intuitionen haben, aber wir [Männer] ratzional sind. Das hört/hat man heute noch.» (Gerd Gigenzer; verlinkende Hervorhebungen O,G,J.)
[Abbs. Salutierende und galauniformierte Soldatin]
Zu/an den Verhältnissen und Unterschieden von strategischen, (operativem) und taktischem
Denken, bis Handeln, sind/wären – außer dem gefälligen Tribut an emotionale
Assoziationen bzw. Klischees – auffällig, dass die taktischen / ‚untern‘ unvermeidlich![]() (wenn
vereinzelt manchmal auch unvorbereitet/untrainiert und sogar falsch gemacht,
dennoch – aber unwahrscheinlicherweise, eben kontingent – ‚erfolgreich verlaufen könnend‘) in ihrem Möglichkeitsspielräumen/Optionsplatten, von den ‚höheren‘
eröffnet und begrenzt werden.
(wenn
vereinzelt manchmal auch unvorbereitet/untrainiert und sogar falsch gemacht,
dennoch – aber unwahrscheinlicherweise, eben kontingent – ‚erfolgreich verlaufen könnend‘) in ihrem Möglichkeitsspielräumen/Optionsplatten, von den ‚höheren‘
eröffnet und begrenzt werden.
Sowohl beispielweise die operative Mittelbereitstellung (weder zuerst noch zuletzt an Menschen) als auch die strategische Logistik oder Aufklärung (aller Führungsebenen) verdeutlichen vielleicht: Wie unterschiedlich die – spätestens mit von Clausewitz unverzichtbare – ‚Reserve‘, im (zeiträumlich eher länger andauernden) ‚Augenblick‘ des Gefechts, aber dennoch alternativlos ‚zugeteilt‘, in dem Sinne ‚vorgegeben‘ sein kann und wird, dass damit/darauf, an Ort und Stelle des Schlachtfeldes – insofern also ‚zu spät‘ bzw. jenseits des eigen Einflussbereiches, nicht aber außerhalb der größeren Interessenbereiche: „Ich wollt es wäre Nacht – oder die Preußen kämen“, wusste überliefertermassen der Herzog vpn Wellington, auf den Feldern von Waterloo, ehe Blücher mit den Entsatztruppen, höchst gewagterweise, noch rechtzeitig für den Schlachtverlauf (nicht etwa identisch mit dem ‚Schicksal‘ der Gefallen, und auch nur einer von Faktoen des Überlebens mancher – gar über 1814 hinaus) wirklich/wirksam eintraf – ‚nur‘ (gar nicht so selten bis hoffentlich verzögerungsarm) taktisch (bis ggf. operativ – verhaltensfaktisch unausweichlich) agiert wird, bis (mehr oder minder geignet – insofern immerhin wahlfrei und nicht völlig alternativlos) reagiert werden kann.
Denn strategisch, und daher wie dazu, sind Kenntnisse erforderlich – neben (nicht etwa anstatt von – gleich gar taktischem, also vorher, mehr oder minder einübend, auf mindest je eine, und oft drill,äßig allein nur diese, Weise auf unterschiedliche, erwartete Situation vorbereitetes) Können (handwerklicher Künste): Hauptsächlich Lagekentnisse, Daten die alles andere als selbstverständlich (zumal da wo Menschen den eben aktuellen Überblick ihrer Kenntnisse tendenziell vorständig überblickt empfinden), oder gar immer leicht hinreichend zu beschaffen, noch notwendigerweise zutreffend gegeben (weil immer welche, und seien es gerade auch plausibel begründete, vermutbar respektive zu erahnen) sind.
Aufklärung – gleich gar (insbesondere über ‚ihre‘/die eigenen Grenzen/Reichweiten, unaufgeklärte – leider auch was Absolutheitsansprüche bammemder (Eugen Biser), jedenfalls unrefleltierter bis uneingestandener (zumal aus, auf brav eingeübte Angstreflexe vor Ansehensverlußten heraus reduzierten und beschränkten Positionen/Haltungen/OTHs) sogar als solche unwahrnehmbar gewollten äh gewordenen, treu mechanisch-nullsummenpardigmatischer Überblicksvorstellungen und (gar fanatismus- respektive dikrimminierungsanfällig) für ‚Objektivität‘ gehaltener Selbstunbegrenzheits- wie so offensichtlichen Vollständigkeitsillusionnen des Überblicksdenkens, bis Gesamtheitsempfindens.
![]() Roter Musica-Salon
- ANALYTIK (wenigstens des Musik- und des barocken Kunstbegriffes mit Siegfried
Mauser)
Roter Musica-Salon
- ANALYTIK (wenigstens des Musik- und des barocken Kunstbegriffes mit Siegfried
Mauser)
· seine Farbe, bekanntlich (hier – ok unter blauer Decke) jene der Vergangenheit bzw. des tatsächlich eingetretenen sachlich gar nicht-mehr-Änderbaren, gleichwohl Interpretationsbedürftigen, jedenfalls soweit bzw. sofern es/etwas überhaupt als gegeben wahrgenommen (allerdings eine wenigstens wahlfreie Entscheidung auf/in der noch höherrangigen ästhetische Modalität) wird. -
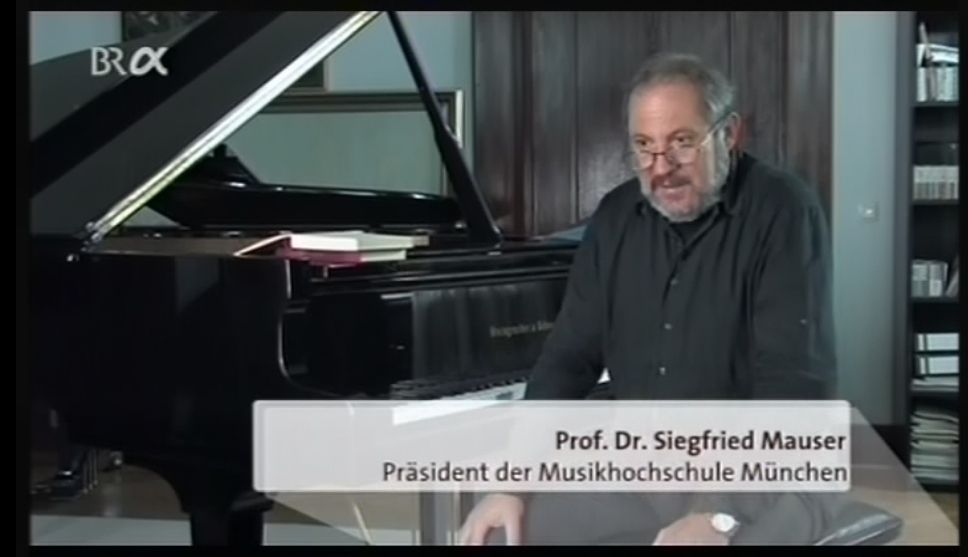
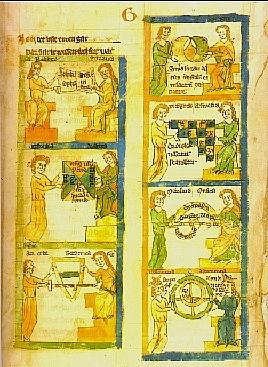 «Musik, alle Künste» überhaupt [namentlich die
seiben freien meisterlichen der Artistenfakulät scolatischer Curicula] seien nicht ohne Intuition/en vorstellbar:
«(Z)u allen Zeiten, in allen historischen Epochen hat die Intuition eine wesentliche [inszenierende bis ‚immerhin‘
soziale]
Rolle gespielt – mal stärker, mal schwächer. Aber eine gewisse Präsenz war
immer da.
«Musik, alle Künste» überhaupt [namentlich die
seiben freien meisterlichen der Artistenfakulät scolatischer Curicula] seien nicht ohne Intuition/en vorstellbar:
«(Z)u allen Zeiten, in allen historischen Epochen hat die Intuition eine wesentliche [inszenierende bis ‚immerhin‘
soziale]
Rolle gespielt – mal stärker, mal schwächer. Aber eine gewisse Präsenz war
immer da.
Das, was man Intuition nennen könnte, bei Bach ist so eine Art Wesensschau. Eine Wesensschau in einem spirituell-religiösen Sinne. Und die Teilhabe an diser – in das eigene Innere sich zurückziehende [sic!] und daran orientierende Wesensmoment, dier Blick der gleichzeitig einer in die [sic!] andere Welt ist – das ist das wo vielleicht Intuition dann stattfindet.
Und das ist aber eher im Sinne einer. sagen wir mal – ich möcht nicht sagen ‚objektiven‘ – aber doch übersubjektiven Meditation. Das hat dann schon mit ‚Schau‘ zu tun, mit einer geistigen [sic!] Schau. Man könnte sagen [läßt den Flügel erklingen]: ‚Donner, Blitz Schatten‘ – Jetzt rede ich schon in Metaphern, also in Bildern, also ich bin jetzt - wenn man so will – schon auf der Inspirationsebene. [Synästetisches: O.G.J. angeregt] Das steht natürlich[sic! zudem kaum eingeeignetes/gemeintes ‚Kunstmaß‘; O.G.J. venexianisch] so net da [in der Partitur]. Da hab ich: ‚C-Moll, Fortissimo, Piano und Pausen. ...‘ Da bin ich jetzt mit diesen [nonverbal erklingenden] Bildern, mit ‚Schlag, Bltz und Schatten‘, bin ich jetzt auf der Inspiratiobsebene, oder als Interoret auf der Intuitionsebene. Wenn ich des für mich erkannt habe und für mich angenommen habe, dann komm ich in diese Flussbewegung des bethofenschen Geistes quasi, hinein.
Ab Bethofen, glaube [sic! Kernthese von Si.Ma. et al.] ich, ist in der Kompositionsgeschichte, bis ins 20. Jahrhundert hinein, diese Dimension der Inspiration und der Intuition, eigentlich poethisch die zentrale gewesen. [...] Ein Komponist, dem nichts einfällt, war kein Komponist. Der [hat] Handwerk beherrscht, der Technik beherrscht – was im Barockzeitalter noch ganz was anders war. Da ist der Handwerks-Begriff [alef-mem-nun] entschieden stärker betont worden. Aber wem nichts einfällt, der ist kein Künstler.
Das heißt also, die Intuition, die Inspiration ist das wesentliche Moment für die künstlerische Produktion, an der gearbeitet werden muss [sic!]. – Was da einfällt, und wo man sich da einfühlt, das bleibt schon weitgehend – ich möcht sagen – im ‚Numinisen‘ [griechisch für eine, bis die, Erscheinung des/von Göttlichem, bis Göttern; O.G.J.]»
Aber wenn man versuche es etwas näher zu fassen, sei es seines/Si.Ma.s Erachtens «eine Art spirituelle Dimension. Ein vieleicht banales Bild: Die großen Komponisten waren für mich, ne Art Tankwarte, die bestimmte Zapfsäulen haben, wo sie sozusagen Ebenen anzapfen, die für den [sogenannt] Normalsterblichen nicht[sic!] zugänglich sind. Das ist eben schon eine spezielle Begabung, ob man es jetzt ‚Genie‘ oder wie auch immer» nenne sei gleichgültig. «Aber da sind
Begabungsstrukturen
da und Wege aus einer inneren[sic! CHaSaK] Kraft heraus, an Dinge heran zu kommen, die nicht jedem zugänglich
sind.» (Siegfried
Mauser; hervorhebende Verlinkungen etc, O.G.J.
gleichwohl vermutend, dass es eher um ganz unterschiedliche ‚Kunst- bis Künstefähigkeiten‘ geht als um ob-Überhaupt[-nichts davon])

 Alltäglich/es, immerhin ‚grau(stufig)‘,
erweisen sich/wir Menschen uns schwarz auf Rückseiten weiß gar nicht
so selten.
Alltäglich/es, immerhin ‚grau(stufig)‘,
erweisen sich/wir Menschen uns schwarz auf Rückseiten weiß gar nicht
so selten.  [In schwarz-weißen Schuluniformen nach Jas
und Neins geordnet, gar mit/nnoch ‚in den schwarzen Blazern‘ konzeptioneller Denkformen, und
doch eben auch wiederum ‚empirisch rein‘
als weiße Debütanntinnen gekleidet anzusehen, treten
dazu hier am Schlossflügelende bzw. -anfang des-überhaupt-Wissbaren bereits
‚alle‘ der ‚tieferen‘, Modalitäten ein, bis (spätestens
nebenan ‚historisch‘ angeeignet/essend) mit sämtzlichen
zusammen]
[In schwarz-weißen Schuluniformen nach Jas
und Neins geordnet, gar mit/nnoch ‚in den schwarzen Blazern‘ konzeptioneller Denkformen, und
doch eben auch wiederum ‚empirisch rein‘
als weiße Debütanntinnen gekleidet anzusehen, treten
dazu hier am Schlossflügelende bzw. -anfang des-überhaupt-Wissbaren bereits
‚alle‘ der ‚tieferen‘, Modalitäten ein, bis (spätestens
nebenan ‚historisch‘ angeeignet/essend) mit sämtzlichen
zusammen]
![]() Vorsicht bitte! Die womöglich eher
retrospektiv (von ‚heutigen‘, etwa Saumhöhen betreffenden, Verhältnissen aus denkend)
entstandene, bis sogar
sexuell/macht motivierte, Erklärung, für das ‚beim Knixen‘
übliche, ausbreitende Anheben der Röcke, als (mindestens symbolisch) zur
herrschaftlichen Inspektion geziemender Bekleidung und Anzugsordnung (bis
darunter/dahinter) gehörig, findet hier oben eben eine besonders
deutlich sichtbare, bis recht peinlich
entblößen könnende, Referenz-Anwendungs-Reverenz.
Vorsicht bitte! Die womöglich eher
retrospektiv (von ‚heutigen‘, etwa Saumhöhen betreffenden, Verhältnissen aus denkend)
entstandene, bis sogar
sexuell/macht motivierte, Erklärung, für das ‚beim Knixen‘
übliche, ausbreitende Anheben der Röcke, als (mindestens symbolisch) zur
herrschaftlichen Inspektion geziemender Bekleidung und Anzugsordnung (bis
darunter/dahinter) gehörig, findet hier oben eben eine besonders
deutlich sichtbare, bis recht peinlich
entblößen könnende, Referenz-Anwendungs-Reverenz.

Alle sechs ‚vorherigen‘
Denkmöglichkeitenaspekte  tragen epistemologischerweise/erkenntnistheoretisch – und sei es auch, gar gerade ihnen
derart selbstverständlicht,
mehr oder minder sorgfältig verborgen – so mancher, insbesondere reduktionistischer, Theorien-Strumpfbänder
konzeptionellen Denkens (und nicht
zuletzt daher/bishierher oft als alternativlos empfundenen
/ zu bekennnenden Verstehens).
tragen epistemologischerweise/erkenntnistheoretisch – und sei es auch, gar gerade ihnen
derart selbstverständlicht,
mehr oder minder sorgfältig verborgen – so mancher, insbesondere reduktionistischer, Theorien-Strumpfbänder
konzeptionellen Denkens (und nicht
zuletzt daher/bishierher oft als alternativlos empfundenen
/ zu bekennnenden Verstehens).
[Versuchungen,
die/den anderen Menschen ![]() (mindestens) zu
verdächtigen: ‚dasselbe zu denken, fühlen, sagen, sehen, wollen‘
(wie
ich, zumal derzeit, oder ‚an deren/dessen Stelle‘. äh ‚wie immer/mehrheitlich alle‘)
– sind vielfach basal widerlegt
(mindestens) zu
verdächtigen: ‚dasselbe zu denken, fühlen, sagen, sehen, wollen‘
(wie
ich, zumal derzeit, oder ‚an deren/dessen Stelle‘. äh ‚wie immer/mehrheitlich alle‘)
– sind vielfach basal widerlegt![]() dennoch/daher
omnipräsent(er als
‚nicht nur dafür gehaltene‘, unbestrittene Verständigungserfahrungen
und Emphatien) geblieben – gleich gar wo (repräsentierend)
dieselben
dennoch/daher
omnipräsent(er als
‚nicht nur dafür gehaltene‘, unbestrittene Verständigungserfahrungen
und Emphatien) geblieben – gleich gar wo (repräsentierend)
dieselben ![]() Semiotik/en (Ausdrücke/Zeichen) verwendet werden] Deutungen
am/durchs Institut für
Semiotik/en (Ausdrücke/Zeichen) verwendet werden] Deutungen
am/durchs Institut für  #jojo
#jojo
Zum (bis in den) Zusammenhang (nicht allein und immerhin des ![]() grammatischen
Ausdrucks höchst selbst) gehören
mindestens zweierlei, nur allzu gerne verwechselte,
bis miteinander gleichgesetzte, zwar wesentlich verschiedene, doch einander
manchmal (anstatt ‚immer‘ oder gar ‚vollständig‘), überlappende Aspekte:
grammatischen
Ausdrucks höchst selbst) gehören
mindestens zweierlei, nur allzu gerne verwechselte,
bis miteinander gleichgesetzte, zwar wesentlich verschiedene, doch einander
manchmal (anstatt ‚immer‘ oder gar ‚vollständig‘), überlappende Aspekte:
![]() Alles
hänge mit Allem zusammen (ob nun unter Teilen, den bekannten Erkenntnishilfen
bis -notwendigkeiten menschlichen Verstehens,
oder/aber auch von gar pluralen Ganzheit/en
postuliert bis erfahren) meint und benennt,
dass hinreichend integral umfassend beobachtet und (zugleich/dennoch
ausreichend) genau detailiert betrachtet:
Korrelation/en.
Alles
hänge mit Allem zusammen (ob nun unter Teilen, den bekannten Erkenntnishilfen
bis -notwendigkeiten menschlichen Verstehens,
oder/aber auch von gar pluralen Ganzheit/en
postuliert bis erfahren) meint und benennt,
dass hinreichend integral umfassend beobachtet und (zugleich/dennoch
ausreichend) genau detailiert betrachtet:
Korrelation/en.
Das in einem mehr oder
minder großen raumzeitlichen ‚Zusammenhang‘ mit-
bis nacheinander Auftreten / ‚Dasein‘ von Dingen/Personen, zumindest aber von Ereignissen (dem heute ‚eigentlichen‘/einzigen Gegenstand
wissenschaftlicher Forschung). – Eben gerade ohne, dass deswegen, oder
dazu, zwischen ihnen – ![]() selbst falls oder da sie (alle)
miteinander wechselwirken sollten – überhaupt eine, oder gar ausschließlich
nur, kausale (immerhin: wirkursächliche, stoffursäcjliche,
formursächliche und/oder zweckursächliche - wie ‚noch‘ bei Aristoteles zu
finden) Beziehungsrelationen dazwischen(!) bestehen müss(t)en (wie sie Kausalitätsfanatiker/Menschen allüberall annehmen und bestätigt finden wollen; – so dass eine basale, doch besonders unbeliebte:
falsifizierende, Aufgabe von
Wissenschaften ist – oder zumindest wurde – Nichtursächlichkeiten,
Unabhängigkeiten zwischen [‚zunächst‘ bzw. ‚anscheinend‘ bis ‚schon immer‘ für
zusammenhängend gehaltenen] Variablen nachzuweisen).
selbst falls oder da sie (alle)
miteinander wechselwirken sollten – überhaupt eine, oder gar ausschließlich
nur, kausale (immerhin: wirkursächliche, stoffursäcjliche,
formursächliche und/oder zweckursächliche - wie ‚noch‘ bei Aristoteles zu
finden) Beziehungsrelationen dazwischen(!) bestehen müss(t)en (wie sie Kausalitätsfanatiker/Menschen allüberall annehmen und bestätigt finden wollen; – so dass eine basale, doch besonders unbeliebte:
falsifizierende, Aufgabe von
Wissenschaften ist – oder zumindest wurde – Nichtursächlichkeiten,
Unabhängigkeiten zwischen [‚zunächst‘ bzw. ‚anscheinend‘ bis ‚schon immer‘ für
zusammenhängend gehaltenen] Variablen nachzuweisen).
Schließlich bleibt ein
ordentlich angezogener, womöglich alltäglich verselbstverständlicht vertrauter, 'stand-up Strunpf (namentlich
‚sich/anderen es/etwas-erklärendes‘ bis gar ‚verstehen
könnendes‘) auch ohne zusätzliches (kognitiv bis emotional reflektierend, bis
gar als Theorie [an]erkanntes) Strumpfband
(auf Erden) einige Zeit oben, während in der Schwerelosigkeit andere Halter
bedeutsamer ... Sie wissen bestimmt schon, hält
eine zusätzliche Befestigung (gar unabhängig
davon, ob am linken und/oder rechten Bein, respektive an welchem Arm,
getragen – und bei hinreichend identischem
Bewegungsverhalten in derselben sonstigen Umgebung) ja meist (anstatt: ‚immer‘)
noch etwas länger, ‚als‘ etwa beim Knicks oder gar einer ‚Unartigkeit‘.
#hierfoto


[Alle – zumindest bis zumal wissenschaftlichen – Erkenntnisdisziplinen kommen notwendigerweise ‚hier im Roten Salon vorbei‘ – zeigen (womöglich bis möglichst höchstens da – kollektiv synchronisiert) ihre Strumpfbänder – eben lieber brav (bürgerlich) verschämt überhaupt (durchaus eventuell verständlicherweisen und schon gar) nicht (öffentlich) – vor.]
#hierfoto

![]() Also Vorsicht bitte! Jetzt/Hier wird es
ziemlich heftig: Denn auf und gegenüber dem ‚weißen Rauschen‘ – oder gar
dem entsprechend ‚rein‘ erscheinenden Kleid – wirkt ja nicht allein das.
vielleicht eher weniger verpönte Blau, recht verstörend als – gleich gar
das recht unterschiedlich bedingte, blutige – Rot. – Wobei weniger
Tabuisierungen peinlicher, unhygienischer Totschlagsgemetzel und deren –
immerhin biologisch zyklischen – quasi Gegenteilsoptionen
geleugnet werden, als des Blaus komplementäre Gesamtzusammenhangsperspektive,
und des Rots fehlersensitive Detailvereinzelung
illustriert sein sollen.
Also Vorsicht bitte! Jetzt/Hier wird es
ziemlich heftig: Denn auf und gegenüber dem ‚weißen Rauschen‘ – oder gar
dem entsprechend ‚rein‘ erscheinenden Kleid – wirkt ja nicht allein das.
vielleicht eher weniger verpönte Blau, recht verstörend als – gleich gar
das recht unterschiedlich bedingte, blutige – Rot. – Wobei weniger
Tabuisierungen peinlicher, unhygienischer Totschlagsgemetzel und deren –
immerhin biologisch zyklischen – quasi Gegenteilsoptionen
geleugnet werden, als des Blaus komplementäre Gesamtzusammenhangsperspektive,
und des Rots fehlersensitive Detailvereinzelung
illustriert sein sollen.
Nur sind und werden, bis wären, gerade auch – ja eben gerade nicht notwendigerweise immer nur völlig beliebig rauschende - Korrelationen erklärungsbedürftig – so dass/da (zumal ‚im Vorhinein‘) weder ausgeschlossen werden kann, dass die Korrelation hauptsächlich, bis allein, von den sie (gar durchaus intersubjektiv als solche) Beobachtenden gemacht wird, noch, dass sie von Dritten (etwa innerraumzeitlichen und/oder insofern ‚transzendenten‘ Erklärungsvariablen) getragen bzw. ‚bewirkt‘/beeinflisst, bis etwa mehr oder minder synchronisiert, wird.
Berühmt-berüchtigte Beispiele, wie der (hier gar emblematisch verwendete) Rückgang der Storchenpopulation, am Neusiedelersee zur Zeit der Industriealisierung zusammen mit zurückgehenden menschlichen Geburtenraten, illustrieren nur und immerhin eine (forschungsstrategisch besonders bedeutsame/nützliche – da auflösbare/erklärliche) Problemseite des Korrelation-versus-Kausalität-Widerspruchs (mechanisch. summenverteilungspardigmatischer Denkformen).
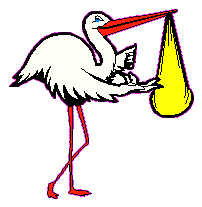 Dass/Falls ebem
Dinge, Ereignisse und/oder Personen zusammen/benachbart sein/werden können ohne
voneinander abhängig respektive bedingt ... mag Kausalitätsfanatiker, bis
achtsame Leute, schon affizieren.
Dass/Falls ebem
Dinge, Ereignisse und/oder Personen zusammen/benachbart sein/werden können ohne
voneinander abhängig respektive bedingt ... mag Kausalitätsfanatiker, bis
achtsame Leute, schon affizieren.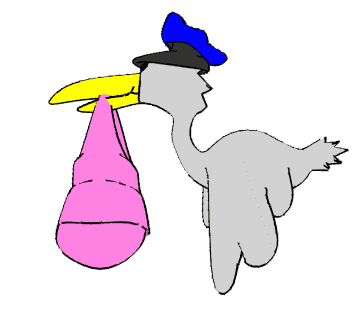 [‚Korrelation‘ ist also nicht (länger) nur Ausdruck des Vorwurfs, bis Befundes, einen
falschen ursächlich Zusammenhang zwischen zwei (sich
eben beide, als von einer/mehreren anderen beeinflusste bis bestimmte) Variablen zu behaupten/unterstellen,
sondern könnte auch dem (eher unbekanntlich/ungern) erreichten wissenschaftlichen Forschungsverrständnis nahe kommen/entspringen: regelmäßig
mit welcher Wahrscheinlichkeit aufeinanderfolgene Zustände, anstatt (deren)
‚Ursachen‘, zu beschreiben/erkennen]
[‚Korrelation‘ ist also nicht (länger) nur Ausdruck des Vorwurfs, bis Befundes, einen
falschen ursächlich Zusammenhang zwischen zwei (sich
eben beide, als von einer/mehreren anderen beeinflusste bis bestimmte) Variablen zu behaupten/unterstellen,
sondern könnte auch dem (eher unbekanntlich/ungern) erreichten wissenschaftlichen Forschungsverrständnis nahe kommen/entspringen: regelmäßig
mit welcher Wahrscheinlichkeit aufeinanderfolgene Zustände, anstatt (deren)
‚Ursachen‘, zu beschreiben/erkennen]
 Zumindest nicht weniger wichtig, doch eher noch
schwieriger erkennbar, bzw. inzwischen noch massiver verstellt an und von der Voraussetzung,
dass es Zusammenhänge gibt, wird deren (mindestens dialektische)
‚Rückseite‘, dass es dann zumindest auch die denkerische Möglichkeit, bzw. damit bereits eine Behauptung, von Nichtzusammenhängendem
gebe(n
müsste). Einen Kern dieser
Schwierigkeit hat immerhin Leonardo Da Vinci
Zumindest nicht weniger wichtig, doch eher noch
schwieriger erkennbar, bzw. inzwischen noch massiver verstellt an und von der Voraussetzung,
dass es Zusammenhänge gibt, wird deren (mindestens dialektische)
‚Rückseite‘, dass es dann zumindest auch die denkerische Möglichkeit, bzw. damit bereits eine Behauptung, von Nichtzusammenhängendem
gebe(n
müsste). Einen Kern dieser
Schwierigkeit hat immerhin Leonardo Da Vinci
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() .......
.......![]()
![]() ausformuliert: «Gib einem Menschen zwei unzusammenhängende Gedanken und
etwas Zeit, so wird er einen Zusammenhang finden, er kann gar nicht anders.»
ausformuliert: «Gib einem Menschen zwei unzusammenhängende Gedanken und
etwas Zeit, so wird er einen Zusammenhang finden, er kann gar nicht anders.»
 Eine weitere gewichtige Ausdrucks-Form dieses
Problemsyndroms wird abendländisch vereindeutigendem
bzw. reduktionistischem Debken, namentlich aus Asien
bzw. ‚holistischerseits‘, ‚egoismuskritisch‘ pointiert, vorgehalten: Das
individuelle Subjekt, namens ‚i/Ich‘ (oder gar ‚Selbst‘)
denke –
in Folge der analytischen Trennung des und im Denken/s in Einzahlen / im singular – tatsächlich vom anderen Menschen/Wesen (bis
überhaupt Allem) getrennt zu sein (ygl. auch
Norbert Elias wider diese Sichtweise ‚aus der
Goldfischglas-Perspektive‘ drüben beim Bemerken/Entdecken des Kulturellen und Soziologischen
als Forschungsgegenstand), das aber sei (insgesamt gesehen, gleich gar als Absolutum/Universum) nicht wahr, etwa bereits
feldtheoretisch und empirisch – beim
Perspektivenwechsel, wenn also das Verbindende anstatt dem Trennenden
gesucht/genannt wird – widerlegt – den «Alles hängt mit Allem zusammen»-Grundsatz
grundsätzlich.
Eine weitere gewichtige Ausdrucks-Form dieses
Problemsyndroms wird abendländisch vereindeutigendem
bzw. reduktionistischem Debken, namentlich aus Asien
bzw. ‚holistischerseits‘, ‚egoismuskritisch‘ pointiert, vorgehalten: Das
individuelle Subjekt, namens ‚i/Ich‘ (oder gar ‚Selbst‘)
denke –
in Folge der analytischen Trennung des und im Denken/s in Einzahlen / im singular – tatsächlich vom anderen Menschen/Wesen (bis
überhaupt Allem) getrennt zu sein (ygl. auch
Norbert Elias wider diese Sichtweise ‚aus der
Goldfischglas-Perspektive‘ drüben beim Bemerken/Entdecken des Kulturellen und Soziologischen
als Forschungsgegenstand), das aber sei (insgesamt gesehen, gleich gar als Absolutum/Universum) nicht wahr, etwa bereits
feldtheoretisch und empirisch – beim
Perspektivenwechsel, wenn also das Verbindende anstatt dem Trennenden
gesucht/genannt wird – widerlegt – den «Alles hängt mit Allem zusammen»-Grundsatz
grundsätzlich.
Nein danke, ![]() aus
jener einen, kosmisch-ominösen Dienstbotenstreit-Ecke
dort drunten äh drüben des Meinens (wo gar zunächst das Objektiv der
Fotokamera war), hält sich eben ‚eigentlich‘ jede wohlerzogene
Schlossbegleitung sonst strengstens, äh ganz, heraus.
aus
jener einen, kosmisch-ominösen Dienstbotenstreit-Ecke
dort drunten äh drüben des Meinens (wo gar zunächst das Objektiv der
Fotokamera war), hält sich eben ‚eigentlich‘ jede wohlerzogene
Schlossbegleitung sonst strengstens, äh ganz, heraus.
#hierfoto



‚Oh Schreck – oh Schreck!
– Was soll ich müssen Können?‘ 
Denn das mit dem Wechsel der Modalitäten vom schwarzen Blazer zur roten
Blazer-Jacke  ist ja eher harmlos (innerakademisch geschlossen
akzeptabel[es entweder-ja-oder-nein]) – verglichen mit der,
eben gar einsam im ‚roten Rock‘ (der Fehlerfahndung/Verfehlungen)
ist ja eher harmlos (innerakademisch geschlossen
akzeptabel[es entweder-ja-oder-nein]) – verglichen mit der,
eben gar einsam im ‚roten Rock‘ (der Fehlerfahndung/Verfehlungen)
#hierfoto

[Gar zudem auch noch, das wenigstens brav in der
Schuldecke ihrer Abweichungstrafempfangs breites /
inspirationsgeschlossenes Knien
#hierfoto
 verweigernde, ungezogen provozierende
(satisfaktionsunfähige) Personen]
verweigernde, ungezogen provozierende
(satisfaktionsunfähige) Personen]
#hierfoto



nur allein auf sich selbst – ok und/oder allenfalls (doch eben ontologisch existenziell gerade als solches bestritten) empirisch Vorfindliches, bis sonst Jemand/Etwas – gestellt / ‚beschränk‘, bis ‚genial‘ – bemühten [Abb. Bergsteigerin],

hier immer wieder, und
wider, neu, in die bedrohlich dunkle rote ‚para-
bis pseudo-Ecke‘ (griechisch:) ‚halb‘,
‚bloß‘ und ‚daneben‘ repräsentierend/bezeichnend ![]()
#hierfoto


bis (‚pseudo‘) ganz hinaus aus den etablierten Wissenschaften, [Abbs.] #hierfoto




nicht einmal immer ganz so allein in ihren eigenen wirklichkeitenhandhaberischen – längst nicht immer nur – Garten oder etwa Reputationshierechie-Treppe des doppelten Tolleranzprinzips,
#hierfoto


#hierfoto




gestalten, (namentlich in Schutzräune bis Türme) verbannten Unschuld äh (mindestens Ideen-)Schwangeren oder alt-erfahrenen Delinquentin(en), an der Wand hinunter zur schließlich peinlicherweise stets dahinter- und daruntergesehen haben werdenden (aller Wissenschaften) Majestät Geschichte.
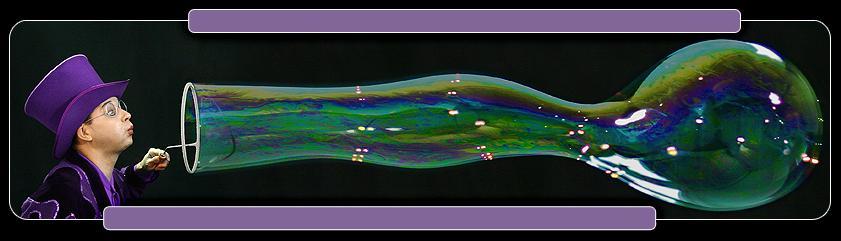 Bereits
seit #hier
Bereits
seit #hier![]() Aristoteles ‚urkundlich‘
belegt und namentlich von #hier
Aristoteles ‚urkundlich‘
belegt und namentlich von #hier![]() Immanuel Kant korrigiert werden – und zwar ‚neben‘ und
‚in‘/‚für‘ Raum und Zeit bis ‚außerhalb‘ davon, und
diese(n Schlosshof drunten) gar ‚umfassend‘
– vom und zum (jedenfalls vernünftig) verstehenden
Denken (in/als wiedermal zwölf – bzw. genauer: viermal
dreierlei – Konzepte/Kategorien eingeordnete) axiomatische, a-priorisch
gesetzte und kaum (noch) überhaupt (zudem nicht als solche – alles Vorfindliche
inklusive des Denkens selbst, begreifbar einteilende – Voraussetzungen
eingestanden) bemerkte, basale Denkformen / Hyper-Sphärenhüllen verwendet:
Immanuel Kant korrigiert werden – und zwar ‚neben‘ und
‚in‘/‚für‘ Raum und Zeit bis ‚außerhalb‘ davon, und
diese(n Schlosshof drunten) gar ‚umfassend‘
– vom und zum (jedenfalls vernünftig) verstehenden
Denken (in/als wiedermal zwölf – bzw. genauer: viermal
dreierlei – Konzepte/Kategorien eingeordnete) axiomatische, a-priorisch
gesetzte und kaum (noch) überhaupt (zudem nicht als solche – alles Vorfindliche
inklusive des Denkens selbst, begreifbar einteilende – Voraussetzungen
eingestanden) bemerkte, basale Denkformen / Hyper-Sphärenhüllen verwendet:
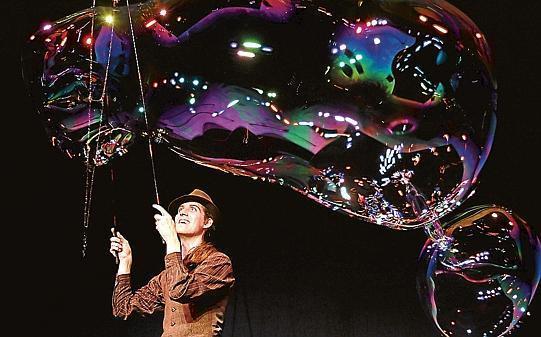 [Triple-X – damals/hier
verkörpert von Barbara Bach, als Anya Amasova, gar verdächtig anfällig für: ‚des
Beeinflussens‘ verabredungsorientierte Erklärungsreflexe – lege
Zusammenhänge zwischen dieser ‚Tabelle/Liste‘ und der Gliederungsstruktur des
[Triple-X – damals/hier
verkörpert von Barbara Bach, als Anya Amasova, gar verdächtig anfällig für: ‚des
Beeinflussens‘ verabredungsorientierte Erklärungsreflexe – lege
Zusammenhänge zwischen dieser ‚Tabelle/Liste‘ und der Gliederungsstruktur des ![]() Institutes für Wesentliches offen
– inzwischen, aufgrund des unabwendlich fortzuschreibenden Bündnisses BeRiT gegenwärtiger Gemeinwesen
Institutes für Wesentliches offen
– inzwischen, aufgrund des unabwendlich fortzuschreibenden Bündnisses BeRiT gegenwärtiger Gemeinwesen ![]() mit Wissenschaften, Technik
und Ökonomie,
mit Wissenschaften, Technik
und Ökonomie, ![]() drüben,
droben bei/in jenen, für alle, Modalitäten ‚angesiedelt‘
erinnerlich]
drüben,
droben bei/in jenen, für alle, Modalitäten ‚angesiedelt‘
erinnerlich] 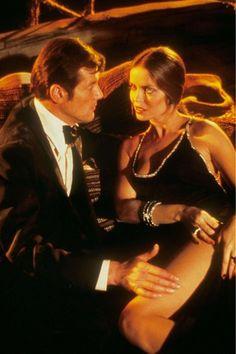
Der [sic!
singularisch doch mehrerer] Quantität[en – immerhin nacheinander/stückweise –
bemerken dürfend]:
Einheit (das Mass – ordnende Einteilungen
auf unterschiedlichen Skalennniveaus
bedeutend, und Zuweisungen an/als ‚innen oder außen‘-Konzepte
bedingend) –
Immerhin, bereits und ausgerechnet des Raumes bedürftig, drunten über das rein Arithmetische
hinausgehend.
Vielheit (die, namentlich mathematische, bis messbare, Größe – was ja einer, bis
der, indogermanischen Verengung, bis Verirrung, des Denkens auf den Singular
entspringen mag, namentlich ohne das – dann/so eben auch noch zum Einzigen/Alles
verabsolutierte/vergottete – (bekanntlich von Martin Buber so bezeichnete)
‚Ungeheuer der Anderheit‘ los zu werden)
Allheit
(das Ganze)
Zwar nicht etwa, wie viele meinen, ein Qualitätsaspekt, doch ist ‚die‘ Allheit,
sind Ganzheiten – vielleicht, bis auf (gleich gar indiividualitätslose) quantenphysikalische
‚Elementarteilchen‘, ihrer ‚inneren Struktur‘ nach – qualitativ anders, als
(abendländische) Homogenitätsvorstellungen, namentlich der Auflösung all der
Teile zum Ganzen, unterstellen/verlangen.
Der [sic! Singularisch, oder doch allerlei] Qualität:
Realität
– Zu ‚der‘/denen Phantasie, Virtualität etc. eher mit dazugehören, denn ausgerechnet Gegenteile
davon wären – und zumindest im asiatischen Denkgebrauch bzw. sino-tibetischen Sprachverständnissen (soweit und wo
überhaupt) nur pluralisch / stets
Mehrzahlen / Vielfalten (gar nicht allein immerhin stets alternativer Wahrnehmungsperspektiven) existent.
Negation
– Weder grundsätzlich ‚böse‘, noch nur so negativ wie verdächtigerweise
bereits übliche Namen dafür sagen: ‚Nein‘,
nicht und Nichts/Leere (ohnehin längst nicht ein und Dasselbe) finden zudem – jedenfalls
semitisch und asiatisch – unterschiedliche sprachlich-denkerische
Ausdrucks- und Benennungsformen.
Limitation
(Einschränkung/Grenzziehung/Definition) Was
auch für Grenzen gilt, die sogar Kreativität anzuregen und insbesondere
Sicherheit zu vermitteln vermägen, gerade falls und
wo sie nicht absolut undurchlässig erkannt sind/werden,
und ein zumindest menschenfreundliches Grenzregiem
herrscht/vorstellbar.
Der [sic!
singularisch] Relation (für die hier weder allein die Mathematik
noch drüben nur die andere
Schlossanlage ‚zuständig‘ ist):
der Inhärenz und
Subsistenz (substantia et accidens)
– Substanz (zumal was [die]
Reproduzierbarkeitsfelsen, doch auch was Erinnerung
angeht)
der
Kausalität und Dependenz (Ursache und Wirkung,
bis/mit, gar wechselwirkenden, Abhängigkeiten) und zwar in allen (vier aristotelischen) Varianten
der Gemeinschaft [sic! so
bis heute. nicht etwa nur Aristoteles bis Kant. in basaler, namentlich psychologischer, Verkennung sozialer
‚Makrokosmen‘] (Wechselwirkung zwischen
dem Handelnden und Leidenden) – Gesellschaft/Bewusstheitenfeldern
(zumal des Gemeinwesens).
Der [sic!
singularisch-ambivalent gedeuteten/verwendeten] Modalität:
Möglichkeit – Unmöglichkeit
(wo bzw. wonach, bis wogegen, ‚sich‘ alle hier im
Schloss ‚beheimateten‘ – wohl fünfzehn – modalen Einzelaspekte des
überhaupt Wissbaren-Seins/Werdens – ob
vorfindlich, vorstellbar oder nicht – sortieren, oder gar überwinden lassen)
«Nach dem was ich heute, zumal von Ihnen, gelernt habe – geht es (nicht mehr, oder noch
nicht).» (Bemerkte die gute Lehrerin/Dozentin
abschließend.)
Dasein
– Nichtsein (jene drittens/erstens um aktuell Unentschiedenes, bis so Unentscheidbare, zu ergänzende Entscheidungsdimension immerhin, doch nur, über Objekte von ‚Ja und Nein‘, in denen
sich auch Auswirkungen der Subjekte zeigen)
vielleicht
im (dann und dazu gar gegenteilsärmeren,
bis freien) ‚Existenzbegriff‘
vergleichsweise [sic! M.E.d.M.] besser zu benennen/verstehen: Die, des Subjekts, kaum unempfindbare eigene Vorhandenheit
zu leugnen, fällt gewöhnlich schwer, jene des/eines Gegenübers als (folglich
determinierte) Projektion
ansehen, bis behandeln, zu wollen, vielleicht leichter als dies mit/von sich selbst zu versuchen –
gar tückische Selbstauflösungswünsche (bzw. quasi ‚ersatzweise‘
solche aller Weltwirklichkeit/en) und/aber
auch, mehr oder minder, überwindungsbefähigende Angebote der
Selbstbegrenzungen, bis qualifizierter Aufhebung/en,
zumindest der/des Selbst/e, lassen grüßen. Zudem mit den Einwänden – gleich gar namentlich Südostasiens, bis
immerhin des Hebräischen הויה – verbunden, Seiendes Werdendem nicht wesentlich vorzjehen,
überordnen oder unterwerfen zu müssen – denn okzidentale Philosophie neigt/e immer wieder dazu, Zeiten (scheinbar, doch summenverteilungspardigmatisch
‚zu Gunsten des [zudem also singularisierend, bis bewegungslosen, möglichst
ausdehnungslosen überhöhten] Raumes‘) zu vernachlässigen..
Notwendigkeit - Zufälligkeit ein eher komplementär zusammenwirkendes, denn etwa ein
Gegensatzpaar, das (namentlich in der abendländischen
Geistesgeschichte) lange
Zeit bis (‚weltweit‘/kulturenübergreifend) weiterhin heteronomistisch,
als Determinismus
missverstanden, bzw. als – vorgeblich Entscheidungsverantwortlichkeit
ersetzender – Zwang
erwünscht, wird.
Reine Wissenschaftlichkeitsansprüche werden bekanntlich nicht nur behauptet, sondern (und
sei es bereits daher) auch häufig, bis heftigm bestritten
(und manche, die sie durchaus haben äh
hätten verzichten, jedenfalls ausdrücklich, bis scheinbar darauf – ohne auf
zuverlässige Kenntnisse/Wissen im weiteren Sinne ... Sie wissen schon):
Eine Schwierigkeit der auf
was auch immer – außer oder gar in bis mit den beiden Tolleranzprinzip
der Vernunft/en angesichts ihrer eigen epjisemologischen Grenzen gegenüber dem / Unterschieden zum
ontologisch Erscheinen (vgl. Kurt Hübner) - zu überprüfenden Reinheit(en) bestehe ja in
den verschiedenen bis vermischten 'Größen- und Komplexitäts-Dimensionen' der kandisierenden oder beschuldigten Vorstellungshorizonte und
Vorgehensweisen.
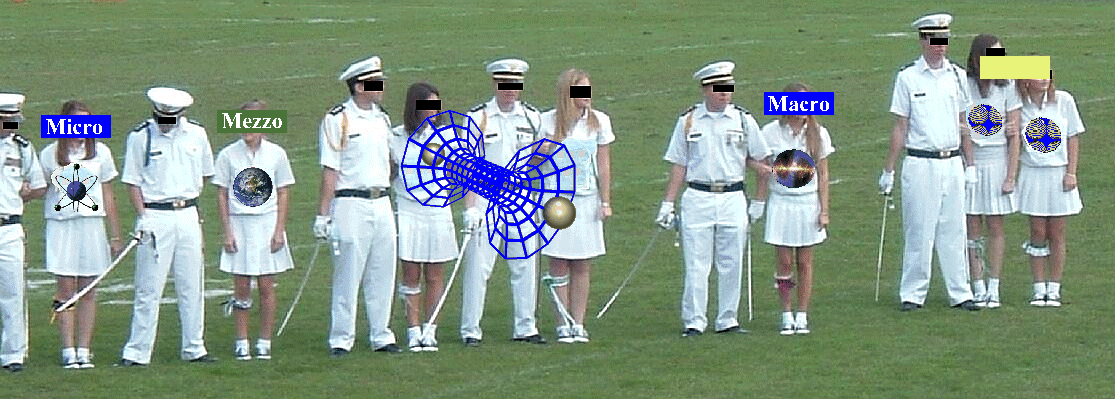
Für einzelne Methoden, einzelne Hypothesen
(oder Aussagen bis Behauptungen), ganze Theorien
(zumindest aber Aussagesysteme) oder ganze Erkenntnisbereiche bzw.
Forschungsdisziplinen, sollten bis würden - je nach Analyse-Ebene
unterschiedliche - Abgrenzungskriterien zur Anwendung kommen:
So lasse sich etwa 'Erklärungskraft' von
(im weiteren Sinne) Theorien einfordern, nicht
aber von Untersuchungsmethoden.
Und wo gleich eine ganze Disziplin betrachtet
werde, ließen sich auch psychologische und soziologische Aspekte
berücksichtigen, was bei einer Theorie als abstraktem
Objekt – gar ebenso irrigerweise, wie die
übrigen modalen Aspekte nicht von Etwas ausgeschlossen werden/bleiben
können oder müssen – , namentlich etwa von ![]() Martin Mahner, für 'sinnlos'
zu erklären versucht wird.
Martin Mahner, für 'sinnlos'
zu erklären versucht wird. 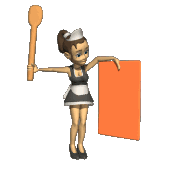 Das Paradoxon des 'inhaltlich' wohl latent
heftigsten Schimpfwortes in Debatten um Forschungsmittelverteilung äh
Wissenschaftlichkeit besteht ja darin, dass es zwar individuellen, bis
kollektiv, und immerhin systematisierenden, Sinn
stiften kann - vielleicht sogar zweckfrei, oder immerhin grundlegende, anstatt
unmittelbar anwendungsorientierte –
Wissenschaften zu betreiben, diese [Wissenschaften] aber – etwa mit Albert Keller –
gerade weder Sinn suchen, noch (auch nicht alle
zusammen genommen) welchen zu finden/fangen vermögen (was mindestens vor
seinem Zerlegen eher 'stiften geht'). Und speziell der, rhetorisch mit dem
Sprachgebrauch häufig zu kaschieren versuchte, Vorwurf 'unvernünftig, 'irrationale und wie (böse) das
sonst noch so heißen mag, zu sein, macht ja allenfalls überredenden, apellativ überwältigen aollendden
'Sinn' – also konkurierende Interessenlagen offenbar.
- Zudem führen Diskussionen nicht immer notwendigerweise, auch nicht bei oder
durch Annäherung der beteiligten bis betroffenen Parteien, nur zur Verbesserung der eingebrachten
Ausgangspositionen, und nicht einmal der Hypothen/Behauptungen
Klärung läßt
'sich' immer garanteiren (von der suggestion
eines einflisses auf je Dinge und Ereignisse dadurch,
dass über sie/davon geredet wird bereits abgesehen; vgl. Ar.Na.
GmbH).
Das Paradoxon des 'inhaltlich' wohl latent
heftigsten Schimpfwortes in Debatten um Forschungsmittelverteilung äh
Wissenschaftlichkeit besteht ja darin, dass es zwar individuellen, bis
kollektiv, und immerhin systematisierenden, Sinn
stiften kann - vielleicht sogar zweckfrei, oder immerhin grundlegende, anstatt
unmittelbar anwendungsorientierte –
Wissenschaften zu betreiben, diese [Wissenschaften] aber – etwa mit Albert Keller –
gerade weder Sinn suchen, noch (auch nicht alle
zusammen genommen) welchen zu finden/fangen vermögen (was mindestens vor
seinem Zerlegen eher 'stiften geht'). Und speziell der, rhetorisch mit dem
Sprachgebrauch häufig zu kaschieren versuchte, Vorwurf 'unvernünftig, 'irrationale und wie (böse) das
sonst noch so heißen mag, zu sein, macht ja allenfalls überredenden, apellativ überwältigen aollendden
'Sinn' – also konkurierende Interessenlagen offenbar.
- Zudem führen Diskussionen nicht immer notwendigerweise, auch nicht bei oder
durch Annäherung der beteiligten bis betroffenen Parteien, nur zur Verbesserung der eingebrachten
Ausgangspositionen, und nicht einmal der Hypothen/Behauptungen
Klärung läßt
'sich' immer garanteiren (von der suggestion
eines einflisses auf je Dinge und Ereignisse dadurch,
dass über sie/davon geredet wird bereits abgesehen; vgl. Ar.Na.
GmbH). 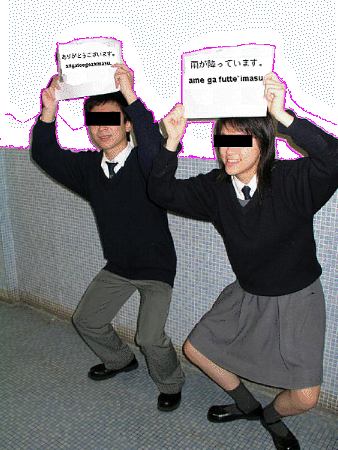
Gerade in der Geschichte der heutigen Naturwissenschaften waren es sehr häufig und wiederholt einzelne – auch schon mal, vom Sir Isaak bis Einstein, anerkennend als 'Riesen' (von deren Schultern aus sie bis wir nun etwas weiter sehen könnten) bezeichnete/erkannte - Forscherpersönlichkeiten, die auf ganz unterschiedliche weise mit sehr verschiedenem theoertischem Hintergrund praktizierten und Technologien entwickelten. Insbesonder die physikalischen Großforschungsprojekte, etwa von der Astronomie über CERN bis zur Zyklen-Forschung sind eher junge/gegenwärtige personalintensive Phänomene. Und Theorien werden noch immer weniger dadurch erledigt, dass die sie entwickelt habende Autorität sich – gar da ihre Schüler sie bereits widerlegten - 'für eines Besseren belehrt' erklärt (wie es immerhin mit einzelnen Hypothesen durchaus kritisch geschieht), sondern erledigen sich meist eher auf generativem Wege.
[Abb. HKM Eherenspalier für Perslnlichkeiten] Und Intellektuelle im qualifizierten Sinne J.O.y.G.'s sind (noch) immer eher – auch unter jenem vielen fleißig leistenden und guten (gar mindestens promovierenden) Leuten, die heute aufopferungsvolle und genaue Wissenschaft/en bereiben – wenige/besondere Einzelne.
#hierfoto


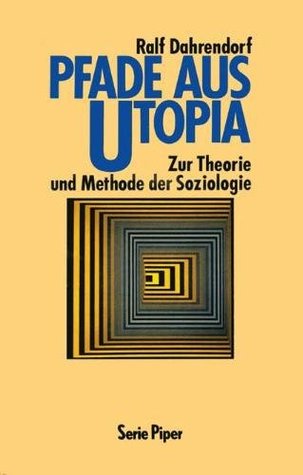 Möglichkeitenstufen
das Geschehen überhaupt (jedenfalls ex post, also
bereits – zumindest einmal und womöglich auch nur einmalig so –
eingetretenes/erschienenes, fientisches) umfassend zu
begreifen mit Lord Ralf:
Möglichkeitenstufen
das Geschehen überhaupt (jedenfalls ex post, also
bereits – zumindest einmal und womöglich auch nur einmalig so –
eingetretenes/erschienenes, fientisches) umfassend zu
begreifen mit Lord Ralf:
![]() Für die «literarische Dignität», also die
Fülle und Farbigkeit von Dingen und Ereignissen (bzw. Personen; O.G.J.) ist
nötig:
Für die «literarische Dignität», also die
Fülle und Farbigkeit von Dingen und Ereignissen (bzw. Personen; O.G.J.) ist
nötig:
![]() Alle Perspektiven (alle Primärerfahrungen) zu
einem (sekundären Erfahrungs-) Ergebnis/Ereignis erhoben
Alle Perspektiven (alle Primärerfahrungen) zu
einem (sekundären Erfahrungs-) Ergebnis/Ereignis erhoben
![]() WIRKLICHKEIT aufgrund systematischer Erfahrung
REDUZIEREN (analytisch modellieren)
WIRKLICHKEIT aufgrund systematischer Erfahrung
REDUZIEREN (analytisch modellieren)
![]() Nicht mehr auf Einzelereignisse bezogen,
sondern auf allgemeine und strukturelle Zusammenhänge bildet THEORETISCHE
ERFAHRUNG (theoretisches Modellieren)
Nicht mehr auf Einzelereignisse bezogen,
sondern auf allgemeine und strukturelle Zusammenhänge bildet THEORETISCHE
ERFAHRUNG (theoretisches Modellieren)
![]() „Geistiges (gar 'Religiöses', auch
Spirituelles)“ i.w.S. Bemühen um INTUITIONs- bis
'HEUREKA'-,WEISHEITs-
„Geistiges (gar 'Religiöses', auch
Spirituelles)“ i.w.S. Bemühen um INTUITIONs- bis
'HEUREKA'-,WEISHEITs-
oder gar 'OFFENBARUNG's-ERFAHRUNG
![]() Physiologische Erfahrung etwa durch haptischen
bzw. sonstigen Sinneskontakt, das eigene Tund und
Unterlassen insgesamt hat erhebliche Wechselwirkungen mit Bewusstheiten
und (auf) 'Denken' - (nicht nur andersherum).
Physiologische Erfahrung etwa durch haptischen
bzw. sonstigen Sinneskontakt, das eigene Tund und
Unterlassen insgesamt hat erhebliche Wechselwirkungen mit Bewusstheiten
und (auf) 'Denken' - (nicht nur andersherum).
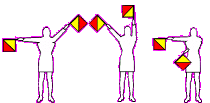 Etwa Martin
Mahner legt (namens seiner bis der Skepsis) einen sehr wichtigen, qualitativen
Kriterienkatalog vor, die tendenzielle alle notwendig seien, aber/und eben -
durchaus immerhin im Widerspruch zu den reduktionistischen Prinzipien (auch
darunter) – zumindest je einzeln oder als wenige Allzweckkriterien, eben nicht
immer hinreichen könnten, um 'seriöse' Wissenschaften zu
legitimieren äh einzuschließen.
Etwa Martin
Mahner legt (namens seiner bis der Skepsis) einen sehr wichtigen, qualitativen
Kriterienkatalog vor, die tendenzielle alle notwendig seien, aber/und eben -
durchaus immerhin im Widerspruch zu den reduktionistischen Prinzipien (auch
darunter) – zumindest je einzeln oder als wenige Allzweckkriterien, eben nicht
immer hinreichen könnten, um 'seriöse' Wissenschaften zu
legitimieren äh einzuschließen. 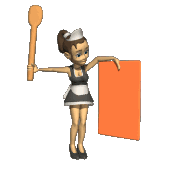 Was den ungehörigen Eindruck nicht recht zu
vertreiben vermag, dass dahinter/davor doch, respektive noch immer, ein 'mechanisch-antikontingentes'
/ 'mono- bis multikausalstisches' / 'szientistisches'
Überhaupt- äh Grundverständnis vom
Funktionieren der Wirklichkeit/en, und ein bestenfalls nullsummenpardigmatisches
('Materie' versus äh 'Geist' aus derselben), wo nicht das
geläufige Über- und Unterordungsstreben von 'nur
subjektiv unzuverlässigenm (bis intersubjektiven) 'Glaubens-'/Vertrauensvorläufigkeiten'
unter 'endlich objektivierte Wissenssicherheitsendgültigkeiten', als (vielleicht
brav äh treu unreflektierte) Denkformselbstverständlichkeiten, stehen / abtauchen / harren / lauern.
Was den ungehörigen Eindruck nicht recht zu
vertreiben vermag, dass dahinter/davor doch, respektive noch immer, ein 'mechanisch-antikontingentes'
/ 'mono- bis multikausalstisches' / 'szientistisches'
Überhaupt- äh Grundverständnis vom
Funktionieren der Wirklichkeit/en, und ein bestenfalls nullsummenpardigmatisches
('Materie' versus äh 'Geist' aus derselben), wo nicht das
geläufige Über- und Unterordungsstreben von 'nur
subjektiv unzuverlässigenm (bis intersubjektiven) 'Glaubens-'/Vertrauensvorläufigkeiten'
unter 'endlich objektivierte Wissenssicherheitsendgültigkeiten', als (vielleicht
brav äh treu unreflektierte) Denkformselbstverständlichkeiten, stehen / abtauchen / harren / lauern.
 Ja, die eine jedenfalls indoeuropäische Denkkrankheit (-übergebung zum Sigular) hat
einen Namen: Sie heißt Monokausalitis.
Immerhin Medizinfachleute und Heilkundige können wissen,
bis nebenan jeweils aktuell 'bemerken'/wahrnehmen, dass/wie unzureichend die
Suche nach Allein(schuld)ursachen
(gerade/selbst in/an einem [Symptome] auslößenden
Geschehen) ist/wird.
Ja, die eine jedenfalls indoeuropäische Denkkrankheit (-übergebung zum Sigular) hat
einen Namen: Sie heißt Monokausalitis.
Immerhin Medizinfachleute und Heilkundige können wissen,
bis nebenan jeweils aktuell 'bemerken'/wahrnehmen, dass/wie unzureichend die
Suche nach Allein(schuld)ursachen
(gerade/selbst in/an einem [Symptome] auslößenden
Geschehen) ist/wird.
 [Abb. HKM versteckt hinter dem Gedanken – paradoxerweise
jenem empiristischen ohne sie zu erkennen, hervorlugend]
[Abb. HKM versteckt hinter dem Gedanken – paradoxerweise
jenem empiristischen ohne sie zu erkennen, hervorlugend]
#hierfoto




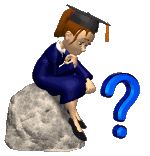 «Mit welchen Objekten beschaftigt sich die zu untersuchende Disziplin?»
«Mit welchen Objekten beschaftigt sich die zu untersuchende Disziplin?»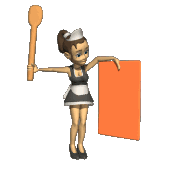 Nur
– spätestens drunten auf dem blanken Felsen der Reproduzierbarkeiten,
und nicht erst drüben im menschlichen Ahnen-Können,
bei Ihrer Durchlaucht der Grammatica – verbieten,
erledigen oder entziehen sich/einem gerade die Fragen nach den Subjekten nicht
notwendigerweise (etwa dadurch, dass sie zu Objekten erklärt und oder wie
solche be- bis misshandelt sind/werden – respektive
indem modale Einzeldisziplinen gleich aus den akademischen Wissenschaftenkanon
entfernt ... Sie wissen schon).
Nur
– spätestens drunten auf dem blanken Felsen der Reproduzierbarkeiten,
und nicht erst drüben im menschlichen Ahnen-Können,
bei Ihrer Durchlaucht der Grammatica – verbieten,
erledigen oder entziehen sich/einem gerade die Fragen nach den Subjekten nicht
notwendigerweise (etwa dadurch, dass sie zu Objekten erklärt und oder wie
solche be- bis misshandelt sind/werden – respektive
indem modale Einzeldisziplinen gleich aus den akademischen Wissenschaftenkanon
entfernt ... Sie wissen schon).
![]() Mit konkreten (gar 'materiell' genannten
- und eine 'Materie von Witz und Geist' womöglich brav was auch immer s/wollend?)
oder mit im naturwissenschaftlichen Sinne immateriellen (gar 'spirituell' zu
nennenden – und andere Abstrakta, wie mathematische, analytische oder gar
semiotische - durchaus Untersuchungsobjekte - eher – was auch immer gerde [nicht] passen mag)?
Mit konkreten (gar 'materiell' genannten
- und eine 'Materie von Witz und Geist' womöglich brav was auch immer s/wollend?)
oder mit im naturwissenschaftlichen Sinne immateriellen (gar 'spirituell' zu
nennenden – und andere Abstrakta, wie mathematische, analytische oder gar
semiotische - durchaus Untersuchungsobjekte - eher – was auch immer gerde [nicht] passen mag)?
![]() «Werden diese Gegenstande
gesucht, um Erklarungen fur
bestimmte Beobachtungen zu gewinnen oder nur um vorgefertigte Meinungen zu
stutzen?»
«Werden diese Gegenstande
gesucht, um Erklarungen fur
bestimmte Beobachtungen zu gewinnen oder nur um vorgefertigte Meinungen zu
stutzen?» 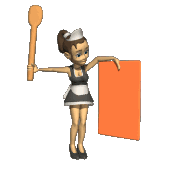 Ausgerechnet
Letzteres entspricht allerdings genau der, philosophisch weitgehend konsensualen, Definition von dadurch qualifiziertem Wissen
im engeren Sinne, dass es sich dabei um ein ernstlich behauptetes und (zumal
mit Gegenargumenten) begründetes Meinen handelt für das aber (drittens)
geeignete – es also zumindest widerlegen könnende – empirische
Überprüfungsmöglichkeiten in/an der Realität gefunden werden. - 'Was sollte
oder köbnnte Wissen denn auch sonst sein?' (Julian Nida-Rümmeln)
Ausgerechnet
Letzteres entspricht allerdings genau der, philosophisch weitgehend konsensualen, Definition von dadurch qualifiziertem Wissen
im engeren Sinne, dass es sich dabei um ein ernstlich behauptetes und (zumal
mit Gegenargumenten) begründetes Meinen handelt für das aber (drittens)
geeignete – es also zumindest widerlegen könnende – empirische
Überprüfungsmöglichkeiten in/an der Realität gefunden werden. - 'Was sollte
oder köbnnte Wissen denn auch sonst sein?' (Julian Nida-Rümmeln)
![]() „Sind diese Gegenstande spezifisch genug, um
die Daten zu erklaren, oder wurde ein beliebiges
[sic!] anderes Objekt die gleiche Erklarungsleistung
erbringen?“
„Sind diese Gegenstande spezifisch genug, um
die Daten zu erklaren, oder wurde ein beliebiges
[sic!] anderes Objekt die gleiche Erklarungsleistung
erbringen?“ 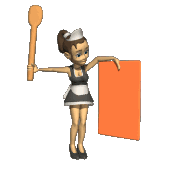 So
formuliert bis gemeint – und auch ohne den überzogenen Beliebigkeitsaspekt,
oder gar mit jenem von Handlungssubjekten – fliegt einem das wichtige Argument
spezifischer Relaabilität und hinreichender
Validität, bereits recht schmerzlich um ziemlich heiße Ohren, wo brav – gar so
wohl akzeptierte/etablierte wie die evolutionsnaturalistischen,
evolutionsbiologischen, evolutionspsychologischen, evolutionssoziologischen pp.
- alles erklärende Allzweck-'Variablen', zudem gerne auf aller höchstem
Verallgemeinerungsniveau, verfochten werden: wie etwa 'um zu überleben (sei
vorteilhaft bis erforderlich)', 'weil die natürliche Ordnung es so vorsieht',
'da es dem Gemeinwohl dient' oder auch 'Ambrosis Heilkraut', 'Manna', 'der
Stein der Weisen' etc. (bis weil Überich äh Gott es so will/tut). Es
muss nicht gerade (oder allenfalls Reduktionismen) erstaunen, wie leicht 'sich' (von 'suchenden'
oder 'wachen' Menschen) viele (weitere) Erklärungsgegenstände oder
beteiligte Wesen finden lassen, zumal solche die, bzw. deren Einflüsse, schwer
bis gar nicht (wie - oh Schreck - namentlich jene, oft selektiv
übersehenen bis bestritten, der modalen Wahrheitsaspekte sämtlicher Einzelwissenschaften)
zu falsifizierten sind. - Die wohl entscheidene
(epistemologische) Schwierigkeit (etwa auch der 'Wiener' und Sir Karl Reimund's) am pragmatischen Kausalitätsnachweis (der daher
eben – etwa im Unterschied zum, dann
'positiv getestet auf' genannten, chemischen oder physikalischen Reacktions-/Indikationsbefund eines Stoffes [das heißt
immerhin einer 'Gruppe' davon] - bloß ein wichtiger Hinweis bleibt); Dass (die,
wenn vielleicht auch begründbar doch axiomatisch, unabhänig
gesetzte) 'Varaiable x' ursächlich für (die
'abhängige Größe) y' sei, da sie messbar mit ihr korreliert - ist eben, dass es
auch dann empirisch nur dies (korrelieren) tut, wenn alle übrigem Faktoren –
und selbst dies nur nach alleiniger Massgabe der
aktuell verfpgbaren Messgenauigkeiten und Un-Kentnisse über Nicht-Exisitenzen
anderer Varaibler weiterseits
– ausgeschlossen/isoliert (eher und immerhin 'erscheinen', denn es absolut) sind.
Das Delta derDreckigenDaten
im Nordosten der Forschungsinsel mag größer sein/werden, als manche Leute einsehen wollen oder
dürfen, und/aber als für so manche fakische, äh 'Praxis'
genannte bis geschimpfte, Nutzanwendung / Wirksamkeit wichtig ist (gerade
'wer heilt' hat nämlich nicht notwendigerweise recht,
sondern Macht, äh 'Erfolg',
und damit vielleicht Neider, sicher aber, gar nicht allein unangehmme,
Verantwortung).
So
formuliert bis gemeint – und auch ohne den überzogenen Beliebigkeitsaspekt,
oder gar mit jenem von Handlungssubjekten – fliegt einem das wichtige Argument
spezifischer Relaabilität und hinreichender
Validität, bereits recht schmerzlich um ziemlich heiße Ohren, wo brav – gar so
wohl akzeptierte/etablierte wie die evolutionsnaturalistischen,
evolutionsbiologischen, evolutionspsychologischen, evolutionssoziologischen pp.
- alles erklärende Allzweck-'Variablen', zudem gerne auf aller höchstem
Verallgemeinerungsniveau, verfochten werden: wie etwa 'um zu überleben (sei
vorteilhaft bis erforderlich)', 'weil die natürliche Ordnung es so vorsieht',
'da es dem Gemeinwohl dient' oder auch 'Ambrosis Heilkraut', 'Manna', 'der
Stein der Weisen' etc. (bis weil Überich äh Gott es so will/tut). Es
muss nicht gerade (oder allenfalls Reduktionismen) erstaunen, wie leicht 'sich' (von 'suchenden'
oder 'wachen' Menschen) viele (weitere) Erklärungsgegenstände oder
beteiligte Wesen finden lassen, zumal solche die, bzw. deren Einflüsse, schwer
bis gar nicht (wie - oh Schreck - namentlich jene, oft selektiv
übersehenen bis bestritten, der modalen Wahrheitsaspekte sämtlicher Einzelwissenschaften)
zu falsifizierten sind. - Die wohl entscheidene
(epistemologische) Schwierigkeit (etwa auch der 'Wiener' und Sir Karl Reimund's) am pragmatischen Kausalitätsnachweis (der daher
eben – etwa im Unterschied zum, dann
'positiv getestet auf' genannten, chemischen oder physikalischen Reacktions-/Indikationsbefund eines Stoffes [das heißt
immerhin einer 'Gruppe' davon] - bloß ein wichtiger Hinweis bleibt); Dass (die,
wenn vielleicht auch begründbar doch axiomatisch, unabhänig
gesetzte) 'Varaiable x' ursächlich für (die
'abhängige Größe) y' sei, da sie messbar mit ihr korreliert - ist eben, dass es
auch dann empirisch nur dies (korrelieren) tut, wenn alle übrigem Faktoren –
und selbst dies nur nach alleiniger Massgabe der
aktuell verfpgbaren Messgenauigkeiten und Un-Kentnisse über Nicht-Exisitenzen
anderer Varaibler weiterseits
– ausgeschlossen/isoliert (eher und immerhin 'erscheinen', denn es absolut) sind.
Das Delta derDreckigenDaten
im Nordosten der Forschungsinsel mag größer sein/werden, als manche Leute einsehen wollen oder
dürfen, und/aber als für so manche fakische, äh 'Praxis'
genannte bis geschimpfte, Nutzanwendung / Wirksamkeit wichtig ist (gerade
'wer heilt' hat nämlich nicht notwendigerweise recht,
sondern Macht, äh 'Erfolg',
und damit vielleicht Neider, sicher aber, gar nicht allein unangehmme,
Verantwortung).
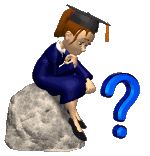 „Kann
frei [sic!] geforscht werden oder werden die Resultate von einer Autoritat [sic!] vorgegeben?
„Kann
frei [sic!] geforscht werden oder werden die Resultate von einer Autoritat [sic!] vorgegeben?
Ist der Bereich ideologisch motiviert?“ 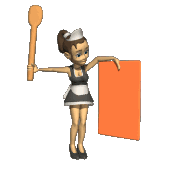 Bereits
und auch abgesehen davon, dass es eher interessierte bis popularisierte
Wissenschaftsausdeutungen sind, die Freiheit
überhaupt (gar beinahe konsequent bis inklusive der als 'Forschungsfreiheit'
bezeichneten) weltanschaulich bis -handhaberisch deterministisch, äh
'naturwissenschaftlich' genannt, zu leugnen pflegen und versuchen –
erinnern so mache, der, gar unverzichtbaren, administrativen
Begutachtungsweisen respektive Diplomierungsverfahren, und redaktioneller
Kriterien, über Pragmatiken äh
Praktiken bis Einflüsse der wissenschaftlich hinreichend etablierten
Zeitschriften, Forenbetreugen, Gesprächsleitungen
etc. mit ihrem – durchaus autoritativen äh wichtigen und stehts
riskierten – Renommee, nicht immer (erst persönlich, gar nachteilig oder
abweichend, davon betroffene bis abgeschreckte oder sich so vorkommende Leute)
an Massstäbe für indeologie-
oder herrschaftsfrei und undogmatisch gehaltenen Vorgehens. Gerade auf der und
für die Forschungsinsel wirkt bis ist das 'Delta der
Verleger', respektive der Zitationsindices, nicht selten auch als ein
hochselektives Nadelöhr äh Sperrwerk erkennbar bis wirkmächtig; und
selbst/gerade das Internet könnte auch nur ein 'vorläufiger', gar noch
selektionsbedürftigerer Weg ... Sie
wissen schon. - Zumindest falls und wo jemand zuerst 'nobelpreisgekürt'
sein muss, um sich (auch nur) seine (und vereinzelt auch schon ihre)
Forschungsgegenstände 'unabhängig'/souverän aussuchen zu können – sind
Ambivalenzen wissenschaftlichen Massenbetreibes
erkennbar.
Bereits
und auch abgesehen davon, dass es eher interessierte bis popularisierte
Wissenschaftsausdeutungen sind, die Freiheit
überhaupt (gar beinahe konsequent bis inklusive der als 'Forschungsfreiheit'
bezeichneten) weltanschaulich bis -handhaberisch deterministisch, äh
'naturwissenschaftlich' genannt, zu leugnen pflegen und versuchen –
erinnern so mache, der, gar unverzichtbaren, administrativen
Begutachtungsweisen respektive Diplomierungsverfahren, und redaktioneller
Kriterien, über Pragmatiken äh
Praktiken bis Einflüsse der wissenschaftlich hinreichend etablierten
Zeitschriften, Forenbetreugen, Gesprächsleitungen
etc. mit ihrem – durchaus autoritativen äh wichtigen und stehts
riskierten – Renommee, nicht immer (erst persönlich, gar nachteilig oder
abweichend, davon betroffene bis abgeschreckte oder sich so vorkommende Leute)
an Massstäbe für indeologie-
oder herrschaftsfrei und undogmatisch gehaltenen Vorgehens. Gerade auf der und
für die Forschungsinsel wirkt bis ist das 'Delta der
Verleger', respektive der Zitationsindices, nicht selten auch als ein
hochselektives Nadelöhr äh Sperrwerk erkennbar bis wirkmächtig; und
selbst/gerade das Internet könnte auch nur ein 'vorläufiger', gar noch
selektionsbedürftigerer Weg ... Sie
wissen schon. - Zumindest falls und wo jemand zuerst 'nobelpreisgekürt'
sein muss, um sich (auch nur) seine (und vereinzelt auch schon ihre)
Forschungsgegenstände 'unabhängig'/souverän aussuchen zu können – sind
Ambivalenzen wissenschaftlichen Massenbetreibes
erkennbar. 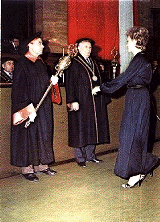 Nicht
weniger wesentlich (für anstatt etwa gegen die Freiheit),
als solch – hinreichend brav, immerhin oberflächlich/formal, gehorsame -
soziale Reverenzen (bereits mit w-Laut)
sind und bleiben aber, die höchst Ideen (und
konsequenter, namentlich 'loguscher', Treue zu ihnen)
verdächtigen/'hoffnungsschwangeren', zumindest arttig-darauf
bezogenen bis strengen Referenzen an die/der jeweiligen (oder eigens
entwickelten) Disziplinen ihren Einschränkungen und Vorgaben methodischer und
denkerischer Arten: Grenzen, die zwar
überhaupt erst, gerne dem sowohl ein- als auch ausschließenden Umfang/Rand einer Münze analogisiert, dieser Sache Unterscheidbarkeit (vom vorfindlichen 'ganzen
Rest der Welt/en') möglich machen,
dann und daher aber nicht grenzenlos – sondern allenfalls irrigerweise dafür
gehalten/ausgegeben bis solcher beschuldigt, oder den (bekanntlich insbesondere
zwischen bereits etablierten wissenschaftlichen Disziplinen besonders
fruchtbaren) Grenzübertritt (mehr oder minder gelungen) regelnd – sein/werden können. - Spätestens seit/mit Habermaß & Co. erweißt sich
der Ideologievorwurf, (insbesonderer
unaufgeklärter Aufklärungsverfechtung westlicher Moderne; vgl. Bazon
Brock) bekanntlich als rhetorischer Bumerang, der einem bereits
die brave Unterwerfung, unter die, oder wenigstens die Anerkennung der,
Regeln – namentlich jene der abweixhenden Gegner
(respektive jene, die oder deren Handhabung ich ändern will) –, nicht
notwendigerweise erleichtern muss oder auch nur soll. Vielmehr ist Etwas
(oder gleich gar Jemand) nicht etwa deswegen, weil es (konsensual anerkanntermaßen)
Wissenschaft ist, frei von allen, ja gerne so verpönten,
Zirkelschlüssigkeiten (und sonstigen – zumal 'sachfremd' zu nennenden -
Zusammenhängen): Hingegen werden – oder immerhin gehören – diese a-priorischen Axiome, Definitionen, Arbeits-Hypothesen,
Theorien, Modelle und sämltlche Quellen plus
Hilfsmittel (sowie die ursprünglichen Daten mit Operationalisierungen pp., was faktisch meist
– keineswegs nur/erst in der Auftragsforschung - die größeren Probleme
macht) transparent offen gelegt/'reingeschreiben',
und können - mehr oder minder plausiebel
nachvollziehbar (anstatt etwa 'zwingend') - begründet
sein/werden. - Ohne indes je die ganze/n Wirklichkeit/en – allenfalls deren
selektive Beschreibungsversuche bis Repräsentationen und zugleich interessante.
äh interessierte Teile davon - sein/werden zu können. [Abbs. HKM-Spalier am roten Tepich
für Minigolfbälle]
Nicht
weniger wesentlich (für anstatt etwa gegen die Freiheit),
als solch – hinreichend brav, immerhin oberflächlich/formal, gehorsame -
soziale Reverenzen (bereits mit w-Laut)
sind und bleiben aber, die höchst Ideen (und
konsequenter, namentlich 'loguscher', Treue zu ihnen)
verdächtigen/'hoffnungsschwangeren', zumindest arttig-darauf
bezogenen bis strengen Referenzen an die/der jeweiligen (oder eigens
entwickelten) Disziplinen ihren Einschränkungen und Vorgaben methodischer und
denkerischer Arten: Grenzen, die zwar
überhaupt erst, gerne dem sowohl ein- als auch ausschließenden Umfang/Rand einer Münze analogisiert, dieser Sache Unterscheidbarkeit (vom vorfindlichen 'ganzen
Rest der Welt/en') möglich machen,
dann und daher aber nicht grenzenlos – sondern allenfalls irrigerweise dafür
gehalten/ausgegeben bis solcher beschuldigt, oder den (bekanntlich insbesondere
zwischen bereits etablierten wissenschaftlichen Disziplinen besonders
fruchtbaren) Grenzübertritt (mehr oder minder gelungen) regelnd – sein/werden können. - Spätestens seit/mit Habermaß & Co. erweißt sich
der Ideologievorwurf, (insbesonderer
unaufgeklärter Aufklärungsverfechtung westlicher Moderne; vgl. Bazon
Brock) bekanntlich als rhetorischer Bumerang, der einem bereits
die brave Unterwerfung, unter die, oder wenigstens die Anerkennung der,
Regeln – namentlich jene der abweixhenden Gegner
(respektive jene, die oder deren Handhabung ich ändern will) –, nicht
notwendigerweise erleichtern muss oder auch nur soll. Vielmehr ist Etwas
(oder gleich gar Jemand) nicht etwa deswegen, weil es (konsensual anerkanntermaßen)
Wissenschaft ist, frei von allen, ja gerne so verpönten,
Zirkelschlüssigkeiten (und sonstigen – zumal 'sachfremd' zu nennenden -
Zusammenhängen): Hingegen werden – oder immerhin gehören – diese a-priorischen Axiome, Definitionen, Arbeits-Hypothesen,
Theorien, Modelle und sämltlche Quellen plus
Hilfsmittel (sowie die ursprünglichen Daten mit Operationalisierungen pp., was faktisch meist
– keineswegs nur/erst in der Auftragsforschung - die größeren Probleme
macht) transparent offen gelegt/'reingeschreiben',
und können - mehr oder minder plausiebel
nachvollziehbar (anstatt etwa 'zwingend') - begründet
sein/werden. - Ohne indes je die ganze/n Wirklichkeit/en – allenfalls deren
selektive Beschreibungsversuche bis Repräsentationen und zugleich interessante.
äh interessierte Teile davon - sein/werden zu können. [Abbs. HKM-Spalier am roten Tepich
für Minigolfbälle]
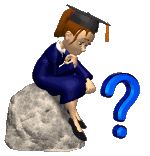 “Welche
philosophischen Hintergrundannahmen werden [also; O.G.J.] vorausgesetzt?“
Respektive welcher (auch sprachlich-denkerich drüben im Können brav dem ökonomischen Vorstellungshorizont untergeordnete –
bis gar ethisch-moralisierend wirkenden) Wert(e)kanon verfolgt? Teils drastisch unterschieden sich „die
Annahmen, die in den Realwissenschaften [sic! Eine Wortwahl die recht deutlich
machen könnte, dass für vorfindlich Gehaltenes ontologisch suggeriert
respektive, nicht weniger selektiv äh inversiv
Möglichkeiten existenziell bestritten werden sollen] vorausgesetzt werden“ von un- oder parawissenschaftkichen:
“Welche
philosophischen Hintergrundannahmen werden [also; O.G.J.] vorausgesetzt?“
Respektive welcher (auch sprachlich-denkerich drüben im Können brav dem ökonomischen Vorstellungshorizont untergeordnete –
bis gar ethisch-moralisierend wirkenden) Wert(e)kanon verfolgt? Teils drastisch unterschieden sich „die
Annahmen, die in den Realwissenschaften [sic! Eine Wortwahl die recht deutlich
machen könnte, dass für vorfindlich Gehaltenes ontologisch suggeriert
respektive, nicht weniger selektiv äh inversiv
Möglichkeiten existenziell bestritten werden sollen] vorausgesetzt werden“ von un- oder parawissenschaftkichen:
![]() z.B. Gesetzmäßigkeitsprinzip,
z.B. Gesetzmäßigkeitsprinzip, 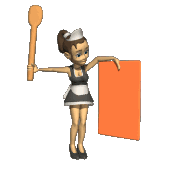 Gerade
die mechanistische Tradition der Philosophie (seit Kopernikus; vgl. Dieter Hartrupp) ist nicht nur (seit dem 20, Jahrhundert, wenn
auch – gleich gar öffentlich bis gesellschaftlich - kaum bemerkt und
schon gar nicht akzeptiert) wissenschaftstheoretisch widerlegt, sondern auch
die empirischen Befunde moderener Naturwissenschaften
haben das – zudem verdehrte Verständnis von
Gesetzesvorstellungen (die ja überall sonst gerade kontrafaktische Gültigkeit
durchzusetzen haben) – durch storchastische
Wahrscheinlichkeitskonzepte (die zumindest nie 100% erreichen allenfalls einmal
0%) und den formellen Wechsel zur besseren Sprachform ersetzt: Dass
Wissenschaften Zustände (gar von Systemen) beschreiben bis untersuchen, die mit
angebabarer Wahrscheinlichkeit reproduzierbar, unter angebbaren Bedingungen auf vorhergehene
folgen. (Genau genommen sogar ohne zu behaupten/fordern, dass sie davon
verursacht wären/würden.) Doch auch wo/falls weiterhin gehorsam der
traditionelle begriffliche Tribut geleistet/erbracht wird, wäre, mit Richard Heinzmann,
anzuerkennen, dass es sich bei den wissenschaftkichen
Zusammenhängen und Formeln eben (entgegen dem ausdrücklich suggerierten
Wortlaut) gerade nicht um die Gesetze der Natur (oder etwa jene der Kultur/en)
handelt – sondern mittels des menschlichen Denkens
werden Beobachtungen (idealerweise von so für notwendig erachteten
Regelmäßigkeiten) beschreiben, die nie das Letzte, Ganze oder Tiefeste an/in/von der Natur,
Kultur, Gesellschaft, dem Geist etc. begriffen haben und bereits daher immer
wieder der Korrektur (durch andere, bis der
Selbstkorrektur) bedürfen.
Gerade
die mechanistische Tradition der Philosophie (seit Kopernikus; vgl. Dieter Hartrupp) ist nicht nur (seit dem 20, Jahrhundert, wenn
auch – gleich gar öffentlich bis gesellschaftlich - kaum bemerkt und
schon gar nicht akzeptiert) wissenschaftstheoretisch widerlegt, sondern auch
die empirischen Befunde moderener Naturwissenschaften
haben das – zudem verdehrte Verständnis von
Gesetzesvorstellungen (die ja überall sonst gerade kontrafaktische Gültigkeit
durchzusetzen haben) – durch storchastische
Wahrscheinlichkeitskonzepte (die zumindest nie 100% erreichen allenfalls einmal
0%) und den formellen Wechsel zur besseren Sprachform ersetzt: Dass
Wissenschaften Zustände (gar von Systemen) beschreiben bis untersuchen, die mit
angebabarer Wahrscheinlichkeit reproduzierbar, unter angebbaren Bedingungen auf vorhergehene
folgen. (Genau genommen sogar ohne zu behaupten/fordern, dass sie davon
verursacht wären/würden.) Doch auch wo/falls weiterhin gehorsam der
traditionelle begriffliche Tribut geleistet/erbracht wird, wäre, mit Richard Heinzmann,
anzuerkennen, dass es sich bei den wissenschaftkichen
Zusammenhängen und Formeln eben (entgegen dem ausdrücklich suggerierten
Wortlaut) gerade nicht um die Gesetze der Natur (oder etwa jene der Kultur/en)
handelt – sondern mittels des menschlichen Denkens
werden Beobachtungen (idealerweise von so für notwendig erachteten
Regelmäßigkeiten) beschreiben, die nie das Letzte, Ganze oder Tiefeste an/in/von der Natur,
Kultur, Gesellschaft, dem Geist etc. begriffen haben und bereits daher immer
wieder der Korrektur (durch andere, bis der
Selbstkorrektur) bedürfen. 
![]() Kausalitatsprinzip,
Kausalitatsprinzip, 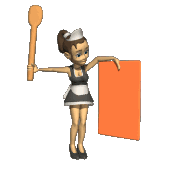 Verbkeibt dem alltagssprachlichen Verständnis von bewirken
und erklären – in dessen Vorstellungshorizont wissenschaften
überhaupt nichts erklären (Vgl. Albert Keller). Deren sogenannte
'Geistessektionen' immerhin zu erinnern vermögen, dass die heute omnipräsente
Causa efficuens / Wirkursächlichkeit nicht die
einzige ... Sie wissen schon.
Verbkeibt dem alltagssprachlichen Verständnis von bewirken
und erklären – in dessen Vorstellungshorizont wissenschaften
überhaupt nichts erklären (Vgl. Albert Keller). Deren sogenannte
'Geistessektionen' immerhin zu erinnern vermögen, dass die heute omnipräsente
Causa efficuens / Wirkursächlichkeit nicht die
einzige ... Sie wissen schon.
![]() Sparsamkeitsprinzip,
Sparsamkeitsprinzip, 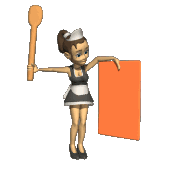 Ein
namentlich Willhelm von Ockhamm
zugeschreibenes 'Rasiermesser' des reduktionismus, das ja bereits Artistotesles
kannt. Und das sich gar nicht so selten als irrig erwisen hat und gerade auch von seinem Namenspadron
qualifiziert relativiert, also in Beziehungen gesetzt anstatt verabsolutiert
wurde.
Ein
namentlich Willhelm von Ockhamm
zugeschreibenes 'Rasiermesser' des reduktionismus, das ja bereits Artistotesles
kannt. Und das sich gar nicht so selten als irrig erwisen hat und gerade auch von seinem Namenspadron
qualifiziert relativiert, also in Beziehungen gesetzt anstatt verabsolutiert
wurde.
![]() Fallibilismus usw.
Fallibilismus usw. 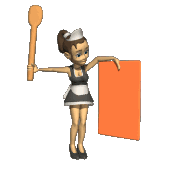 Der
auch mit Sir Karl Reimnund Popper, eher durch die
(zumindest teils selbst vorwegnehmbaren) kritischen
Widerlegungsversuche durch die ganzen übrigen Fachleute der entsprechenden
Wissenschaftsdisziplinen – also qua qualifizierter Duskzssion
– funktioniert, als durch den Versuch, die eigenen Positionen und Einsichten
selbst zu widerlegen (sondern sie eher so zu gestalten, dass sie 'gut' - sprich
lange - standhalten können – ohne dazu völlig unwiderlegbar gemacht werden zu
dürfen).
Der
auch mit Sir Karl Reimnund Popper, eher durch die
(zumindest teils selbst vorwegnehmbaren) kritischen
Widerlegungsversuche durch die ganzen übrigen Fachleute der entsprechenden
Wissenschaftsdisziplinen – also qua qualifizierter Duskzssion
– funktioniert, als durch den Versuch, die eigenen Positionen und Einsichten
selbst zu widerlegen (sondern sie eher so zu gestalten, dass sie 'gut' - sprich
lange - standhalten können – ohne dazu völlig unwiderlegbar gemacht werden zu
dürfen).
#hier
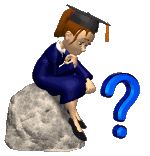 Analytische Philosophie fragt bekanntlich nicht ontologisch
danach was ein Forschungsgegenstand ist, oder was (wenigstens diesbezüglich)
epistemologisch überhaupt, wie erkennbar wäre - sondern, genau und systematisch
danach, was ein bestimmter, bis die
jeweils verwendeten/entscheidenden, insbesondere sprachlichen
– doch auch alle anderen semiotischen –, Ausdrücke,
wem, wann und wozu bedeuten?
Analytische Philosophie fragt bekanntlich nicht ontologisch
danach was ein Forschungsgegenstand ist, oder was (wenigstens diesbezüglich)
epistemologisch überhaupt, wie erkennbar wäre - sondern, genau und systematisch
danach, was ein bestimmter, bis die
jeweils verwendeten/entscheidenden, insbesondere sprachlichen
– doch auch alle anderen semiotischen –, Ausdrücke,
wem, wann und wozu bedeuten?  Dabei
und dazu wird also weder behauptet noch bestritten, dass es einen (anderen)
Gegenstand bzw. ein Ereignis (als semiotische
Interaktionen) gäbe, noch werden Aussagen über deren Erkennbarkeit, die
Erfahrbarkeiten ihrer Eigenschaften und so weiter gemacht – sondern Hypothesen
über die Bedeutungen, bis Wirkungen, von Sätzen geprüft. Denn diese, etwa Worte und andere, nonverbale Zeichen sind/werden
jene Repräsentationen der Dinge, Ereignisse und/oder
Personen: Zu und mit denen (mehr oder minder deutlich respektive achtsam
ausgeformten - meist sogenannten) Abbildungen / Vorstellbarkeiten 'im Sinn' – bereits mit Ludwig Wittgenstein, nicht
etwa 'im Kopf oder Gehirn', wie dertzeit oft brav
gebildet zu hören ist bis synchron zu bekennen verlangt wird – sich
Menschen (mehr oder minder 'entsprechend') verhalten.
- Denn für eine wichtige, abweichende
Bedeutung sollte, um des (gerade auch eigenen) Verstehens
willen – zumal mittels westlicher bis
wissenschaftlicher Sprachausdifferenzierungen denkend – auch ein anderes respektive genau spezifiziertes
'Wort' verwendet, und nicht etwa sparsam alles (gar pantheistisch; vgl. Karl
Rahner gegen derartige 'Unsauberkeit des Denkens') für ein und das Selbe (große Ganze) gehalten/genommen/gegriffen, werden.
Dabei
und dazu wird also weder behauptet noch bestritten, dass es einen (anderen)
Gegenstand bzw. ein Ereignis (als semiotische
Interaktionen) gäbe, noch werden Aussagen über deren Erkennbarkeit, die
Erfahrbarkeiten ihrer Eigenschaften und so weiter gemacht – sondern Hypothesen
über die Bedeutungen, bis Wirkungen, von Sätzen geprüft. Denn diese, etwa Worte und andere, nonverbale Zeichen sind/werden
jene Repräsentationen der Dinge, Ereignisse und/oder
Personen: Zu und mit denen (mehr oder minder deutlich respektive achtsam
ausgeformten - meist sogenannten) Abbildungen / Vorstellbarkeiten 'im Sinn' – bereits mit Ludwig Wittgenstein, nicht
etwa 'im Kopf oder Gehirn', wie dertzeit oft brav
gebildet zu hören ist bis synchron zu bekennen verlangt wird – sich
Menschen (mehr oder minder 'entsprechend') verhalten.
- Denn für eine wichtige, abweichende
Bedeutung sollte, um des (gerade auch eigenen) Verstehens
willen – zumal mittels westlicher bis
wissenschaftlicher Sprachausdifferenzierungen denkend – auch ein anderes respektive genau spezifiziertes
'Wort' verwendet, und nicht etwa sparsam alles (gar pantheistisch; vgl. Karl
Rahner gegen derartige 'Unsauberkeit des Denkens') für ein und das Selbe (große Ganze) gehalten/genommen/gegriffen, werden. 
Mit vergleichbar komplexen Wissenschaftsverständnissen – wie dem hier zu skizzieren versuchenten – lie0e sich wohl auch qualifizierter Holismus (zumindest eher als der – sich heute gerne 'naturwissenschaftlich' gebende doch unaufgeklöärte – empiristische Scientismus) vereinbaren – der und sofern er nicht seinerseits in eines der gänigen dualistischen (gar für 'mystisch' inspiriert gehaltenen, aber mythischen) Ordnungsparadigmen hinein reduzuert, als ganze Allheit, äh Einheit, ausgegeben wird.
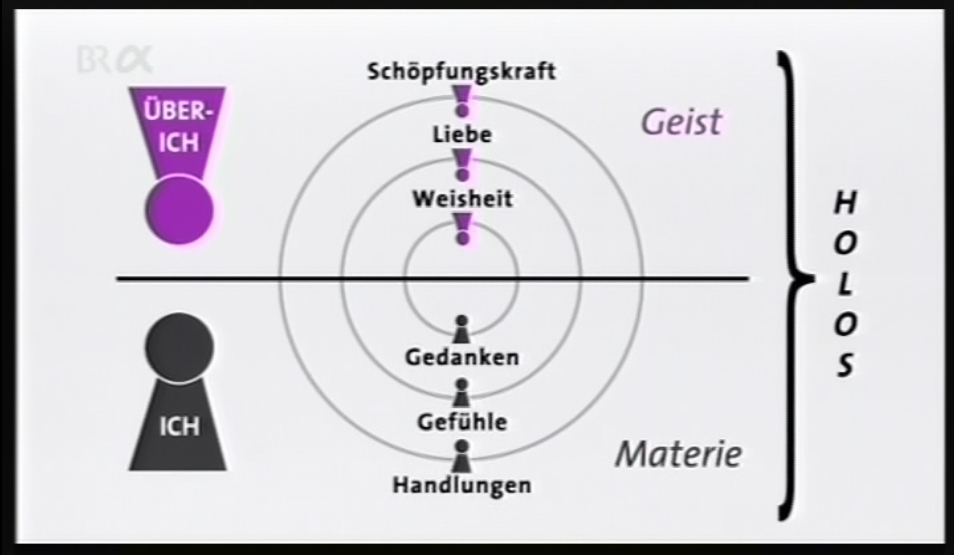
Die sich immer wieder selbst bestätigend, etwa ich (Gedanken – Gefühle – Handlungen) vom Überich (Weisheit – Liebe - Schöpimgskraft) äh eben doch wiedermal Geist von Materie zu scheiden bis vereinigt zu pantheieren trachten.

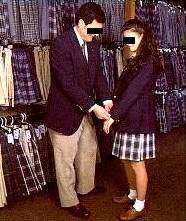
Außer durch den 'offenen' Übergang (der Verbindungswand anstatt Trennmauer) vom schwarzen Salon des Psychischen ist auch der Zugang aus, respektive zu, dem roseroten Treppenhaus und Korridor des physikalischen und – gar verhaltensfaktisch/existenziell zeitgleich und ortsgleich, aber doch/nur alaythisch bis semiotisch (geographisch und chronologisch) deutlich verschieden/versetzt - in den/aus dem französischen Salon des historischen Geschehens herauf/hinab möglich, respektive erfolgend.
Eine der, gar als Überheblichkeit auslegbaren bis auszulegenden - Eigenschaften/Funktionen analytrischen Trennens, spätestens aber des Reduzierene, besteht ja in/aus der Behauptung/Überzeugtheit: 'Feststellen zu können bzw. hinreichend belegt zu haben, dass Etwas (formell namentlich eine Variable/Größe) nicht zu Etwas (bzw. nicht [auf eine damit also andere wirkend] dazu) gehöre (wärend es für manche/andere zumindest aber aus holistischen bzw. gar totalitären und absoluten Sicht[en] des insofern wirklich Ganzen - und sei dies antagonistisch, also immerhin tragende Wand dieses Schlosses - nicht davon trennbar ist, und eben doch ge- bis unterschieden/ge- bis erzählt werden kann bis muss).
Relativiert - also in Beziehung/en - anstatt aitistisch absolut) gesetzt - wird die(se rote) Trennschärfe des Analytidchen ausgerechnet von und zum Psychischen (des und der Memschen) hin und von ihm/Ihnen her. Wogegen 'sich' eben keine Türe zu machen läßt - was prompt dennoch ständig gewünscht bzw. vorgegeben und sogar von sich und anderen verlangt bis behauptet wird.
Die Vielzahlen, bis eine Mehrzahl, abendländischer Zeitgenossen (und sogar mancher Zeitgenosinnen) des ausgehenden 20. und des beginnebdeb 21. Jahrhunderts gingen und gehen recht authentisch überrzeugt davon aus, dass ihre Reaktionen aufgrund von (rationalen/vernünftigen) Überlegungen erfolgen bzw. bestimmt sind. Dabei sind ihre (subjektiven bis sogar kollektiven) Gefühle (einschließlich deren eben auch denkerischer/'sprachlicher' Beeinflussbarkeit/en) weitaus stärler - und insbesondere unausschließbar - beteiligt bis (geradezu '[un]heimlich') dominant.
Wärend sich hin zum - ebenfalls bereits roseroten Korridor und Treppenhaus - immerhin eine Wand mit beidseitig bedienbarer Türe befindet, die durchaus geschlossen gehalten werden kamn (so 'funktioniern' und 'wirken' ja beispielsweise 'Natur', 'Geschichte', 'Sprache', 'Kultur' und 'Gesellschaft' pp. auch ohne, dass wir daran denken und ohne, dass davon Betroffene 'sie' dazu verstehen müssten) und zumindest schon versperrt wurde.
Was nicht nur falsche, sondern auch schon sehr hilfreiche, insofern utopische, Vorstellungen beflügelte, dass sie biologisch, physikalisch mathematisch nicht vorstellbar waren (bis sind) oder erscheinen - dies aber auch 'idealerweise' nicht müssen, respektive - insbesondere was die 'reale' Synthetisierbarkeit gerade unter oft bzw, lange für unverbindbar Gehaltenem/Erklärtem angeht (vgl. Kreativität) - nicht bleiben müssen, und nicht mussten. (Zumindest in den Eigenschaften von Werkstoffen sind technolohisch sehr beeindruckende Kombinationen, bis hin zur Integration von schalt-logischen und selbst von bio-logischen Funktionen vorzufinden - die solchen, die 'natürlicherweise' vorkommen nachgebaut, aus ihnen zusammen- oder auch daneben bis entgegen entwickelt sein, und vor allem eingesetzt - also gelobt bzw. gefürchtet -, werden können.)
Gerade im Unterschied zum dazugehörenden rosaroten Korridor weist der Raum eben ein eigenes Fenster (und zumindest 'Tageslicht' von immerhin zweierlei Seiten - darunter eben auch von Norden her) auf.
Der/ein Konzertflügel, respektive sonstige Musikinstrumente (der menschliche Körper bzw. Leib inklusive), gehört mit zu dem und in den Raum.
 «Bei
der Frage [im engeren Sinne eine Problemstellung – allenfalls/immerhin einer
Diskussion 'um der Himmel willen';
O.G.J.] nach dem Ursprung der Kreativität gibt es verschiedene Ansichten:
Materealisten werden Krativität blosem
[sic!] Zufall zuschreiben,weil sie keine amdere
Erklärung dafür haben.
«Bei
der Frage [im engeren Sinne eine Problemstellung – allenfalls/immerhin einer
Diskussion 'um der Himmel willen';
O.G.J.] nach dem Ursprung der Kreativität gibt es verschiedene Ansichten:
Materealisten werden Krativität blosem
[sic!] Zufall zuschreiben,weil sie keine amdere
Erklärung dafür haben.
Während gläubige [sic!]
Menschen es letztlich als göttliches Schaffen [jedenfalls zumindest eines
Geistes oder Subjektes Existenz nicht gänzlich ausschließen, wenn auch,
namentlich bei/seit den antiken Griechen,
O.G.J. doch zu oft verdächtig essenziell/feinstofflich pp. bereits 'materialiaiert' im dualistischen Summenverteilungshorizont
vorgestellt; mit A.K.] sehen.»
[R.Sh. thinks] «Es gibt eine der Natur [sic! Am/im vorbindlichen Sein/Weerrden] inewohnende Kreativität {gar urbaner Ort dieses unseres/ganzen Wissbarkeits- und Könnensschlosses[. Das drückt sich sowohl im
menschlichen Leben, als auch in der Natur als Ganzes, aus.
Da diese Kreativität auf einer höheren Ordnung [sic!] beruht, die durch uns wirkt, ist sie vielleicht das was Menschen auch gerne 'Inspiration' nennen. [Und damit zumindest unter mechanischen Überblicksgesichtspunkten, wirklich Neues, in dem anspruchsvollen Sinne, dass es der Kreativität quasi 'teleologischich' zuvor nicht bereits bekannt sein müsste, also Offenheit/'Überraschbarkeit des Geistes' - gar mit KoHeLeT's Teilseite 'unter der Sonne'? - aussclössen;
O,G.J.]
Im antiken Kubstverständnis Griechenlands gab es die [bis zu] neun
Musen. Jede einzelne Kunstgattung hat einen eigenen inspirierenden Geist [vgl.
das inzwischen an bzw. in den Grenzen der Gattungen bis
einzelwissenschaftlichen/modalen Forschungsdisziplinen erkennbare, nicht nur geglück auch 'hollistisch' ![]() genannte,
Potenzial des/der Ganzen; O.G.J.], der durch den Künster
sprich. [Vgl. etwa von persönlichen ('Heureka'-)Eindruck 'als ob ich es
nicht selbst' oder 'nicht alleine' bzw. immerhin 'nicht in alltäglichen Bewusseinsmodi gewesen wäre der/die dies Kunstwerk schuf'
bis etwa zum islamischen Unbeeinflusstheitsparadugma des Korantextes, durch die Person bzw.
Niederschriftausfürung des Propheten Mohamed; O.G.J.]
genannte,
Potenzial des/der Ganzen; O.G.J.], der durch den Künster
sprich. [Vgl. etwa von persönlichen ('Heureka'-)Eindruck 'als ob ich es
nicht selbst' oder 'nicht alleine' bzw. immerhin 'nicht in alltäglichen Bewusseinsmodi gewesen wäre der/die dies Kunstwerk schuf'
bis etwa zum islamischen Unbeeinflusstheitsparadugma des Korantextes, durch die Person bzw.
Niederschriftausfürung des Propheten Mohamed; O.G.J.]
Das Wort Musik ist ein Relikt dieser Denkweise [Vgl. dass das Verständnis des 'Kunst'-Begriffs überhaupt auch eine
Wandlung weg vom hand- bzw. mundwerklichen Beherrschen der Techniken, respektive des eiegen Körpers (noch im
Barocjzeitalterm seit/mit Bethofen bis ins 20. Jh, hinein) zum Anspruch, dass einem auch ihnaltlich etwas 'einfallen' müsse, um als Künstler/in zu gelten, durchmachte; mit Si.Ma.].
 Die Griechen
und Römer dachten, dass jeder Mensch seinen eigenen leitenden [gar
insbesondere bis nur durch Denken/Reden beinflussbaren; O.G.J.] Geist hatte.
Wenn heute jemand sagt, Einstein sei ein Genie gewesen, dann meint man nicht
unbedingt, dass ein kreativer Geist durch ihn wirkte - was die ursprüngliche
Bedeutung von 'Genie' war. - Man meint, 'es war
etwas in [sic!] seinem Gehirn [sic!], was ihn besonders schlau machte.'» Bis
hin zu Untersuchungen seines in Formalin konserviertren,Gehirns, wobei «natürlich [sic! methodologischerweise] niemand die Quelle seiner
Inspiration» gefunden habe.
Die Griechen
und Römer dachten, dass jeder Mensch seinen eigenen leitenden [gar
insbesondere bis nur durch Denken/Reden beinflussbaren; O.G.J.] Geist hatte.
Wenn heute jemand sagt, Einstein sei ein Genie gewesen, dann meint man nicht
unbedingt, dass ein kreativer Geist durch ihn wirkte - was die ursprüngliche
Bedeutung von 'Genie' war. - Man meint, 'es war
etwas in [sic!] seinem Gehirn [sic!], was ihn besonders schlau machte.'» Bis
hin zu Untersuchungen seines in Formalin konserviertren,Gehirns, wobei «natürlich [sic! methodologischerweise] niemand die Quelle seiner
Inspiration» gefunden habe.
«Ich [R.Sh.] denke, «die Idee, 'dass Kreazivität durch uns wirkt', ist die traditionelle Ansicht über menschliche Kreativität. Sie deckt sich am Besten mit den Erfahrungen kreativer Menschen.» (Rupert Sheldrake; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.)

Etwa mit Goethe - und selbst bis ausgerechnet Kant - hat das Analytische eine bzw. mehrere Seiten. die (zumindest abendländisch) für und seit Jahrhunderte/n wenig bis kontradiktisch mit dem Ausdruck (und gar der Sache) verbunden sind/werden.

Die
berühmte ‚Tabula smaragdina‘ des Hermes Trismegistos gilt unter anderem als alchemistisches
Grunddokument:
«1. Wahr ist es ohne Lügen, gewiß
und aufs allerwahrhaftigste.
2. Dasjenige, welches Unten
ist, ist gleich demjenigen, welches Oben ist: Und dasjenige, welches Oben ist, ist
gleich demjenigen, welches Unten ist, um zu vollbringen die Wunderwerke eines
einzigen Dinges.
3. Und gleich wie von dem
einigen GOTT erschaffen sind alle Dinge, in der Ausdenkung
eines einigen Dinges. Also sind von diesem einigen Dinge geburen
alle Dinge, in der Nachahmung.
4. Dieses Dinges Vater ist
die Sonne, dieses Dinge Mutter ist der Mond.
5. Der Wind hat es in seinem
Bauche getragen.
6. Dieses Dinges Säugamme ist
die Erde.
7. Allhier
bei diesem einigen Dinge ist der Vater aller Vollkommenheit der ganzen Welt.
8. Desselben Dinges Kraft ist
ganz beisammen, wem es in Erde verkehret worden.
9. Die Erde mußt du scheiden vom Feuer, das Subtile vom Dicken, lieblicherweise, mit einem großei
Verstand.
10. Es steiget
von der Erden gen Himmel, und wiederum herunter zur Erden, und empfanget die Kraf der Oberen- und der Unteren-Dinge.
11. Also wirst du haben die
Herrlichkeit der ganzen Welt. Derohalben wird von dir
weichen aller Unverstand. Dieses einige Ding ist von aller Stärke die Stärkeste Stärke, weil es alle Subtilitäten überwinden und
alle Festigkeiten durchdringen wird.
12. Auf diese Weise ist die
Welt erschaffen.
13. Daher werden wunderliche
Nachahmungen sein,die Art
und Weise derselben ist hierin beschrieben.
14. Und also bin ich genannt
Hermes Trismegistos, denn ich besitze die drei nder Weisheit der ganzer Welt.
15. Was ich gesagt habe von dem Werk der Sonnen, daran fehlet Nichts, es ist ganz vollkommen.» (Thorwald Dethlefsen, S. 28f.)
Zu den (gegenwärtig zumal abendländisch) wohl
wichtigsten/wirkmächtigsten Paradoxafallen des
Analytischen - dass einen nämlich
(jedenfalls) Logik (falls nicht alles Denken) zu überhaupt nichts zu zwingen,
aber allerlei anzuregen vermag – gehören: wohl: [Hochrechnungen
auf Basis von Schätzungen, denen Vermutungen zugrunde liegen, die auf
Spekulationen basieren]
[Hochrechnungen
auf Basis von Schätzungen, denen Vermutungen zugrunde liegen, die auf
Spekulationen basieren] 
![]() Der Reduktionismus .....
Der Reduktionismus ..... 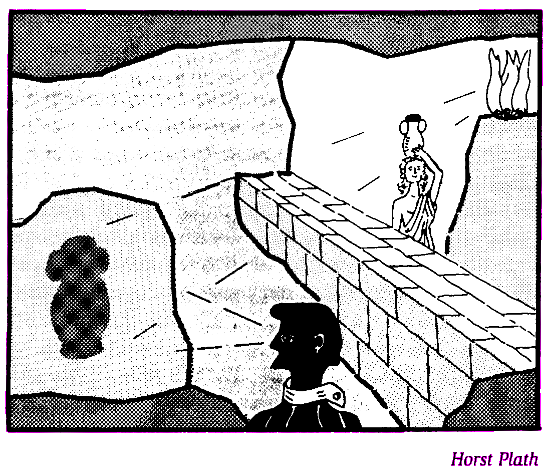 [Spätestens ‚das
[Spätestens ‚das ![]() plaltonische Höhlengleichnis‘, bis etwa ‚die Flachlandparabel‘, lassen –
plaltonische Höhlengleichnis‘, bis etwa ‚die Flachlandparabel‘, lassen – ![]() Holismuen, zumindest ‚den
Holismuen, zumindest ‚den ![]() Herrn
Geheimrat Goethe‘ – in mehreren Dimensionen grüßen]
Herrn
Geheimrat Goethe‘ – in mehreren Dimensionen grüßen]
Eine Hauptschwierigkeit besteht, etwa mit Heribert
Rückert, darin, dass sich aus der (beispielsweise auf die) Detailkenntnis (einzelner
Bildpunkte, und sei es auch sogar wirklich vollständig aller davon
zusammen) kein
in derselben Logik stringent folgerichtiger Weg (quasi ‚mehr‘ oder ‚zurück‘ respektive ‚hinauf‘) etwa zum Eindruck der
Perspektive/n des/im Abgebildeten ergibt - der insgesamt/‚ohne Lupe‘ zu sehen
wäre/war. Gerade, zumindest und immerhin #hier![]() Wilhelm von Ockhamm tritt übrigens als Kronzeuge wider
Verabsolutierungen des so nützlichen, ökonomisch sparsamen, aristotelischen
Prinzips auf: Wenn mehere/konuriderende
Theorien einen Sachverhalt (manche Leute ergängen
- wohl eher kosmetisch - hier brav: ‚gleich gut‘ – was ebenfalls eher verstllt, dass/wie es um Menschenverhalten geht) erklären
würden, sei stets jene vorzuziehen (bis gar die ‚richtige‘ – vernünftigerweise aber immerhin als erste zu
widerlegen/ausschließen/falsifizieren zu versuchen) die am wenigsten Annahmen/Voraussetzugen habe/mache (also am unaufwendigsten
– gerne auch mit ‚am einfachsten/simpelsten zu überblicken‘ oder/bis ‚am klarsten/kontrastreichst-schärfsten
zu verstehen‘ verwechselt respektive gleichgesetzt - sei). Mehr noch
sind/werden Alternativerklärungslosigkeiten in alanytischer
Hinsicht wissenschaftlich/erkenntnistheoretisch eher zum Kennzeichen schlechter
Qualität.
Wilhelm von Ockhamm tritt übrigens als Kronzeuge wider
Verabsolutierungen des so nützlichen, ökonomisch sparsamen, aristotelischen
Prinzips auf: Wenn mehere/konuriderende
Theorien einen Sachverhalt (manche Leute ergängen
- wohl eher kosmetisch - hier brav: ‚gleich gut‘ – was ebenfalls eher verstllt, dass/wie es um Menschenverhalten geht) erklären
würden, sei stets jene vorzuziehen (bis gar die ‚richtige‘ – vernünftigerweise aber immerhin als erste zu
widerlegen/ausschließen/falsifizieren zu versuchen) die am wenigsten Annahmen/Voraussetzugen habe/mache (also am unaufwendigsten
– gerne auch mit ‚am einfachsten/simpelsten zu überblicken‘ oder/bis ‚am klarsten/kontrastreichst-schärfsten
zu verstehen‘ verwechselt respektive gleichgesetzt - sei). Mehr noch
sind/werden Alternativerklärungslosigkeiten in alanytischer
Hinsicht wissenschaftlich/erkenntnistheoretisch eher zum Kennzeichen schlechter
Qualität.
![]() Der (gerade logische) Umkehrschluss – zumal mathematisch und auch
physikalisch - besonders geläufig und beliebte Symetriedenkformen
konfligieren nicht allein basal bis kaum (über die
genannten Fachdusziplinen hinaus überhaupt) bemerkt
mit dem Reduktionismusprinzip, sobdern
auch mit der nächst( 'höhere')n Modalität zeitlich gerichteten (oder zumindest
aktuell so erscheinenden) Verlaufs.
Der (gerade logische) Umkehrschluss – zumal mathematisch und auch
physikalisch - besonders geläufig und beliebte Symetriedenkformen
konfligieren nicht allein basal bis kaum (über die
genannten Fachdusziplinen hinaus überhaupt) bemerkt
mit dem Reduktionismusprinzip, sobdern
auch mit der nächst( 'höhere')n Modalität zeitlich gerichteten (oder zumindest
aktuell so erscheinenden) Verlaufs.
![]() Der (zumal ein logisch korrekt gezogener
– zumal von den, meist bis immer, mehreren möglichen) Induktionsschluss – insbesondere
von ‚Militärs‘ auch ‚Russisch Roulett‘
Der (zumal ein logisch korrekt gezogener
– zumal von den, meist bis immer, mehreren möglichen) Induktionsschluss – insbesondere
von ‚Militärs‘ auch ‚Russisch Roulett‘ ![]() genannt,
da nicht aus vorliegenden Fakten, sondern analog(isierend)
aus Schlussfolgerungen
(gar durchaus ursprünglich aus vorhandenen, aber notwendigerweise
unvollständigen, oft zeitlich und/oder räumlich ‚versetzten‘, zudem
notwendigerweise formell/sprachlich repräsentierten. Gar arbeitsteilig ver- bis übermittelten und meist übersichtlich/summarisch
gruppierten bis sogar gewichteten Faktenkenntnissen – und/oder dafür
Gehaltenem) abgeleitet,
stellt – ‚sich‘ (also für die handelnden Menschen) erst später, bis für
Planungsänderungen zu spät, heraus: Was die Schlüsse wert / wie belastbar die
Indizien empirisch sind bzw. waren.
genannt,
da nicht aus vorliegenden Fakten, sondern analog(isierend)
aus Schlussfolgerungen
(gar durchaus ursprünglich aus vorhandenen, aber notwendigerweise
unvollständigen, oft zeitlich und/oder räumlich ‚versetzten‘, zudem
notwendigerweise formell/sprachlich repräsentierten. Gar arbeitsteilig ver- bis übermittelten und meist übersichtlich/summarisch
gruppierten bis sogar gewichteten Faktenkenntnissen – und/oder dafür
Gehaltenem) abgeleitet,
stellt – ‚sich‘ (also für die handelnden Menschen) erst später, bis für
Planungsänderungen zu spät, heraus: Was die Schlüsse wert / wie belastbar die
Indizien empirisch sind bzw. waren.
![]() Ceteris paribus – eine durchaus eigentümliche
Hoffnung/Unterstellung, dass alles andere – eben bis aif
die bekannter- bis absichtlichermassen veränderte
Variable / Größe - und zumindest alle Anderen, falls
nicht auch jemend selbst, hinreichend bis genau, gleich sein/bleiben und wiederholbar
würden.
Ceteris paribus – eine durchaus eigentümliche
Hoffnung/Unterstellung, dass alles andere – eben bis aif
die bekannter- bis absichtlichermassen veränderte
Variable / Größe - und zumindest alle Anderen, falls
nicht auch jemend selbst, hinreichend bis genau, gleich sein/bleiben und wiederholbar
würden. ![]()
![]() Der
(gar unvermeidliche gleichwohl mehr oder minder plausibilisierbare)
Zirkelschluss überhaupt.
Der
(gar unvermeidliche gleichwohl mehr oder minder plausibilisierbare)
Zirkelschluss überhaupt.

[Abb. Goethe ggf. plus
Zitat] Gerade, und sogar, holistische Ansätze, namentlich etwa fraktaler
Betrachtungs- und Handhabungsparadigmen, laufen durchaus Gefahr, die (zudem und
dazu abendländisch auch noch signularisierten/verabsolutierten/vereinzigten), zumal kosmische/n,
universelle/n (oder immerhin
aktuell/gegenwärtig wesenhafte/n) Ganzheit/en -
im/als sie repräsentierenden Detail(sphärn/hüllen)
mikrosystemisch vollständig überblickt bis durchschaut - wenigstens aber (duplikativ bis identisch) umfassend gegeben - zu reduzieren
(und sich/andern diese gesamte, zhumindest abner immerhin die je vorfindliche, Weltwirklichkeit OLaM aus dieser / in diese 'Nusschale'/'black box' hinein / heraus -
in/mit/nach der angeblich bewährten bis unausweichlichen rDenkform:
'Alles ist ['auch' anstatt 'nur'/'rein']
... [etwa: 'Zahl' oder: 'komplex']
zu erklären) äh zu erkennen/verstehen [Abb.
Marquardt Fussform/Sitzposition]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[[Verborgene
Tapetentüröffnung in der Psyche-Wand, zumal wegen des Dienstpersonals]  Dem Roten Salon mag
zwar, die, von manchen Leuten so heiß ersehnte, überwältigende/mächtige, völlige
Abriegelungsmöglichkeit, ausgerechnet
zum/vom Schwarzen Salon des Psycho-logischen, ‚fehlen‘ – doch weißen
seine Begrenzungen, dennoch mehr als nur eine einzige (gar
paradoxe) Wand auf, und auch Fussböden bzw. Decken sollten (gleich
gar in Schlössern) Beachtung finden:
Dem Roten Salon mag
zwar, die, von manchen Leuten so heiß ersehnte, überwältigende/mächtige, völlige
Abriegelungsmöglichkeit, ausgerechnet
zum/vom Schwarzen Salon des Psycho-logischen, ‚fehlen‘ – doch weißen
seine Begrenzungen, dennoch mehr als nur eine einzige (gar
paradoxe) Wand auf, und auch Fussböden bzw. Decken sollten (gleich
gar in Schlössern) Beachtung finden:

Vom Deckengemälde dessen
Ritter/Reiter/endgültige Lösung sich immer entzhierhn/von
Ihnen abwendet bzw. zu folgen (gar nach zu jagen) anbietet, gleichgültig wo im
Raum Sie sich jeweils befinden und auf es sehen mögen
- das 'sich' also analytisch(-zirkellschlüssig) im
Kreise / am Sphärenkorizon zu drehen scheint (vgl.
insbesondere den hermenutischen Zirkel) und sich ihm
tendenziell doch enzieht - zur Wand mit dem
Einmaligen bzw. der Einmaligkeit hin, die zum und mit dem geschichtlichen
Verlauf verbindest bis -windet, der einerseits sowohl zyklisch Analogien wiederholend als auch gerade
dawider nie wirklich bis ins Letzte gleiche Univokien aufzuweisen vermag. - Duexchaus
im im deztidierten
Widerspruch zur Auffassung und Selbstverständlichkeit jenes Mythos, der die
ewige und unendliche Wiederkehr, gar bis hin zur letztlichen Unveränderlich
bzw. Unvergänglichkeit etwa der 'Materie', der 'Energie', des 'Geistes', der
'Seele', des 'Nichts', des 'Nibwanas', des 'Chies' oder was auch immer Bezeichnungen dafür sein mögen
oder sollen, stützt und unterstellt (gar zum Göttlichen bzw. Absoluten erklärt
respektive 'dieses' damit der Raumzeitlichkeit unterwärfe).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Auf dem ('gelben' - 'dienstbaren')
Weg durch das Schloss
– etwa von roten Treppenhaus des Denkens ins grüne des Handelns und ungekehrt
– gehört der rote Salon zu den
dreien, die nur durch erhebliche Umwege, beispielsweise über andere Stockwerke
‚übersprungen‘/vermieden werden können. Durcheilen läßt
sich gerade das Analytische besonders rasch (gegenüberliegende Türen vom
Korridor zur Geschichte). ‚Zu wollen‘ bzw. ‚anzunehmen‘ oder ‚zu
verlangen, dass dies ein folgenloses bzw. neutrales Verhalten sei‘, gehört zu
den verbreitetsten und schwerwiegendsten Dummheiten der Menschenheit.
Kaum übertroffen von jener: mit seinem ‚Bewusstsein‘
so im denkerisch analytischen Kreislauf gefangen zu verbleiben, dass Handeln unterbleibt
– gar ohne zu bemerken, dass/wie nebenan, die
Geschichte, nicht zuletzt jene des eigen Lebens,
dennoch vorgeht, der bzw. deren französischem Salon
und Speisezimmer, noch weniger zu entkommen ist, als dem Analytischen und dem sprachlich Semiotischen, die sich dagegen verglichsweise rasch durchqueren lassen.

uuuuuuuuuuuuuuuu
Zu den gravierenden
Nachteilen bis Irrtümmern der gängigen, reduktionistischen
Analyseweise, namentlich dem wirkursächlichhen (kausa efficues) Paradigma mechanischer Weltbetrachtung und
Wirklichkeitshandhabung folgend, gehört die wohl durchaus notwendige, gar auch
noch möglichst vereinzelte, Vorraussetzung(en) zur
hinreichenden Voraussetzung zu denken bzw, zu reden.
Die Kausalitätsproblematik -
respektive die prekäre (eben rational denkerisch kaum ausweichliche)
Zerlegbarkeit jedes Ganzen in Teile und Wirkungen einerseits und seine (immerhin
'kulturell'/abendländisch leichter ignorable)
Beziehbarkeit auf, bis Eingebundenheit in, Umgebendes/Anderes (gar
Größeres/Höheres respektive Emergenz).
Na
klar wurde und wird
(hier
oben ungern auch mal) vereinzelt, zumal logisches (oder wenigstens dafür gehaltemes, bis genommenes – vorzugsweise vorgefertigtes,
bis ausgetretenes), Denken zur/als beinahe Königin der
Wissenschaften erwogen. Nur – wie Sie wohl schon ahnen – gilt
diese, bis unsere, Reverenz, die allenfalls eine Bezugnahme (also ‚Referenz‘ mit ‚f‘, bis ‚zoffen
müssend‘) sein/bleiben sollte, häufig explizit der (insofern zumal stets eigenen, gar singulär
einen) ‚Theorie‘, dem
verbleibenden, bis wie auch immer (gar sicherheitshalber, bis nützlicherweise
drunter ans Bein gebunden) gebildeten, Vorstellungshorizont. – Sollen
indes die Taten und\aber die Sachen nicht dazu, oder wenigstens nicht da hinein
passen, um so schlimmer – für die Tastsachen,
respektive gleich möglichst alle Ereignisse, mindestens jedoch gegen
Lebewesen/Lücken.
|
D/Was könne
so oder/und so gesehen werden? [Manche erscheinen ‚naiv bis arrogant genug‘,
(nur/wenigstens) sich |
Manche Menschen arbeiten mit(/unter den Vorstellungsglocken, bis Empfindungsfirmanenten) |
Denn alle laufen wir Gefahren:
Alles innerhalb gewählter ‚(a-priorischer, gewohnter) Kuppeln
/ Blasen‘ zu, und\aber können ohnehin nur
von/mit ihnen –namentlich Denkformen / ‚als‘-strukturell
– aus/her, ‚sehen‘. |
[Vergleiche
etwa |
|
Na klar, sehen (Ihnen / Euer Gnaden) nicht nur dreierlei
hier genannte, große Reverenz erweisenden Kategorien
/ (ma)demoiselles de chambre (aller Arten
und Weisen Denkformen zu empfinden, bis Gefühle zu
gebrauchen) |
[So
manche Leute täuscht schon ‚Uniformität, diese
lassen sich nicht erst durch/von Höflichkeiten beeindrucken] |
zu – gar,
zumal als solche selbst selten bemerkten – Wahlentscheidungen,
mit so erheblichen Folgen, was
zu repräsentieren kein riesiger, eigener
Abstimmungsraum (Saal des Palzzo
Comunale) zureicht: |
So ließen / lassen sich allein schon Eure /
Ihre (auf dieser Bühne bereit,
knicksenden, ‚nachstehend‘ fünfzehn der einzelnen ‚Kammermädchen‘)
Modalitäten
/ chambrières, der/den
Vernunft/en ‚zofend‘, beeindruckend
/ befremdend vielfältig und vielzahlig
‚kombinieren‘. |
[Gleichheiten des Aus- bis
Ansehens, zumal verwendeter Begrifflichkeiten, täuschen – obwohl, oder
gerade indem, ‚rote‘ versus ‚gelbe Streifen‘ unterscheidbar ‚übersichtlich‘] |
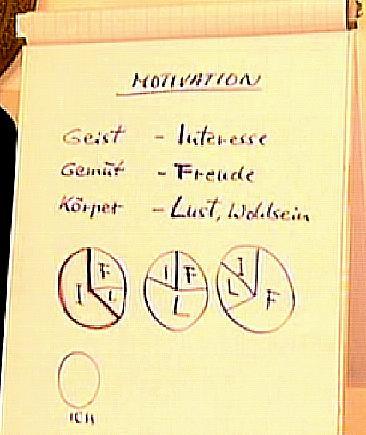 [‚Anreizend/Antreibend‘: weil es interessiert / was
interessant – da es mit anderen verbindet / weil es von anderen trennt – da es
wohltut / was elementar wichtig (Mischungen
und Überlappungen der Kategorien und Befunde erwartbar/zulässig)]
[‚Anreizend/Antreibend‘: weil es interessiert / was
interessant – da es mit anderen verbindet / weil es von anderen trennt – da es
wohltut / was elementar wichtig (Mischungen
und Überlappungen der Kategorien und Befunde erwartbar/zulässig)]
Besonders groß erscheint also die Gefahr / Wahrscheinlichkeit, dass
eine der drei plus vier, selbst
meist nicht oder besonders ver- äh geliebt (als
solche von/in/bei/an sich selbst – aspektisch / distanziert / kategorial / typisierend) bemerkte
Auffassungs-Varianten / Empfindungsarten
für ‚realistisch‘ plus die
übrigen für falsch gehalten werden (müssen/wollen). 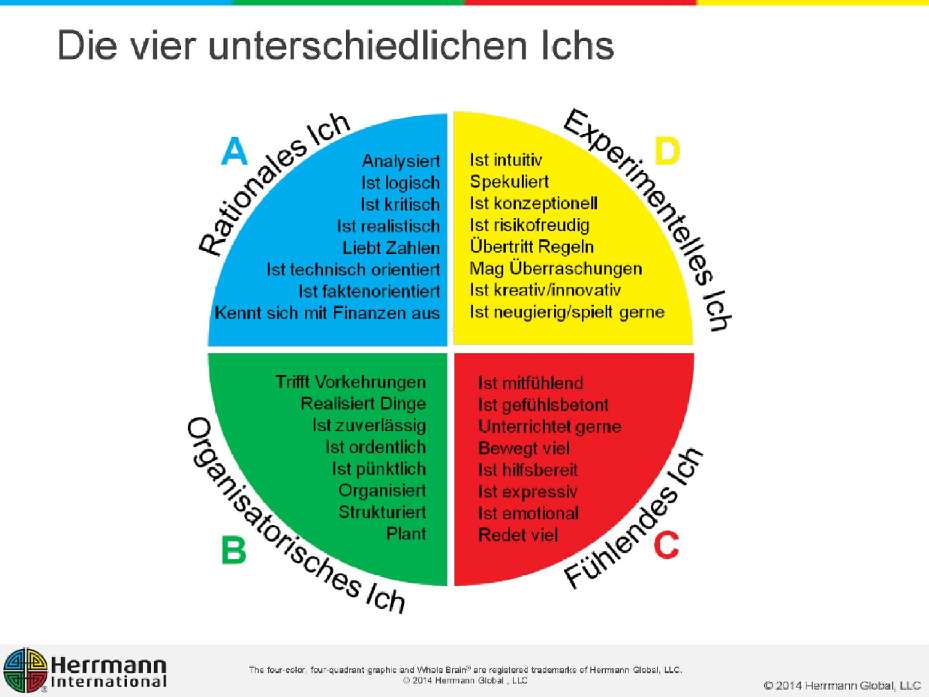 [Minderheiten kommen nicht
immer miteinander aus/vor – logische ‚Veranlagungen‘/Verstände eher mit strukturierten klar
und intuitive ‚Talente‘ häufig mit
zwischenmenschlich orientierten aus – nicht mit allen Aufgaben gleich schlecht
zurecht]
[Minderheiten kommen nicht
immer miteinander aus/vor – logische ‚Veranlagungen‘/Verstände eher mit strukturierten klar
und intuitive ‚Talente‘ häufig mit
zwischenmenschlich orientierten aus – nicht mit allen Aufgaben gleich schlecht
zurecht] 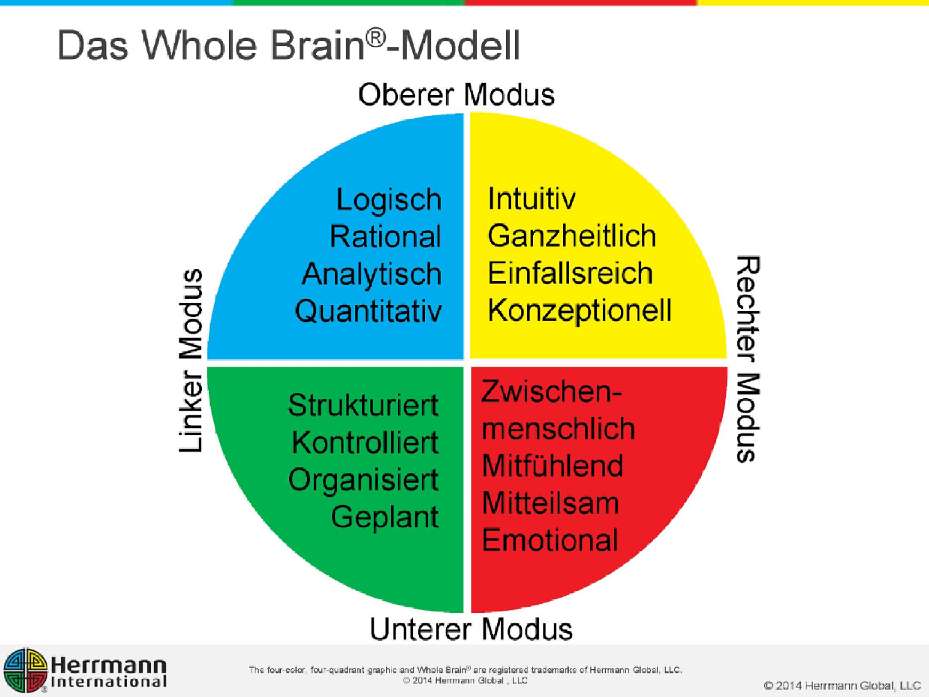
[Meist mehrerlei
Opposition/en streitbar] ‚Narren‘ sind
zwar besser als ‚ihr Ruf‘ – doch was heißt das schon? Bis zu einer Hälfte ‚des Gehirns‘ / of
the mind, gar eher der
Menschen, denkempfinde, und drücke sich,
 ‚kausalistisch‘ / logisch-strukturiert (hier zwar
‚rötlich‘-gestreift) filternd / (eben da Fehler) suchend, aus/ein;
‚kausalistisch‘ / logisch-strukturiert (hier zwar
‚rötlich‘-gestreift) filternd / (eben da Fehler) suchend, aus/ein;
 Menschen können hinter
Erwartungen zurück bleiben. [Also relative Mehrheit
möglich]
Menschen können hinter
Erwartungen zurück bleiben. [Also relative Mehrheit
möglich]
für/von beinahe bis zur anderen
Hälfte sei/werde (zumal verteilungsparadigmatisch,
politisch-interessiert: hingegen) Intuitiv-Zwischenwesentlich( hier ‚gelb‘-gestreift)es
/ ‚(Un-)Sympatisches‘ wesentlich
/ entscheidend / charateristisch.
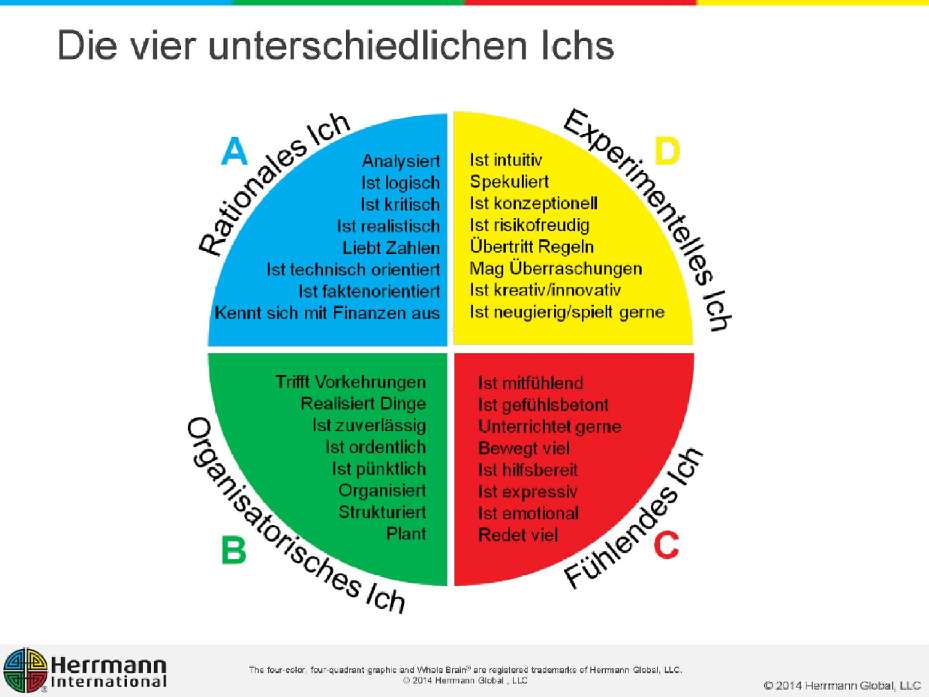 Diskriminiert eine Orientierung / Begabung
die anderen denn notwendigerweise negativ? [Antagonistisch, äh miteinander/mit mir!
unvereinbar falsch / schlecht / unwesentlich erscheinen einem/Dir? mindestens 50 % der Auffassungen und Taten der/bis Leute] Hierarchisierungen können ‚das
Leben‘ ganz alleine Füllen.
Diskriminiert eine Orientierung / Begabung
die anderen denn notwendigerweise negativ? [Antagonistisch, äh miteinander/mit mir!
unvereinbar falsch / schlecht / unwesentlich erscheinen einem/Dir? mindestens 50 % der Auffassungen und Taten der/bis Leute] Hierarchisierungen können ‚das
Leben‘ ganz alleine Füllen. 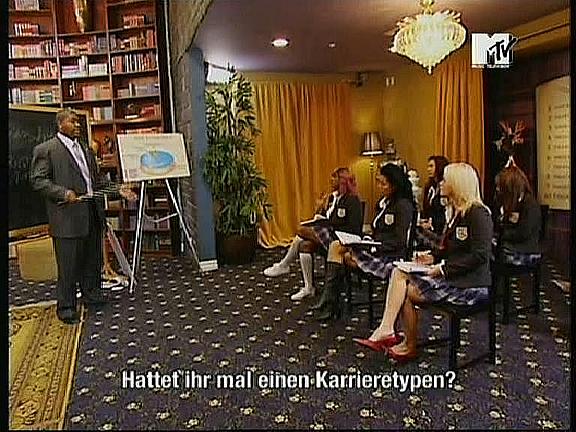
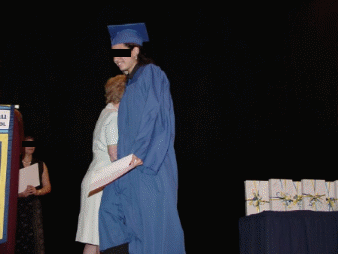 Irren nur Parteiungen, oder gebildete Leute, nie? [‚Dritte‘/Zumeist
Minoritäten wählen wechselnd loyal]
Irren nur Parteiungen, oder gebildete Leute, nie? [‚Dritte‘/Zumeist
Minoritäten wählen wechselnd loyal]
Gar eher (minderheitlich) wenige
weitere, bis ‚außerhalb‘
oder ‚abweichend‘ wirkende/wirksamste, Menschen erkennen und/oder verwenden,
bis wechseln, unterschiedliche (mehr als immerhin zweierlei und nicht notwendigerweise nur/eindeutig
nach nein-‚falsch‘ versus ja-‚besser‘ sortierbare) Perspektiven.
Wo/Wenn Es die
von/durch #‚Gut/Nützlich‘ gegenüber# #‚Böse/Schlecht‘# ups gemeinsam ausgeschlossene Dritte (‚immerhin‘ oder ‚sogar‘ Denkkategorie/n, bis Verhaltensweise/n) geben dürfte – kann hier
erkennbar (also keineswegs[! nur]
Zustimmung – gleich gar zur Ausdehnung
/ רָקִיעַ \ Raum(zeit)existenz,
bis Vielfaltenvielzahlen – finden müssend) Abstand / Respekt /
Unterschied gewahrt werden.  Dass (gerade)/Wie wenige ‚Damen‘ zugleich auf dem
analytischen Möbel Platz fanden/nahmen, mag heute beeindrucken. [Sichtweisenwahlen
/ ‚Selbstverständlichkeiten‘
hängen auch mit ‚Moden‘, gar zeitgeistlichen
Tendenzen, (nicht weniger ‚faktisch‘ als anders kategorisierte Vorfindlichkeiten
– allenfalls
wirksamer) zusammen: Sp
sahen ‚im Barockzeitalter‘ auch/gerdade die grazielsten Ideale eher ‚breit‘ als ‚hoch‘ aus/an] Drittes gibt Empirisches schon-!/?/-/.
Dass (gerade)/Wie wenige ‚Damen‘ zugleich auf dem
analytischen Möbel Platz fanden/nahmen, mag heute beeindrucken. [Sichtweisenwahlen
/ ‚Selbstverständlichkeiten‘
hängen auch mit ‚Moden‘, gar zeitgeistlichen
Tendenzen, (nicht weniger ‚faktisch‘ als anders kategorisierte Vorfindlichkeiten
– allenfalls
wirksamer) zusammen: Sp
sahen ‚im Barockzeitalter‘ auch/gerdade die grazielsten Ideale eher ‚breit‘ als ‚hoch‘ aus/an] Drittes gibt Empirisches schon-!/?/-/.  Debüt noch
einer/achter Modalität ‚nebenan‘ Ideen/דברים probierend.
Debüt noch
einer/achter Modalität ‚nebenan‘ Ideen/דברים probierend.
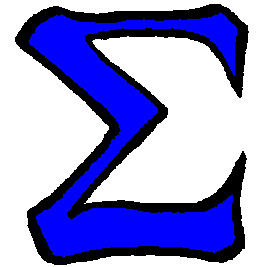 Zwar könnten wir
Menschen einigermassen
wissen, dass der analytische Reduktionismus, über den
Verlust der ganzen übrigen Perspektiven hinau, auch
das Forschungsobjekt selbst zu verfehlen droht; doch haben zu viele Leute dabei
übersehen, und darüber (gar empört) vergessen/behauptet, die (‚eigene‘, bis gemeinsam) integral gewichtete (gar ‚aspektisch‘, [jedenfalls wahrzunehmend] gebliebene) Gesamtheit aller Modalitäten zu holographieren/transzendieren.
Zwar könnten wir
Menschen einigermassen
wissen, dass der analytische Reduktionismus, über den
Verlust der ganzen übrigen Perspektiven hinau, auch
das Forschungsobjekt selbst zu verfehlen droht; doch haben zu viele Leute dabei
übersehen, und darüber (gar empört) vergessen/behauptet, die (‚eigene‘, bis gemeinsam) integral gewichtete (gar ‚aspektisch‘, [jedenfalls wahrzunehmend] gebliebene) Gesamtheit aller Modalitäten zu holographieren/transzendieren.
Immerhin ist analythische Philosophie im wesentlichen Sprachphilosophie respektive solkche der/von semiotischem Zeichengebrauch; und namentlich chemische Abalysen für eine Ausschließlichkeit des zerlegenden Reduktionismus bekannt/berüchtigt, der ihrem (seinerseits häufig verscgienen) synthetischen Möglichkeiten bereits des Physikalischen nicht hinreichend entspricht.
Auch und gerdade dich chemische Analyse bzw- Symthese - allenfalls als 'elementar' aber logischerweise nicht als nur 'oberflächlich' verfachtbar - ist, insofern denkerischen nicht unähnlich, der historischen Bewährung in Raum und Zeit ausgesetzt, der 'sich das' (das heißt Menschen ih im engeren Sinner) 'Denken' aber eher zu entziehen 'wünscht' und versucht wird, als 'Handeln' zumal etwa die Erzeugnisse der Alche- äh Chemie.
Was Gedanken sind, wissen
wir nicht - und die ![]() Vorstellung
bis Alegorie es handele sich dabei (oder immerhin bei
Erinnerung) um Gewohnheiten des oder vieölmehr
unseres (jeweiligen) Geistes hilft allenfalls bedingt weiter.
Vorstellung
bis Alegorie es handele sich dabei (oder immerhin bei
Erinnerung) um Gewohnheiten des oder vieölmehr
unseres (jeweiligen) Geistes hilft allenfalls bedingt weiter.
Some
images by a courtesy of webshots.com an some ©
copyright by hohenzollern.com
|
Sie haben die Wahl: |
||||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
Goto project: Terra (sorry still in German) |
|
|||
|
Comments and suggestions are
always welcome (at webmaster@jahreiss-og.de) Kommentare und Anregungen sind jederzeit willkommen (unter: webmaster@jahreiss-og.de) |
|
||||
|
|
|||||
|
|
|
||||
|
|
|
|
|||
|
|||||
|
by |