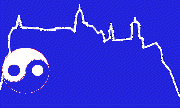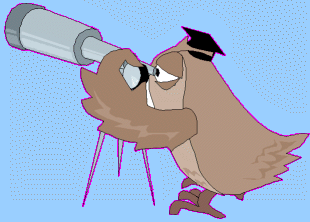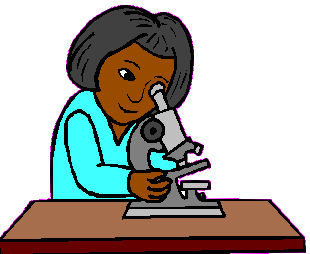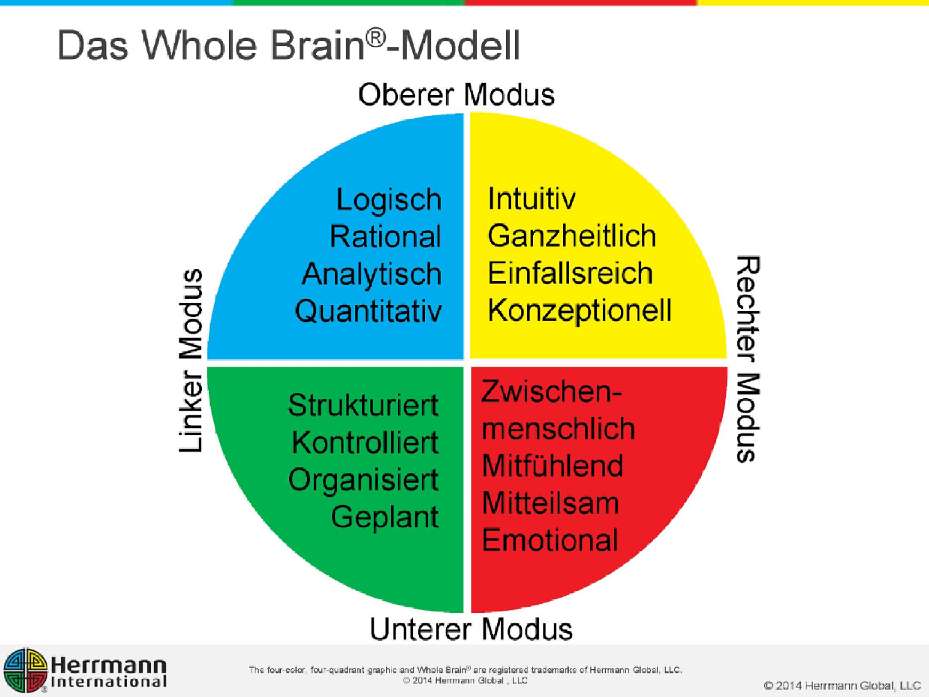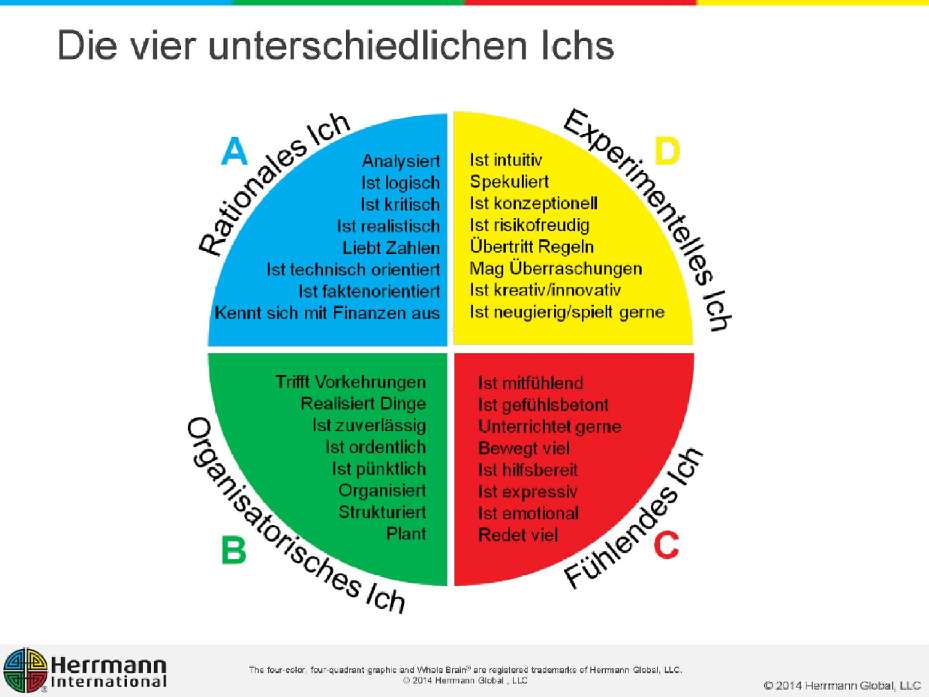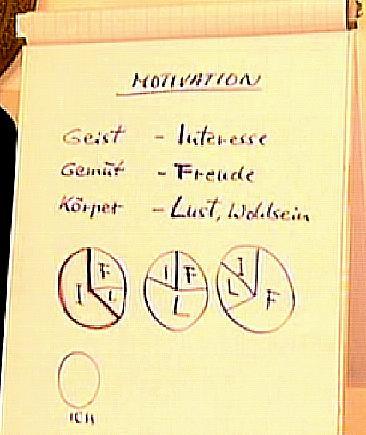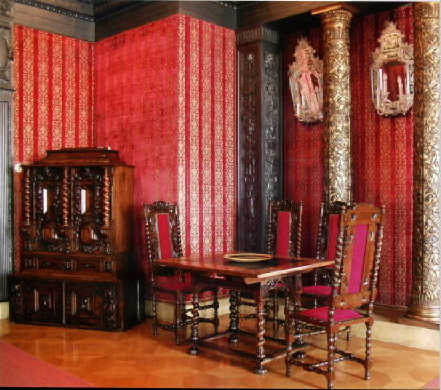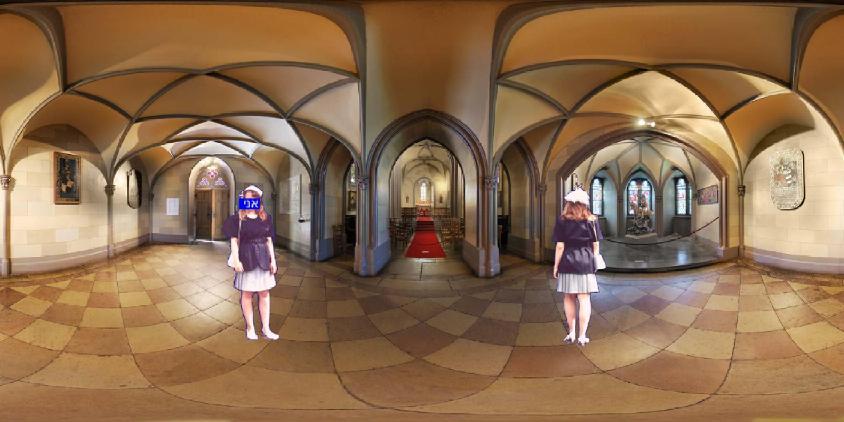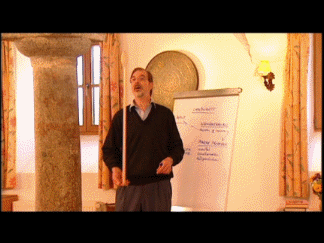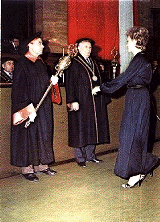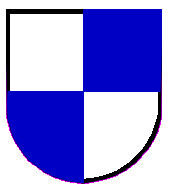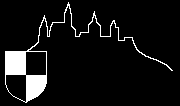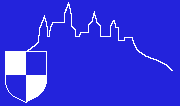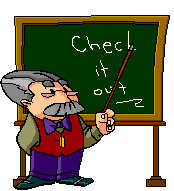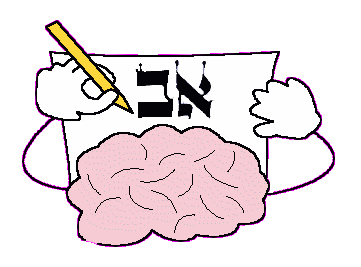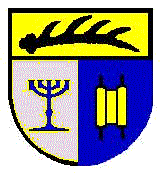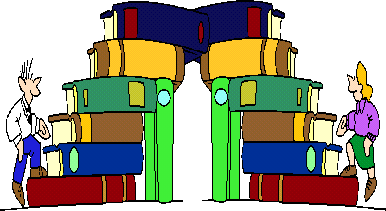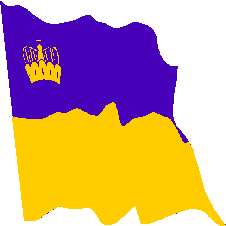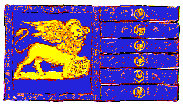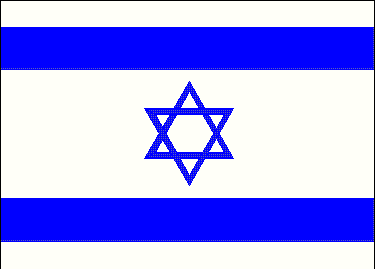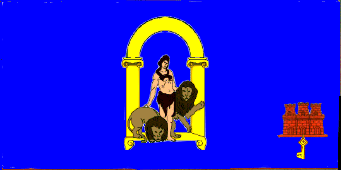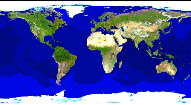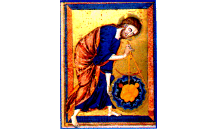|
Psychologische Modalität
– gar dessen, was nicht gerade glücklich, doch mangels besserer Begrifflichkeiten, bis mangels
etablierter Denkalternativenbereitschaft, meist ‚Seele/Psyche‘ genannt, |
Von innen, unten, oben und selbst außen agieren allerlei Wege, gar Emotionen, zu bzw. in vielerlei, durchaus wechseln könnende Empfindungen hinein und sogar heraus. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
![]() Die
recht häufig verwendeten – hier gemeinten bis sogar abgebildeten – Qualen sind/werden lebensgefährlich;
bereits Nachahmungen oder ‚schon‘/gerade Vorstellungen können gegen geltende
Die
recht häufig verwendeten – hier gemeinten bis sogar abgebildeten – Qualen sind/werden lebensgefährlich;
bereits Nachahmungen oder ‚schon‘/gerade Vorstellungen können gegen geltende ![]() Rechtsnormen verstoßen, zumindest aber
Rechtsnormen verstoßen, zumindest aber ![]() ethische Zivilisationsansprüche – respektive Sie persönlich und/oder andere Wesenheiten
– erheblich verletzen.
ethische Zivilisationsansprüche – respektive Sie persönlich und/oder andere Wesenheiten
– erheblich verletzen.
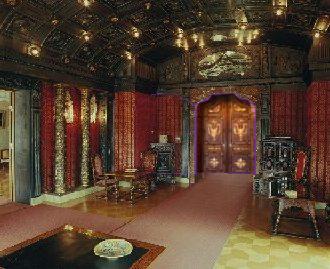 [Viele ä
[Viele ä![]()
![]() sind
sind ![]() überzeugt. und/oder werden
bemüht
überzeugt. und/oder werden
bemüht ![]() ‚diesen
Rauch‘ wegge- bis verschlossen, drinnen/hüben zu halten, bis zu
bestreiten/beseitigen]
‚diesen
Rauch‘ wegge- bis verschlossen, drinnen/hüben zu halten, bis zu
bestreiten/beseitigen]
 [Also doch, oh-ups Schrecken aller Schrecken – nicht allein Schwärzestes, sondern auch noch all dies, sprich mich, äh Sie / Euer
Gnaden, durchschauend, bis bloßstellend]
[Also doch, oh-ups Schrecken aller Schrecken – nicht allein Schwärzestes, sondern auch noch all dies, sprich mich, äh Sie / Euer
Gnaden, durchschauend, bis bloßstellend]
Die gar einzigartige – wohl doch
‚nur‘ eher ‚verhältnis(se)mäßig grau‘
denn ‚absolut schwarz‘ – mit Grafit überzogene
Stuckkasettendecke des – hier ‚analogisierten‘ – Raumes, gilt
als (eine bis die) ‚Ursache‘
dieses/seines Namens, jedenfalls im Schloss. – Psycho-logisch ist übrigens etwa, dass sogar
und gerade die – auch sachgerechte, analytiysch-rot ‚herüberleuchtende‘ – sehr gute, oder immerhin
überlebensbefähigende, ‚gestrigen‘
Sichtweisen und
Handhabungsverfahren der Aufgaben,
Schwierigkeiten, Empfindungen, Gefühle und so weiter,
elementar (bis ‚ganz allein‘ / immerhin –
mit)ursächlich für die aktuellen Probleme, bereits von ‚heute‘, sind/werden
können. 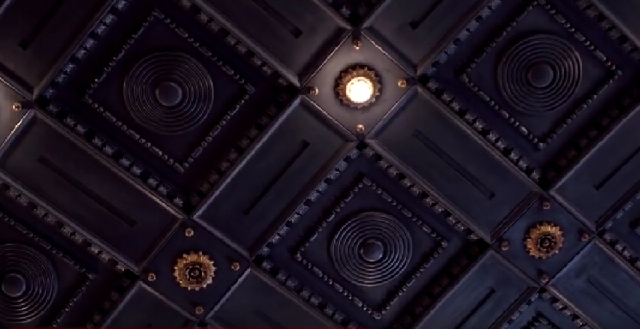 [Sich-Empfindungsfähigkeiten überspannendes
Kasettendeckengewölbe in Grafit]
[Sich-Empfindungsfähigkeiten überspannendes
Kasettendeckengewölbe in Grafit]
![]() [Ihre(/r) Schlossbegleiterin (Artigkeit) bemerkt etwas Wesentliches –
[Ihre(/r) Schlossbegleiterin (Artigkeit) bemerkt etwas Wesentliches – ![]() gar drüben zum/vom
verborgenen ‚Badischen Salon‘] ‚Steine im Fluss‘® war/ist V.F.B.s
Antwort.
gar drüben zum/vom
verborgenen ‚Badischen Salon‘] ‚Steine im Fluss‘® war/ist V.F.B.s
Antwort. 
„Des, bis der, Menschen Aufmerksamkeitsspannen
sind meist recht kurz“ / Zeitenangelegenheit:
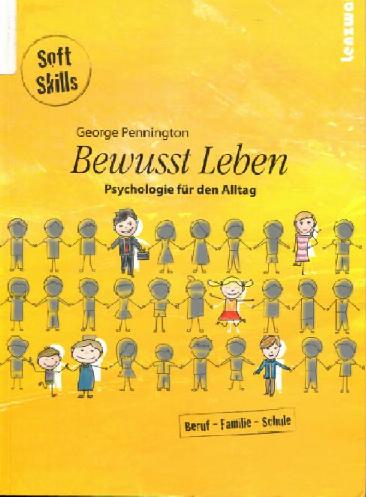 [Nicht nur George Penningtons, durchaus
psycho-logisches, vielleicht weniger akademisch orientiertes, Werk sucht auch Knappheiten zu berücksichtigen] Interesse erlahmt
oft rasch, Langeweile ist das Schlimmste – im Seminar!
[Nicht nur George Penningtons, durchaus
psycho-logisches, vielleicht weniger akademisch orientiertes, Werk sucht auch Knappheiten zu berücksichtigen] Interesse erlahmt
oft rasch, Langeweile ist das Schlimmste – im Seminar!
s
|
Zehn der , gar ‚dümmsten‘, Fehler jedenfalls ‚kluger‘ Menschenheit
|
||
|
Vor allem eins: Dir selbst sei treu
… 17 Vier Spiele mit der [sic!]
Vergangenheit … 21 1. Die Verherrlichung der Vergangenheit … 22 2. Frau Lot … 23 3. Das schicksalhafte Glas Bier … 24 4. Der verlorene Schlüssel, oder »mehr
desselben« … 27 Die
Geschichte mit dem Hammer … 37 Die verscheuchten Elefanten … 51 Selbsterfüllende Prophezeiungen … 57 Vor Ankommen wird gewarnt … 63 Wenn du mich wirklich
liebtest,
würdest du gern Knoblauch essen … 71 »Sei spontan!« … 87 Wer mich liebt, mit dem stimmt etwas nicht … 97 Edel sei der Mensch, hilfreich
und gut … 105 Diese verrückten Ausländer [/
‚Ungläubigen
‘]… 115 Das Leben als Spiel … 121 |
sind ja
längst nicht die einzigen «Eine weise Person findet, dank der Weisheit, aus Situationen wieder heraus, in die
ein kluger Mensch, dank seiner
eigens angeeigneten Klugheit, gar nicht erst hineingeraten wäre.» |
4. Ent-Katastrophisieren 5. Alternative Gedanken entwickeln 6. Alternative Gefühle
entwickeln 7 . Alternative Handlungen entwickeln 8 . Vorteile und
Nachteile [statt nur einander] vergleichen 10. Und dann? לבב 11. Übertriebene Übertreibungen 12. Auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten 13. Aus der Not eine Tugend machen 14. ‚Negativ‘-wirkende Vorstellungen durch
‚positiv‘-empfundene ersetzen 15. ‚Positiv‘-wirkende Vorstellungen üben 17. Sich
ablenken [wovon/wozu] 18. Ihre [eigene] Verteidigung übernehmen
2[0]. Weiterbildung
und Vergnügen planen [21.] 3. Problemlösungen finden [Fragen unter- bis entscheiden] [22.] 4. Das Ziel /
Den Weg in kleinere Schritte unterteilen [24.] 6. Neue Verhaltensweisen ausprobieren [25.] 7. Entspannungsübungen
und Anspannungen ‚Vorbilder
schaden nicht notwendigerweise immer nur.‘ |
[Nicht
etwa notwendigerweise allein, nur – doch/sondern aspektisch] Wesentlich sei/wären also: ‚begrenze/knappe
Wesentlich sei/wären also: ‚begrenze/knappe ![]() Aufmerksamkeit/en‘ – was allerdings auch, bis eher noch mehr, für/bei
Aufmerksamkeit/en‘ – was allerdings auch, bis eher noch mehr, für/bei ![]() überindividuelle/n
Kollektive/n – gleich gar deren ‚Gemurmel‘, bis ‚Regierungen‘ (Bewusstheiten) – gilt.
überindividuelle/n
Kollektive/n – gleich gar deren ‚Gemurmel‘, bis ‚Regierungen‘ (Bewusstheiten) – gilt. ![]()
![]() [Erläuterungen
dieses Schlosses und ‚seiner Zimmer‘ werden
manche, manchmal erwarten/(ablehnen)
wollen]
[Erläuterungen
dieses Schlosses und ‚seiner Zimmer‘ werden
manche, manchmal erwarten/(ablehnen)
wollen]
„Kein Schwein ruft mich
an“ (Abschaltungspflichten
für/gegen Mobiltelefone im Schloss/Seminar bekannt) „Keine Sau interessiert sich für mich“
(zweiprozentige
Aufmerksamkeit plus die übrigen 98%)
komprimierte bereits ein Sänger.
 [Wissenschaften erdreisten sich gar beide
modalen Richtungen zu öffnen – während ihnen die Terrassentüre zur/der
alltäglichen/grauen, nie umgebungslosen Alleinheit
häufiger verschlossen/verstellt erscheint]
[Wissenschaften erdreisten sich gar beide
modalen Richtungen zu öffnen – während ihnen die Terrassentüre zur/der
alltäglichen/grauen, nie umgebungslosen Alleinheit
häufiger verschlossen/verstellt erscheint] 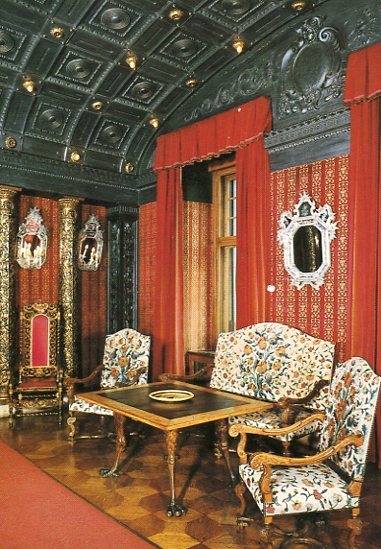 [Zumal (doch
nicht nur) die ‚Südwandtüre‘ des Schwarzen Salons verbindet mit/von der gar ‚grauen‘ Nichtalleinheiten-Terasse, zwar
alltäglichen, doch durchaus
[Zumal (doch
nicht nur) die ‚Südwandtüre‘ des Schwarzen Salons verbindet mit/von der gar ‚grauen‘ Nichtalleinheiten-Terasse, zwar
alltäglichen, doch durchaus
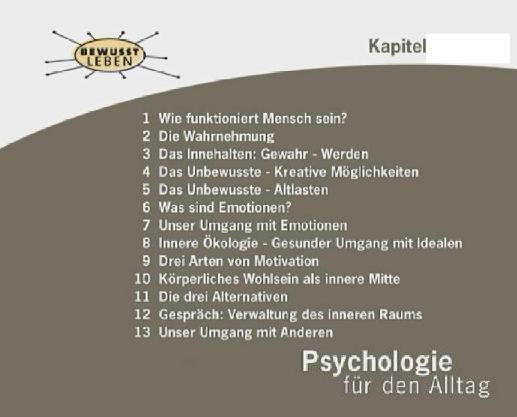 ‚bewusst‘ – im Sinne/Verständnis
von – Selbst-ups ‚so beabsichtigend‘, bis
‚bewusst‘ – im Sinne/Verständnis
von – Selbst-ups ‚so beabsichtigend‘, bis ![]() organisiert, Lebbarem]
organisiert, Lebbarem] 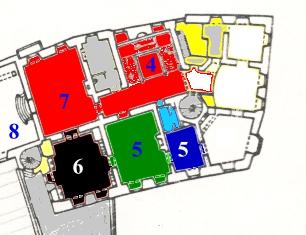
Bereits insofern und von da
her mag, bis droht, klar gespiegelt zu
werden,  dass es überhaupt keine so gur (immerhin tabakrauchdicht) abschließbare Trennschiebetüre, sondern allenfalls
eine nach und von drünem aus stets offene – doch eine von hier aus verschließbare und teils, namentlich ‚sich selbst‘,
respektive anderen, ‚verschlossen( wirken
könnende‘, nicht etwa ‚nur‘ so scheinend)e,
auch/gerade ‚personalseitige‘ –
Durchgangswand
dass es überhaupt keine so gur (immerhin tabakrauchdicht) abschließbare Trennschiebetüre, sondern allenfalls
eine nach und von drünem aus stets offene – doch eine von hier aus verschließbare und teils, namentlich ‚sich selbst‘,
respektive anderen, ‚verschlossen( wirken
könnende‘, nicht etwa ‚nur‘ so scheinend)e,
auch/gerade ‚personalseitige‘ –
Durchgangswand  [Die Schränke enthalten allerlei Hilfsmittel
der Modalität]
[Die Schränke enthalten allerlei Hilfsmittel
der Modalität]
zwischen dem Schwarzen Salon und dem ![]() (drüben/analytisch wesentlich heller) Roten Salon gibt: Zumal Kognitives weder ganz ohne analytische (und gar ups analysierbare)
Denkempfindungen, noch völlig ohne emotionale Denkgefühle/Erinnerungen (und gar nicht einmal ohne jedes ‚intuitives Flüstern‘ immerhin innerer und/oder äußerer ‚Selbst-Beobachtung‘) gegeben ist/wird – ohne kartesisch ‚daneben‘ bzw. ‚zu kurz
greifen‘, und ‚Denken‘ mit ‚Sein‘ verwechseln, bis identifizieren, zu müss(t)en.
(drüben/analytisch wesentlich heller) Roten Salon gibt: Zumal Kognitives weder ganz ohne analytische (und gar ups analysierbare)
Denkempfindungen, noch völlig ohne emotionale Denkgefühle/Erinnerungen (und gar nicht einmal ohne jedes ‚intuitives Flüstern‘ immerhin innerer und/oder äußerer ‚Selbst-Beobachtung‘) gegeben ist/wird – ohne kartesisch ‚daneben‘ bzw. ‚zu kurz
greifen‘, und ‚Denken‘ mit ‚Sein‘ verwechseln, bis identifizieren, zu müss(t)en.
 [Immerhin-ups
im ‚Spiegel‘(-
oder äquivalentem Tests) ‚sich‘-erfahrbarer
Anderheit/en bis Selbigkeit: Gar als
der/einer ‚lebenden Seele‘ – weder
notwendigerweise gleich
[Immerhin-ups
im ‚Spiegel‘(-
oder äquivalentem Tests) ‚sich‘-erfahrbarer
Anderheit/en bis Selbigkeit: Gar als
der/einer ‚lebenden Seele‘ – weder
notwendigerweise gleich ![]() analytisch, oder semiotisch vernünftig
bis verbalsprachlich,
analytisch, oder semiotisch vernünftig
bis verbalsprachlich, ![]() verständlich ‚denkend‘,
noch allein auf Gefühle/Emotionen
verständlich ‚denkend‘,
noch allein auf Gefühle/Emotionen ![]() reduzierbar]
reduzierbar]
Bewusstheit/en (also [Empfindungs-]Zustände,
ups-plurale – nicht zuletzt
auch und gerade ‚als solche drüben analytisch
nicht bemerkte‘ bzw. insbesondere ‚schmerzliche‘  ]
]
Wie auch immer/Ob ‚Bewusstsein‘ und/mit ‚(Da-)Sein‘ und/oder ‚Ereignis‘ bis (gar Denk- respektive Ausdrucks-)‚Verhalten‘ zusammenhängen möge/n]
und
auch nicht ausschließlich menschliche,
sondern zumindest etwa auch tierische oder transindividuelle) werden
häufig als des/der Psychologischen Modalität
Forschungsgegenstand  [Versuchungen
den gemeinten Zustand ‚sich s/meiner
empfindend
[Versuchungen
den gemeinten Zustand ‚sich s/meiner
empfindend ![]() gewahr zu sein/werden‘
zu widerlegen, dürfen jedenfalls
bisher eher als gescheitert gelten]
gewahr zu sein/werden‘
zu widerlegen, dürfen jedenfalls
bisher eher als gescheitert gelten]
angesehen, bis untersucht oder womöglich
– typischerweise/methodisch (also weltwirklichkeitenhandhabend) in bis als Details – verloren. 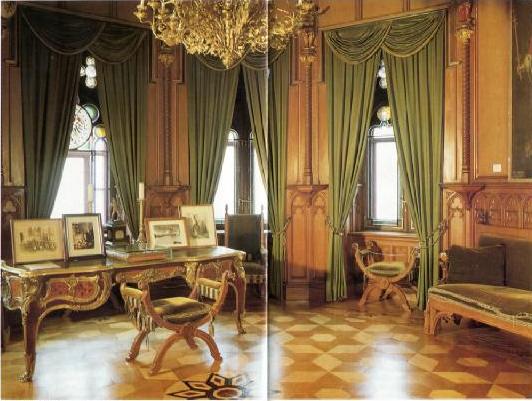 [Überzeugtheitenhochschloss –‚drüben‘
recht zentral im Selbstefragentum
des ‚Tuns & Lassens ‚fällt weiteres Licht‘]
[Überzeugtheitenhochschloss –‚drüben‘
recht zentral im Selbstefragentum
des ‚Tuns & Lassens ‚fällt weiteres Licht‘]
[Lady Gramatica kann einem hier durchaus, in ihrer
farblos grau zwischen schwarz
und weiß gestuften, bis heraldisch-hohenzollerisch silbernen,
‚Schuluniform‘, be- oder vergegnen] ‚Psyche‘
– das (alt)griechische Wort
‚Schmetterling‘, von dem ‚Seele‘ – seit dem 16. vorchristlichen Jahrhundert in
Mykenae geläufiger Ausdruck ‚dafür‘ – seinem germanischen Zusammenhang
als ‚zum See gehörig‘ verdankt, auch insofern nicht unbedingt, bzw. nicht weit
entfernt, gesehen werden muss, bzw. die Denkform – ‚natülrlich‘, ‚eweise‘ mindestens zunächst mit der
Bezeichnung durchaus über-, neben-, irgendwie höchstens und doch
‚feinstofflich‘ inner-, oder außermenschlichen Wesenheit verbunden; und ein weiteres großes Rätsel,
‚Psyche‘
– das (alt)griechische Wort
‚Schmetterling‘, von dem ‚Seele‘ – seit dem 16. vorchristlichen Jahrhundert in
Mykenae geläufiger Ausdruck ‚dafür‘ – seinem germanischen Zusammenhang
als ‚zum See gehörig‘ verdankt, auch insofern nicht unbedingt, bzw. nicht weit
entfernt, gesehen werden muss, bzw. die Denkform – ‚natülrlich‘, ‚eweise‘ mindestens zunächst mit der
Bezeichnung durchaus über-, neben-, irgendwie höchstens und doch
‚feinstofflich‘ inner-, oder außermenschlichen Wesenheit verbunden; und ein weiteres großes Rätsel, ![]() bis Geheimnis,
der/unserer sogenannten ‚Natur‘ betreffend – findet
eine gaze Fülle (gar
so unpräzise erscheinender)
Bedeutungen / Übersetzungen / Assoziierungen (dass prompt heftig um den ‚Status‘ / das Ansehen
dieser Forschungsdisziplin[en] als ‚Naturwisseschaft‘
gezankt und gerungen – eben Reinheit,
das was manche Leute darunter verstehen s/wollen, beansprucht – und damit
bis Geheimnis,
der/unserer sogenannten ‚Natur‘ betreffend – findet
eine gaze Fülle (gar
so unpräzise erscheinender)
Bedeutungen / Übersetzungen / Assoziierungen (dass prompt heftig um den ‚Status‘ / das Ansehen
dieser Forschungsdisziplin[en] als ‚Naturwisseschaft‘
gezankt und gerungen – eben Reinheit,
das was manche Leute darunter verstehen s/wollen, beansprucht – und damit ![]() gesellschafts-
bis geisteswissenschaftliche
Fragestellungen betroffen – wird).
gesellschafts-
bis geisteswissenschaftliche
Fragestellungen betroffen – wird).
[Mochte Frau in den
Schwarzen Rauersalon? – Theologisch-philosophische
Grundaufgabe: Mehrdeutig verwendete gleichlautende wissenschaftsfachliche
Begrifflichkeiten er- äh
bereit- bis auseinanderhalten]  Das
denkerisch-begriffliche
Spektrum reicht exemplarisch von/für ‚Seele‘, Hauch, Atem über ‚hauchzarten Schmetterling‘
(zumindest semitisch
auch immerhin ein – gleichwohl sehr,
sehr scheuer – Vogel NeFeSCH נפש)
bis zu ‚dem‘ heute meist nur noch adjektivisch gebräuchlichen.(bis eher belächelten) ‚Gemüt‘.. Und der,
systematisierende, gar systemische, Anspruch mag einerseits weit über nachbarräumliche, zumal rationale, Aspekte
hinaus erhoben – da selbst die [rezeptive] ‚Wahrnehmung‘ im psychologischen ‚Ganzen‘ mit erfasst gemeint
werden, (immerhin statt notwedigerweise damit und davon umfassend abgedeckt,
ist) – und ‚anderseits‘/weitereseits
(in der Regel mittels Abschiebung in's, zudem
gar brav auf Verwerflichkeit reduzierte,
Aggressionsfeld) die ganzen – womöglich dieser Modalität
originären – Bereiche des
Thymotischen (hebräisch: JeTZeR יצר – nicht direkt mit dem ‚öffentlichen‘
physiologischen Korridor doch ‚intern‘/intrinsisch über recht direkte Wendeltreppen, mit dem übrigen Gebäude insgesamt verbundene,
eben nicht allein sprachlich – immerhin gibt es ja
längst ein anderes, eigenes Wortfeld für sogenanntes ‚Gefühlsleben‘ und einen
anatomischen, biologiesierbaren, äh
orgaischen, angeblichen Körperort dafür)
ausgeschlossen/ignoriert. werden soll.
Das
denkerisch-begriffliche
Spektrum reicht exemplarisch von/für ‚Seele‘, Hauch, Atem über ‚hauchzarten Schmetterling‘
(zumindest semitisch
auch immerhin ein – gleichwohl sehr,
sehr scheuer – Vogel NeFeSCH נפש)
bis zu ‚dem‘ heute meist nur noch adjektivisch gebräuchlichen.(bis eher belächelten) ‚Gemüt‘.. Und der,
systematisierende, gar systemische, Anspruch mag einerseits weit über nachbarräumliche, zumal rationale, Aspekte
hinaus erhoben – da selbst die [rezeptive] ‚Wahrnehmung‘ im psychologischen ‚Ganzen‘ mit erfasst gemeint
werden, (immerhin statt notwedigerweise damit und davon umfassend abgedeckt,
ist) – und ‚anderseits‘/weitereseits
(in der Regel mittels Abschiebung in's, zudem
gar brav auf Verwerflichkeit reduzierte,
Aggressionsfeld) die ganzen – womöglich dieser Modalität
originären – Bereiche des
Thymotischen (hebräisch: JeTZeR יצר – nicht direkt mit dem ‚öffentlichen‘
physiologischen Korridor doch ‚intern‘/intrinsisch über recht direkte Wendeltreppen, mit dem übrigen Gebäude insgesamt verbundene,
eben nicht allein sprachlich – immerhin gibt es ja
längst ein anderes, eigenes Wortfeld für sogenanntes ‚Gefühlsleben‘ und einen
anatomischen, biologiesierbaren, äh
orgaischen, angeblichen Körperort dafür)
ausgeschlossen/ignoriert. werden soll.
 [Beiderlei zunächst/zumindest griechische ‚Schwestern‘, Philosophia und Theologia, befassen
sich/Wissenschaften durchaus mit
demselben – nennen/verwenden und beschreiben/begreifen auch/gerade ‚es‘ (N.N.) inzwischen
unterschiedlich:
[Beiderlei zunächst/zumindest griechische ‚Schwestern‘, Philosophia und Theologia, befassen
sich/Wissenschaften durchaus mit
demselben – nennen/verwenden und beschreiben/begreifen auch/gerade ‚es‘ (N.N.) inzwischen
unterschiedlich: ![]() ‚Psyche‘ für/als ‚innerweltlich‘/immanent/raumzeitlich vorfindlich
versus
‚Psyche‘ für/als ‚innerweltlich‘/immanent/raumzeitlich vorfindlich
versus ![]() ‚Seele‘ als/für transzendent/wjrklich
gewesen (bis
bleibend) sein
werdend/raumzeitlos. – Na klar wurde/war der Schwarze Salon verboten]
‚Seele‘ als/für transzendent/wjrklich
gewesen (bis
bleibend) sein
werdend/raumzeitlos. – Na klar wurde/war der Schwarze Salon verboten]
 [Wesentlicher, als die
ohnehin eher zu überlappungsnahe übersetzende
begriffliche ‚Trennung‘ in/von ‚Schmetterling‘ (ψυχή /psyche/)
und ‚vom/zum See kommend‘ (verschrecklicher
Seelenvogel), kommt die theo-logische ups-negativa
Einsicht hinzu:
[Wesentlicher, als die
ohnehin eher zu überlappungsnahe übersetzende
begriffliche ‚Trennung‘ in/von ‚Schmetterling‘ (ψυχή /psyche/)
und ‚vom/zum See kommend‘ (verschrecklicher
Seelenvogel), kommt die theo-logische ups-negativa
Einsicht hinzu: ![]() (zumal
christlich wie jüdisch) ganz ohne
(zumal
christlich wie jüdisch) ganz ohne
die gnostische Vorstellung des zur/als ‚Seele‘ ausgedeuteten, ‚immateriellen, rettungs- respektive erlösungsbedürftigen,
da in Materie
/ Körper / Schöpfung / Welt / Sünde gefangenen, unsterblichen Kern, göttlichen Restfunkens /
Urlichtgefäßsplitters‘ denken/lehren/erzählen/auskommen
zu kömmen & zu dürfen. – Statt empirisch
ψυχή /psyche/ (sei gleich/gegen) πνεύμα
/pneuma/ (entsprechend) נשמה /naschama/
gar ‚Odem/Atmen‘ oder נפש /nefesch/ eigentlich ‚Leben‘ bis ‚Herz‘
לב or איש even ‘person‘ –
‘spirit‘, ‘gost‘, ‘feeling‘, ‘sense‘,
‘esprit‘, ‘wit‘, ‘humo[u]r‘, ‘mind‘, ‘relex‘ mit resch-waw-chet-ר־ו־ח … zu
identifizieren]
 [Zumal falls/da schmerzliche Gedanken von
schmerzenden Fingern verschieden steht zu erwarten, dass beides auch, gar
ähnliche, physiologische Repräsentationen …] Psycho-logische
Kern
[Zumal falls/da schmerzliche Gedanken von
schmerzenden Fingern verschieden steht zu erwarten, dass beides auch, gar
ähnliche, physiologische Repräsentationen …] Psycho-logische
Kern![]() these: Manche Lebewesen,
zumal Menschen,
these: Manche Lebewesen,
zumal Menschen, 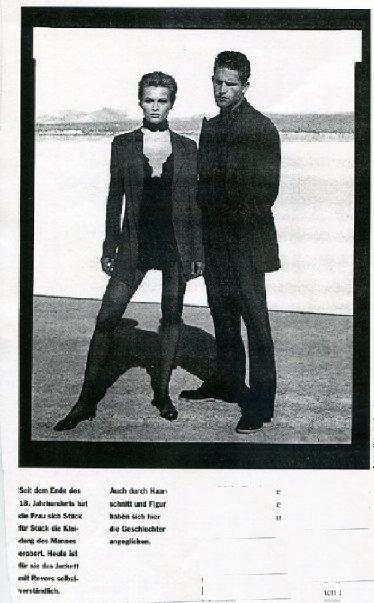 verhalten sich nicht
nur/allein/rein biologisch (immerhin bereits ‚von sich aus‘/reizbar),
sondern empfinden / erleben sich (als ‚sich selbst‘),
undװaber folglich auch Anderheit/en qualial empfindend. – wobei diese
unvermeidliche (so bereits/immerhin Martin Buber, eben nicht dabei
stehen bleiben müssend) wichtige
verhalten sich nicht
nur/allein/rein biologisch (immerhin bereits ‚von sich aus‘/reizbar),
sondern empfinden / erleben sich (als ‚sich selbst‘),
undװaber folglich auch Anderheit/en qualial empfindend. – wobei diese
unvermeidliche (so bereits/immerhin Martin Buber, eben nicht dabei
stehen bleiben müssend) wichtige
![]() Perspektive
der grammatikalisch ersten Person nur allzu eil- und leichtfertig als
‚subjektiv‘ verachtet/verstellt, bis gerade so zur einzig richtig gültigen
verallgemeinert, wird.
Perspektive
der grammatikalisch ersten Person nur allzu eil- und leichtfertig als
‚subjektiv‘ verachtet/verstellt, bis gerade so zur einzig richtig gültigen
verallgemeinert, wird.  [Zweierlei
Spiegel viermal gepaart an den Wänden, bis noch einmal weiter droben
romsmfrt gegenüber]
[Zweierlei
Spiegel viermal gepaart an den Wänden, bis noch einmal weiter droben
romsmfrt gegenüber]
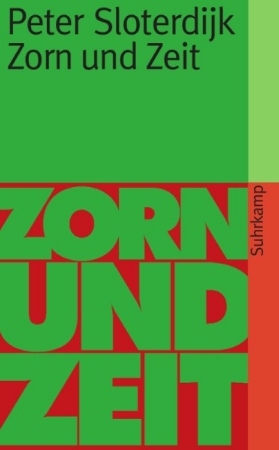 [Zitate P.S. Gespräch #Hilfsmittel]
[Zitate P.S. Gespräch #Hilfsmittel]![]() Papstzitat des
Kabbaerettisten zum Unterschied von / zwischen Wut und Zorn.
Papstzitat des
Kabbaerettisten zum Unterschied von / zwischen Wut und Zorn.
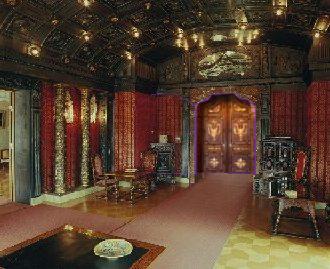
Als akademische
Einzelwissenschaft ist diese modale Disziplin
bekanntlich ![]() recht jung – umso begehrter (oder wenigstens popularisiert/er)
erscheint sie vielen Leuten, die sich, und zumal anderen,
davon ‚die Tore zur Selbsterkenntnis, respektive Selbsterkennbarkeit, bis
Entblößung, zu öffnen/schließen‘ versprechen und/oder befürchten/androhen.
recht jung – umso begehrter (oder wenigstens popularisiert/er)
erscheint sie vielen Leuten, die sich, und zumal anderen,
davon ‚die Tore zur Selbsterkenntnis, respektive Selbsterkennbarkeit, bis
Entblößung, zu öffnen/schließen‘ versprechen und/oder befürchten/androhen.  [#Hilfsmittel]
[#Hilfsmittel]
Dabei/Dagegen sehen
Fachleute speziell diese Verheißungen eher skeptisch und immerhin (inzwischen)
anti-mechani stisch betrachtet (die Gründung des ersten Lehrstuhls erfolgte 1879, bereits gegen Ende des Höhepunkts deterministischen
Wissenschaftsverständnisses) in kaum erreichbar weiter Forschungsferne.
 Umso
höher die alltäglichen persönlichen,
bis administrativen, gar juristischen
Erwartungen an ‚die Psychologie‘,
und insbesondere assoziative/intuitive Befürchtungen davor/dagegen.
Umso
höher die alltäglichen persönlichen,
bis administrativen, gar juristischen
Erwartungen an ‚die Psychologie‘,
und insbesondere assoziative/intuitive Befürchtungen davor/dagegen.
Die
annähernde ‚Allzuständigkeit‘, bis ‚Alleinzuständigkeit‘, der
einzelwissenschaftlichen Fachdisziplin ![]() Psychologie
erstrecke sich im Einzelnen auf:
Psychologie
erstrecke sich im Einzelnen auf:
Die ![]() Lehre(n – gar תורת) vom Sinnes-Wahrnehmen – die
Proteste der unmittelbar benachbarten Biologie
(zumal bereits bedürfnisorientiert selektiver und physiologischer Arten) und der Physik (mit einem
weiten Spektrum human respektive tierisch unterschiedlich, bis nicht,
wahrnehmbarer bzw. nicht wahrgenommener, insbesondere elektromagnetischer
Rauschensimpulse) gelten manchen als bereits hinreichend
okupiert, äh unterlegen,
jene von Mathematik bis Sprachen (wider die Singularismen und Deutungshoheit der
Ausdrücke) werden annähernd so gerne/fleißig überhört, wie die leise doch
dafür entsetzte, Besorgnis der
Lehre(n – gar תורת) vom Sinnes-Wahrnehmen – die
Proteste der unmittelbar benachbarten Biologie
(zumal bereits bedürfnisorientiert selektiver und physiologischer Arten) und der Physik (mit einem
weiten Spektrum human respektive tierisch unterschiedlich, bis nicht,
wahrnehmbarer bzw. nicht wahrgenommener, insbesondere elektromagnetischer
Rauschensimpulse) gelten manchen als bereits hinreichend
okupiert, äh unterlegen,
jene von Mathematik bis Sprachen (wider die Singularismen und Deutungshoheit der
Ausdrücke) werden annähernd so gerne/fleißig überhört, wie die leise doch
dafür entsetzte, Besorgnis der ![]() ästhetischen Modalität übersehen, bis
wegrationalisiert, wird.
ästhetischen Modalität übersehen, bis
wegrationalisiert, wird. 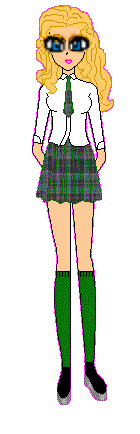
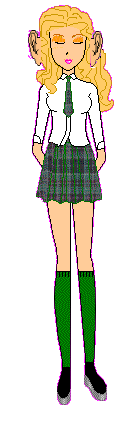
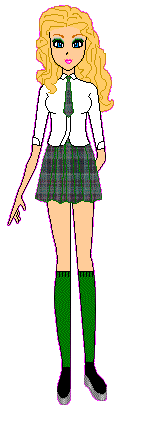 [Spätestens didaktisch sind ‚Wege ins Erinnerungsvernögen‘ wesentlich basaler]
[Spätestens didaktisch sind ‚Wege ins Erinnerungsvernögen‘ wesentlich basaler]
![]() Lehre(n – gar תורת): Des/der Menschen ‚geistige
Prozesse‘ – reklamiert immerhin teilweise auch
jede
Lehre(n – gar תורת): Des/der Menschen ‚geistige
Prozesse‘ – reklamiert immerhin teilweise auch
jede ![]() andere, und namentlich die besonders rot, äh eng, benachbarte
andere, und namentlich die besonders rot, äh eng, benachbarte ![]() analythische, Modalität/Einzelwissenschaft,
gar jeweils für sich.
analythische, Modalität/Einzelwissenschaft,
gar jeweils für sich. 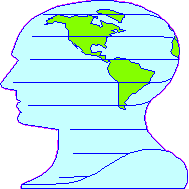 [Wo
auch immer ‚innere Prozesse‘ – gleich gar
innerhalb der MRT-Röhre messbar bis repräsentiert
– stattfinden mögen]
[Wo
auch immer ‚innere Prozesse‘ – gleich gar
innerhalb der MRT-Röhre messbar bis repräsentiert
– stattfinden mögen]
![]() Lehre(n – gar תורת) der/von
Emotionen und andere
Lehre(n – gar תורת) der/von
Emotionen und andere ![]() sogenannte
Bewusstseinszustände – sind, auch falls sie als ‚Prozesse‘ anerkannt werden,
wie die beiden folgenden Ansprüche, nicht auf
‚das Psychische‘ zu beschränken/reduzierbar:
sogenannte
Bewusstseinszustände – sind, auch falls sie als ‚Prozesse‘ anerkannt werden,
wie die beiden folgenden Ansprüche, nicht auf
‚das Psychische‘ zu beschränken/reduzierbar:
|
[Vier gleichartige der (insgesamt fünf) ‚venezianischen Paarungen‘ .des Schwarzen Salons. bestehen aus je einem Anderheitenspiegel undװaber einem Selbigkeitenspiegel – zwar nebeneinander, doch hier in alphabetischer Willkür erwähnt, zusammen hängend] |
‚Du und ich, aber-ups auch sie und/oder er‘ weisen sowohl
Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede auf (was
ja, gar nicht so selten, vergessen, bis bezweifelt / bekämpft, wird).
– Dies/e zu erklären / verstehen,
oder sogar zu beeinflussen, versprachen
bereits geradezu unüberschaubar
viele kategorisierende ‚Typologien‘. Berühmt-berüchtigt
sind immerhin jene, die auf Rückschlüssen aus
Äußerlichkeiten / der Physionomie (gleich gar genotypisch, äh
Geschlecht/ern, Orten pp.) beruhen, respektive aus/mit/in (zumeist Geburts-)Zeiten rechnen. |
[Nur/Immerhin eine, exemplarische, zahlreicher nützlicherer/bewährter Persönlichkeitstypologien – immerhin über jene ‚entweder .gut/gesund, oder .böse/schlecht.‘ hinausgehend – anteilig verstanden, bis messen s/wollend] |
Beeinflussbarkeitsfragen, insbesondre durch Analyse, Bitte / Dank, Denken, Liebe, Konzentration / Meditation, Medikation / Operation, Training, Verletzung, Vertrauen, Zwang pp., und/also solche nach/der Verantwortlichkeit/en (eigene, akzeptable, therapeutische, gesellschaftliche etc.), sind/werden von besonderer Relevanz (was ihre ‚gültige Wirksamkeit‘ – Validität und ‚zuverlässige Reproduzierbarkeit‘ – Releabilität angeht). |
[Philosophisch/Theologisch all zumeist deterministisch als/zu ‚Bestimmung(sfaktoren der Hypothesen)‘ gedeutet, interessieren signifikante Einflussgrößen / unabhängige Variable (der/die Forschung)] |
|
[Die beiden übrigen Spiegel, hier aus edelstem Muranoglas, sind einander gegenüberliegend höher unterm Deckengewölbe an der südlichen und nördlichen Wand lichtwirksam. – Vgl. zumindest N. Hermann, M. v. Münchhausen und G. Pennington mit P. Watzlawick; O.G.J.] |
Zumal/Bereits
griechisches Denken war/ist früh um wesentlichere Komplexitätsreduzierungen
bemüht: Klassische Charakter(typ)e(n)
bündeln |
An. bis
bereits ‚auf‘, diversen-ups Wegen, von ‚der Person‘ zu ‚Persönlichkeiten’,
komplementär respektive
polar exemplifiziert,
irritieren/beeindrucken Eine – zwar weitere,
doch eher selten und dann vereinzelt vorkommende – Kategorie, geradezu
von/unter allen prototypisch
ungeheuerlich abweichender (dies selbst jedoch
kaum bzw. spät |
[Rechthaben-Sitzgruppe am verteilungsparadigmatischen Spieltisch – zum/mit den Dritte/n] |
![]() Lehre(n – gar תורת) von ‚der‘ [aic!]
Lehre(n – gar תורת) von ‚der‘ [aic!] ![]() Persönlichkeit
und i/Ihre krankhaftigkeits-ups Störungen – jedenfalls dafür
gehaltener, dazu/dadurch erklärter, namentlich dieses Singulars
indoeuropäischer Denkweisen, respektive Ängste und Schreckenserfahrungen mit
‚multiblen, bis gespaltenen Persänlichkeiten‘ – hier nicht etwa bestreitend.
Persönlichkeit
und i/Ihre krankhaftigkeits-ups Störungen – jedenfalls dafür
gehaltener, dazu/dadurch erklärter, namentlich dieses Singulars
indoeuropäischer Denkweisen, respektive Ängste und Schreckenserfahrungen mit
‚multiblen, bis gespaltenen Persänlichkeiten‘ – hier nicht etwa bestreitend.
![]() Lehre(n – gar תורת) vom ich
und der/die/das andere/n.
Lehre(n – gar תורת) vom ich
und der/die/das andere/n. 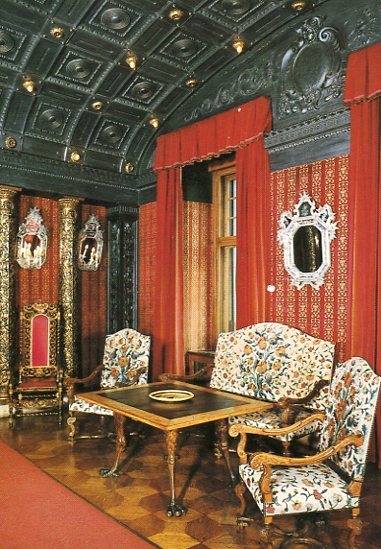 [Spätestens
dank/auf/von der alltagsgräulichen (sozialpsychologisch-psychosozialen) Terrasse
umgeben zu sein/werdendraußen: Andergeit/en, gar ungeheuerliche]
[Spätestens
dank/auf/von der alltagsgräulichen (sozialpsychologisch-psychosozialen) Terrasse
umgeben zu sein/werdendraußen: Andergeit/en, gar ungeheuerliche]
Ohnehin treten die entwicklungspsychologische ![]() Lehre(n – gar תורת), namentlich jene des Lernens, hinzu.
Lehre(n – gar תורת), namentlich jene des Lernens, hinzu. 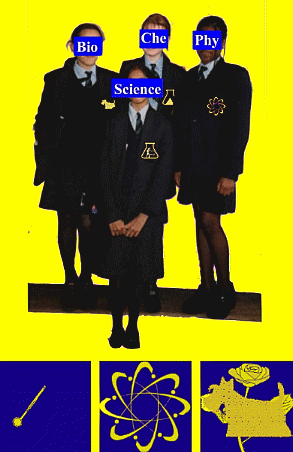 [Bereits definitionsgemäß
(als/soweit) ‚Naturwissenschaft‘ in
Konfrontation bis Kooperation mit Biotischem/belebtem Physiologischem]
[Bereits definitionsgemäß
(als/soweit) ‚Naturwissenschaft‘ in
Konfrontation bis Kooperation mit Biotischem/belebtem Physiologischem]
[Artigkeiten – zumindest
brav in, eben auch hohenzollerisches, schwarz-und-weiß/‚silber‘
gekleidet(e Modalität. äh junge
Einzelwissenschaft)] 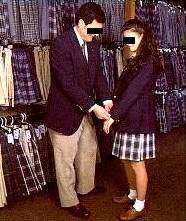 Des Dasein-/Werdensrauschens immerhin ‚unserseits‘ wohl
‚härteste‘ / ‚zäheste‘, seine komplexitätstheoretisch ‚schwarzes (Interverrieren)‘
Des Dasein-/Werdensrauschens immerhin ‚unserseits‘ wohl
‚härteste‘ / ‚zäheste‘, seine komplexitätstheoretisch ‚schwarzes (Interverrieren)‘
![]() genannten,
Strukturen überhaupt, auch szientistisch und philosophisch
kaum ernstlich bestreitbare, sondern vielmehr (und sei es also weg)erklärungsbedürftige,
Bewusstheit/en, scheinen bis sind/werden zeitgenössisch nah mit des/der aktuell, (zwar 'mezzokosmisch')
lokal (doch überhauot, bis nahezu überall)
auf Erden lebenden Menschen - immerhin quasi 'inhaltlich' - 'weichsten',
gar 'flüchtigsten', mehr oder minder differenziert,
oft 'Gehirn' genannten,
biologisch blebten Organ (und allenfalls Nevensystemen verbunden gedacht, bis beobachtbar (weitere,
kaum weniger sensitive Körperteile finden wissenschaftlich, zumindest
szientistisch, derzeit ja weniger, wo nicht noch unangemessenere, öffentliche Ver-
äh Beachtung):
genannten,
Strukturen überhaupt, auch szientistisch und philosophisch
kaum ernstlich bestreitbare, sondern vielmehr (und sei es also weg)erklärungsbedürftige,
Bewusstheit/en, scheinen bis sind/werden zeitgenössisch nah mit des/der aktuell, (zwar 'mezzokosmisch')
lokal (doch überhauot, bis nahezu überall)
auf Erden lebenden Menschen - immerhin quasi 'inhaltlich' - 'weichsten',
gar 'flüchtigsten', mehr oder minder differenziert,
oft 'Gehirn' genannten,
biologisch blebten Organ (und allenfalls Nevensystemen verbunden gedacht, bis beobachtbar (weitere,
kaum weniger sensitive Körperteile finden wissenschaftlich, zumindest
szientistisch, derzeit ja weniger, wo nicht noch unangemessenere, öffentliche Ver-
äh Beachtung):
#hierfoto
Nein, völlig rein weisses Beliebigkeitsrauschen ist
das an (zumal empirischen) Einblicken, was
manche für den Überblick zu halten tendieren,
gar 'in' gleich auch noch verallgemeinert 'den Kopf' nicht. Und selbst ob (oder
wenigstens 'wann') 'es' je 'Terra incognita' war, bleibt eher unentscheidbar:
Denn werder kühlt ein unbedeckter Kopf im Winter nicht aus (antike Anatomen haben immerhin diese Funktion, äh
Eigenschaft, der 'Blutkühlung' beobachtet - und prompt brav 'vereinzigt'/verabsolutiert) noch müssen
heutige neurologische Vorstellungsmodelle signifikannt näher an, bzw. weiter
von, 'der' empirischen 'Realität'
oder gar Komplexität sein (die sie, äh wir, damit beschreiben,
bis verstehen, oder gar beherrschgen s/wollen) als etwa künftige. -  Die
Denkformen und Redeweisen vom 'kompliziertesten/detail- oder immerhin teilchenreichsten
Stück(en 'leuchtender') Materie im/des ganzen
Universum/s' könnte
eben/'nä(h)mlich' auch immerhin an
'unsere Grenzen begreifenden Verstehens' heranführen, und zwingt nicht
notwendigerweise nur zu (etwa erschrockener oder
prinzipieller, bis frustrierter) Vereinfachung(szentrierung):
Die
Denkformen und Redeweisen vom 'kompliziertesten/detail- oder immerhin teilchenreichsten
Stück(en 'leuchtender') Materie im/des ganzen
Universum/s' könnte
eben/'nä(h)mlich' auch immerhin an
'unsere Grenzen begreifenden Verstehens' heranführen, und zwingt nicht
notwendigerweise nur zu (etwa erschrockener oder
prinzipieller, bis frustrierter) Vereinfachung(szentrierung):
![]() 'Bildgebede'
elektro-chemische Aktivitätssubtraktionsverfahren zur Lokalisation/Verortung (bis immerhin
Vergötterung) von 'was auch immer' im Gehirn
'Bildgebede'
elektro-chemische Aktivitätssubtraktionsverfahren zur Lokalisation/Verortung (bis immerhin
Vergötterung) von 'was auch immer' im Gehirn 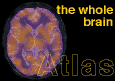 zeigen
(bzw. können
zwar anderes - und insbesondere 'weniger' - als viele Leute meinen, bis versprechen, doch) immerhin unaufgehobene Zusammenhänge zwisvhen (ja eben zu erwartenden spezifischen neurologischen
Prozessen korreliert mit - vgl. A.K.
- den) begrifflich/denksemiotisch -
abendländisch im 'Banne der' zudem
popularisierten 'Aufklärung' (E.B.)
- so fein säuberlich - in angeblich 'rationale' vertrauens- bis
subjektunabhänig gegebene 'Sachlichkeit'/Gegenstände und(versus gar
als relativ abzulehnende 'emotionalisierte Empfindungen' - getrennten
'Fiktionen' belegen. - Befremdlich an der vorherrschenden Präsentations-, bis
Erscheinungsweise, 'der Gehirnforschung' ist, dass es auch, bis gerade (angebbaren). Fachleuten nicht zu gelingen
schint, die irruge Vorstellung von 'im Gehirn' isoliert für etwas Bestimmtes
zuständigen (gar verantwortlichen) Zentren,
sprachpragmatisch wegzudenken / los zu werden.
zeigen
(bzw. können
zwar anderes - und insbesondere 'weniger' - als viele Leute meinen, bis versprechen, doch) immerhin unaufgehobene Zusammenhänge zwisvhen (ja eben zu erwartenden spezifischen neurologischen
Prozessen korreliert mit - vgl. A.K.
- den) begrifflich/denksemiotisch -
abendländisch im 'Banne der' zudem
popularisierten 'Aufklärung' (E.B.)
- so fein säuberlich - in angeblich 'rationale' vertrauens- bis
subjektunabhänig gegebene 'Sachlichkeit'/Gegenstände und(versus gar
als relativ abzulehnende 'emotionalisierte Empfindungen' - getrennten
'Fiktionen' belegen. - Befremdlich an der vorherrschenden Präsentations-, bis
Erscheinungsweise, 'der Gehirnforschung' ist, dass es auch, bis gerade (angebbaren). Fachleuten nicht zu gelingen
schint, die irruge Vorstellung von 'im Gehirn' isoliert für etwas Bestimmtes
zuständigen (gar verantwortlichen) Zentren,
sprachpragmatisch wegzudenken / los zu werden.
 Philosophia protokollierte
immerhin bereits, dass (und sei/wäre)
es (auch) merkwürdigerweise eine der gefärlichsten Ideen ist, anzunehmen; Menschen würden
‚im‘, oder ‚mit dem Kopf‘ denken und empfinden (vgl.
Ludwig Wittgenstein bis R.K.S.).
Philosophia protokollierte
immerhin bereits, dass (und sei/wäre)
es (auch) merkwürdigerweise eine der gefärlichsten Ideen ist, anzunehmen; Menschen würden
‚im‘, oder ‚mit dem Kopf‘ denken und empfinden (vgl.
Ludwig Wittgenstein bis R.K.S.).
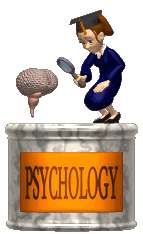
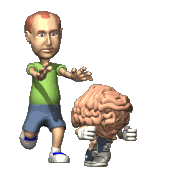
[Manchen verbotene Türe des Grünen Salons in den Schwarzen]  So manche Versuche den, oder immerhin einen, (jeweiligen) eigenen (namentlich dem Biotischen
enthobenen) Untersuchungsgegenstand der Psychologie zu erdenken, bis zu finden, scheiterten bekanntlich enpirisch etwa
an der (manche Leute angeblich, bis
vielleicht sogar, kränkenden) - wenn
auch, und immerhin biologisch, eher wenig überraschenden – Beobachtung: Dass
nicht nur Menschen empfindungs- oder immerhin denkfähig sind:
So manche Versuche den, oder immerhin einen, (jeweiligen) eigenen (namentlich dem Biotischen
enthobenen) Untersuchungsgegenstand der Psychologie zu erdenken, bis zu finden, scheiterten bekanntlich enpirisch etwa
an der (manche Leute angeblich, bis
vielleicht sogar, kränkenden) - wenn
auch, und immerhin biologisch, eher wenig überraschenden – Beobachtung: Dass
nicht nur Menschen empfindungs- oder immerhin denkfähig sind:
![]() Dazu gehört/kommt grundsätzlich, dass es, seit über 2.500 Jahren
des (allein abendländischen) Bemühens,
nicht gelang eine brauchbare Definition/Umschreibung
von ‚Seele/Psyche‘ vorzulegen. So dass sich
wissenschaftliche Alternativen, wie jene (mit A.K.
etal. sogar/zumal ‚theologische/philosiohische‘) von nicht – in spezifischen körperlichen oder leiblichen Details
– verortbaren ‚Zentren menschlicher (bis
nmenschlicher) Akte‘, namens ‚ich‘ zu reden /
auszugehen, anbieten, dem/denen Empirie,
inklusive jener des eigen Leibes (mit/in/aus Soziokulturalitäten)
oder ‚wenigstens‘ Körpers (mit Gehirnorgan,
Nerven und einigem mehr), gegenübersteht,
respeltive wechselwirkt.
Dazu gehört/kommt grundsätzlich, dass es, seit über 2.500 Jahren
des (allein abendländischen) Bemühens,
nicht gelang eine brauchbare Definition/Umschreibung
von ‚Seele/Psyche‘ vorzulegen. So dass sich
wissenschaftliche Alternativen, wie jene (mit A.K.
etal. sogar/zumal ‚theologische/philosiohische‘) von nicht – in spezifischen körperlichen oder leiblichen Details
– verortbaren ‚Zentren menschlicher (bis
nmenschlicher) Akte‘, namens ‚ich‘ zu reden /
auszugehen, anbieten, dem/denen Empirie,
inklusive jener des eigen Leibes (mit/in/aus Soziokulturalitäten)
oder ‚wenigstens‘ Körpers (mit Gehirnorgan,
Nerven und einigem mehr), gegenübersteht,
respeltive wechselwirkt. ![]()
 [Immerhin
die so gängigen, folgenschweren doch (zumindest
‚gnostischen Denkmustern‘ entsprungen)
verdächtig( irrig)en dichotomen Konfrontationen ‚Geist/Seele‘ versud ‚Materie‘
erübrigend/alternierend]
[Immerhin
die so gängigen, folgenschweren doch (zumindest
‚gnostischen Denkmustern‘ entsprungen)
verdächtig( irrig)en dichotomen Konfrontationen ‚Geist/Seele‘ versud ‚Materie‘
erübrigend/alternierend]
Besoders das Thymotische,
die Würde bzw. der Stolz (eine durchaus prekäre und geistesgeschichtlich zumindest
im Ozzident emotioal, bis moralisch, hochaufgeladene Trennung, bis
Gegenstand/Sachverhalt) berührt eine Fülle
individueller und/oder kollektiver
Kränkungen, Überhebungen und (Un-)Zufriedenheiten.![]()
 [Weit offene Türen des Schwarzen Salons sowohl
zur analytischen Modalität des helleren Roten als
auch vom biotischen/belebten Modalität des Grünen (gleichermaßen Vorfindlichen)] Basal und bereits bio-logisch daran/dabei ist, dass schon bzw. erst die
auf naturwissenschaftlichen Vorfindlichkeiten/Empirie beschränkte Lenbensdefiniton Affizierbarkeiten - die etwa wirkstofflich und/oder kognitiv durchaus beeinflussbare
Schwellenfähigkeit, 'überhaupt reizbar zu sein' - erfordert, aber damit
auch die Möglichkeiten alternierender, bis
gegensätzlicher, auszuwählender Reaktionsoptionen
auf einen bestrimmten Reiz eröffnet. Sogar das so gerene dichotom auf 'Kampf
oder Flucht' reduzierte Bespiel kann & darf als Entscheidungsmöglichkeit (gar – wenn aich selten als 'beliebige/willkürliche'
oder 'neurtale' misszudetendene - Wahlfreiheit), wenigstens aber
aktuelle, gar unreflektierte, bis wiederholte und/oder geänderte, Wahlnotwendigkeit, verstanden und etwa durch Übersprungs- oder
Zwischenformen 'erweiterbar' beobachtet und gedeutet werden.
[Weit offene Türen des Schwarzen Salons sowohl
zur analytischen Modalität des helleren Roten als
auch vom biotischen/belebten Modalität des Grünen (gleichermaßen Vorfindlichen)] Basal und bereits bio-logisch daran/dabei ist, dass schon bzw. erst die
auf naturwissenschaftlichen Vorfindlichkeiten/Empirie beschränkte Lenbensdefiniton Affizierbarkeiten - die etwa wirkstofflich und/oder kognitiv durchaus beeinflussbare
Schwellenfähigkeit, 'überhaupt reizbar zu sein' - erfordert, aber damit
auch die Möglichkeiten alternierender, bis
gegensätzlicher, auszuwählender Reaktionsoptionen
auf einen bestrimmten Reiz eröffnet. Sogar das so gerene dichotom auf 'Kampf
oder Flucht' reduzierte Bespiel kann & darf als Entscheidungsmöglichkeit (gar – wenn aich selten als 'beliebige/willkürliche'
oder 'neurtale' misszudetendene - Wahlfreiheit), wenigstens aber
aktuelle, gar unreflektierte, bis wiederholte und/oder geänderte, Wahlnotwendigkeit, verstanden und etwa durch Übersprungs- oder
Zwischenformen 'erweiterbar' beobachtet und gedeutet werden.
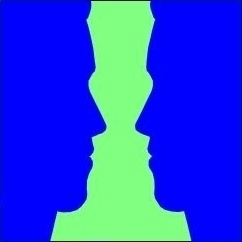
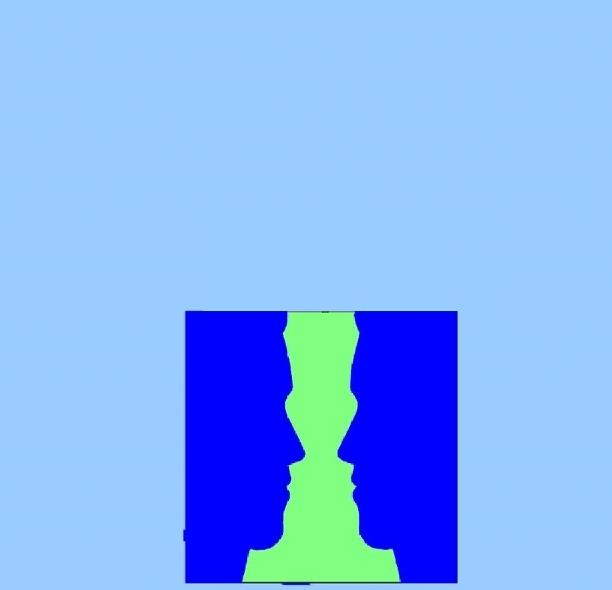
Vexierbild und
ich-hab's-schon-immer-gewusst ![]() Ob, wann bzw. wie es
ein 'Empfindungen' haben Dürfen oder ein sie ertragen Müssen ist bzw. wird kaum
- und schon gar nicht grundsätzlich, allgemein
und für immer eindimensional - entscheidbar.
Ob, wann bzw. wie es
ein 'Empfindungen' haben Dürfen oder ein sie ertragen Müssen ist bzw. wird kaum
- und schon gar nicht grundsätzlich, allgemein
und für immer eindimensional - entscheidbar.
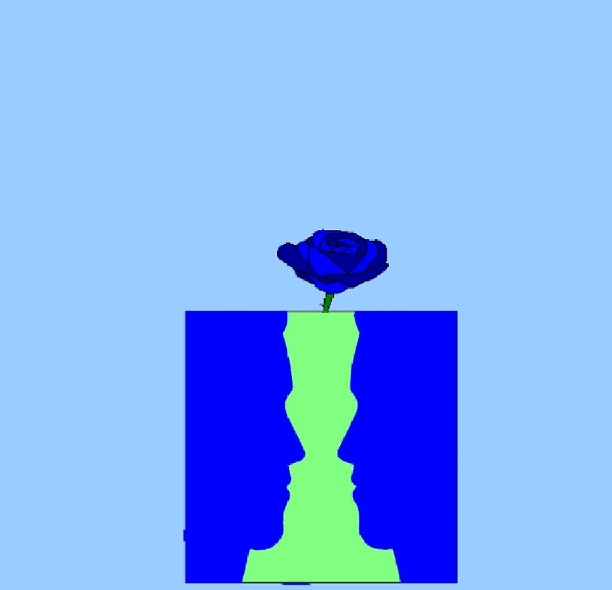
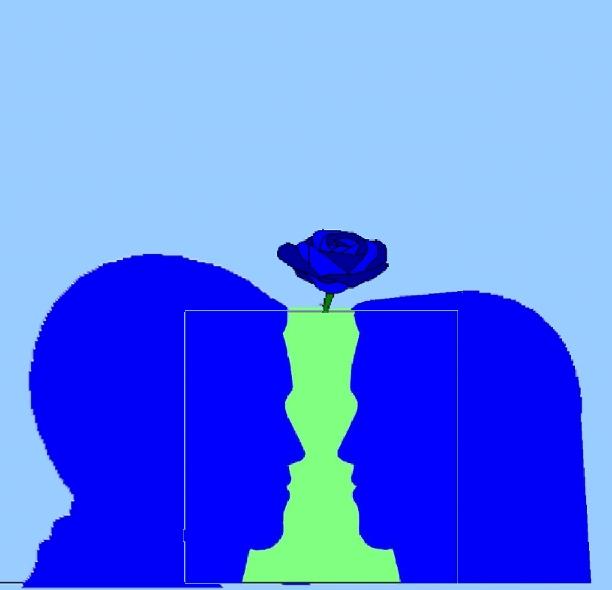
Gerade und ausgerechnet der Thomas-Durch-
bzw. Übergang vom und zum - eben je nach Ihrer persönlichen
wie sachlichen Vorgehens- oder Betrachtungsweise(n) -
'nächsten' respektive 'vorherigen' Raum, dem Roten Saloon des Analytischen
ist (im Schloss - der
Wirklichkeiten des/unseres Lebens bis Daseins) nicht klar durch eine übliche (Querdenk-)Wand, gar
mit beidseitig zugänglichen Türe(n),
markiert/gebildet - sondern steht erschreckend, bis erfreulich, weit, und
manchmal durchaus sichtbar, offen! - Eben mit einigen Konsequenzen solch
bau(art)licher Gegebenheiten. Zu denen in diesem Falle eben gerade nicht
gehören muss, nicht hinreichend klar
und deutlich zwischen Rot und Schwarz, also
den Räumen/Zugehörigkeiten bzw. Aufenthalten darin unterscheiden
zu können. - Viel eher geht es um die Möglichkeiten, anstatt um empfundene
Zwänge (nur von dieser Seite aus läßt sich
nämlich die paradoxe doppelflügelige Holztüre der Ignoranzen gegen das Analytische ver- und entriegeln, die von drüben her dennoch immer offen bleibt),
einzusehen, dass es, - gar stets - mehr Antriebe/Kräfe als Gründe
– eine, bis die, Motivationslücke der Diskontinuität
zur Tat existieren, eben
bedingte Freiheit/en, statt völligem Determinismus
oder belibiger Willküre - gibt und, dass weitererseits etwa biologische, ökobinische
respektive kulturelle, ethische
pp. Interessen bzw. Vorentscheidungen bedeutende Einflüsse auch auf unsere
Kognitionen/bemerkten Denkvorgänge haben.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 [Merkwürdig
schief erscheinen mögende Literatur-, bis
Forschungslage: ‚Negatives (zumal
zu Denken/gemäß Gnosis)‘ funktioniert zuverlässig, Vertrauen zwar nicht
etwa weniger als Gegenteile. – Doch mit jenen ‚Optimisten‘ zu
fliegen/arbeiten, die ihre professionellen Pflichten versäumen, da ‚es schon gut gehen‘ werde / ‚die Seminar
besuchten‘, bleibt allerdings kaum zu empfehlen/verlangen]
[Merkwürdig
schief erscheinen mögende Literatur-, bis
Forschungslage: ‚Negatives (zumal
zu Denken/gemäß Gnosis)‘ funktioniert zuverlässig, Vertrauen zwar nicht
etwa weniger als Gegenteile. – Doch mit jenen ‚Optimisten‘ zu
fliegen/arbeiten, die ihre professionellen Pflichten versäumen, da ‚es schon gut gehen‘ werde / ‚die Seminar
besuchten‘, bleibt allerdings kaum zu empfehlen/verlangen]  [Eigentlich
durften Frauen den Schwarzen Salon der Männer(spiele/Raucher)
ja gar nicht betreten – militärisch
gestrenge Meldungen mögen nun allerdings] Zum vielleicht manche zunächst irritierenden
Buchtitel, bis häufig uneingestandenen, übersehenen respektive wehement
bestrittenen Zweck, ‚unglücklich zu
sein(/werden)‘ einleitend ‚Weltliteratur‘ / ‚Tora‘ im weitesten Bedeutungensinne dieser Begriffsverwendungen
verdichtet bei
[Eigentlich
durften Frauen den Schwarzen Salon der Männer(spiele/Raucher)
ja gar nicht betreten – militärisch
gestrenge Meldungen mögen nun allerdings] Zum vielleicht manche zunächst irritierenden
Buchtitel, bis häufig uneingestandenen, übersehenen respektive wehement
bestrittenen Zweck, ‚unglücklich zu
sein(/werden)‘ einleitend ‚Weltliteratur‘ / ‚Tora‘ im weitesten Bedeutungensinne dieser Begriffsverwendungen
verdichtet bei ![]() Fedor Michailowitsch Dostojewski zur Fragestellung: „»Was kann man nun von einem [sic!] Menschen
. . . erwarten?
Fedor Michailowitsch Dostojewski zur Fragestellung: „»Was kann man nun von einem [sic!] Menschen
. . . erwarten?  [Der Vielfalten Vielzahlenfüllen – zumal
inklusive der Erde und des Meeres, mit allen Gaben – bemerk(t)en nicht
allein/erst die Venzianer]
[Der Vielfalten Vielzahlenfüllen – zumal
inklusive der Erde und des Meeres, mit allen Gaben – bemerk(t)en nicht
allein/erst die Venzianer]
Überschütten Sie
ihn mit allen Erdengütern, versenken Sie
ihn in Glück bis über die Ohren, bis über den Kopf, so daß an die Oberfläche
des Glücks wie zum Wasserspiegel nur noch Bläschen aufsteigen, geben Sie ihm
ein pekuniäres [sic!] Auskommen, daß ihm nichts anderes
zu tun übrigbleibt, als zu schlafen, Lebkuchen zu vertilgen und für den
Fortbestander Menschheit zu sorgen - so wird er doch, dieser selbe Mensch, Ihnen
auf der Stelle aus [sic!] purer Undankbarkeit,
einzig aus
[sic! weitere gängige
‚Erklärungen‘/Behauptungen, namentlich von ‚Dummheit‘
und ‚Verführungen‘ bis ‚Bosheit‘
respektive ‚Kriminalität‘, sind
geläufig; O.G.J. durchaus moralisierungsskepisch, anderes/wesentlicheres, als noch
so ‚groben Unfug‘. Vermutend / erhoffend:
aspektisch zumindest hinzukommende
Absichtsentscheidungen, gar dumme, falsche, folgsame, gutwilliuge, irrige, komplementäre, problemerhaltende, rationmale,
strittige und Lückenhaftes, ![]() Vergesslichkeiten
Vergesslichkeiten
![]() bis
#Verzichte# nicht
bis
#Verzichte# nicht ![]() reduktionistisch
/ Kontraste-maximierend / belehrend / bedauerend / apellieremd (und
wäre es änderungs)interessiert unterschlagen müssend]
reduktionistisch
/ Kontraste-maximierend / belehrend / bedauerend / apellieremd (und
wäre es änderungs)interessiert unterschlagen müssend]
Schmähsucht einen Streich spielen.
Er wird sogar die Lebkuchen aufs Spiel setzen und sich
vielleicht den verderblichsten Unsinn
wünschen,
den aller ![]() unökonomischsten
Blödsinn, einzig um [sic!] in diese ganze positive Vernünftigkeit sein eigenes
unheilbringendes phantastisches Element beizumischen. Gerade seine
phantastischen Einfälle, seine banale Dummheit wird er behalten wollen ...«“
unökonomischsten
Blödsinn, einzig um [sic!] in diese ganze positive Vernünftigkeit sein eigenes
unheilbringendes phantastisches Element beizumischen. Gerade seine
phantastischen Einfälle, seine banale Dummheit wird er behalten wollen ...«“  [Spätestens
sozialpsychologisch erwartbarer/vorauszusetzender Weise neigen nicht nur/allein individuelle Menschen
dazu, ihre Zufriedenheit / Kontemplation leicht(fertig)/mutwillig, zu gefährden, bis zu vernichten –
sondern gerade (und
vor allem ‚Größere/Vorgesetzte/Heteronome‘) auch –
eben gegen Dummheit(en)/wegen Bosheit, respektive zwecks
Kriminalitätsbeschränkung, zur Führung/Beherrschung – sozial
figurierte ‚Kollektive‘ verhalten sich häufig (bis zu häufig lebensgefährdend – wider
besseres-Wissen-Können: hinter/unter ihrer zwar begrenzten Rdoch durchaus
Rationalität zurückbleibend) zu (mindestens) ihren
eigen Nachteilen]
[Spätestens
sozialpsychologisch erwartbarer/vorauszusetzender Weise neigen nicht nur/allein individuelle Menschen
dazu, ihre Zufriedenheit / Kontemplation leicht(fertig)/mutwillig, zu gefährden, bis zu vernichten –
sondern gerade (und
vor allem ‚Größere/Vorgesetzte/Heteronome‘) auch –
eben gegen Dummheit(en)/wegen Bosheit, respektive zwecks
Kriminalitätsbeschränkung, zur Führung/Beherrschung – sozial
figurierte ‚Kollektive‘ verhalten sich häufig (bis zu häufig lebensgefährdend – wider
besseres-Wissen-Können: hinter/unter ihrer zwar begrenzten Rdoch durchaus
Rationalität zurückbleibend) zu (mindestens) ihren
eigen Nachteilen]  (Verlinkende und anderer Hervorhebungen O.G.J.
gerade mit P.W. noch mehr/weitere Gründe/Erklärungen solcher
Befunde erwägend, dass Menschen – gar einzigartige Individuen
– durchaus auch andere/eigene ‚Elemente einzubringen/auszutesten‘
hätten.)
(Verlinkende und anderer Hervorhebungen O.G.J.
gerade mit P.W. noch mehr/weitere Gründe/Erklärungen solcher
Befunde erwägend, dass Menschen – gar einzigartige Individuen
– durchaus auch andere/eigene ‚Elemente einzubringen/auszutesten‘
hätten.)
“ 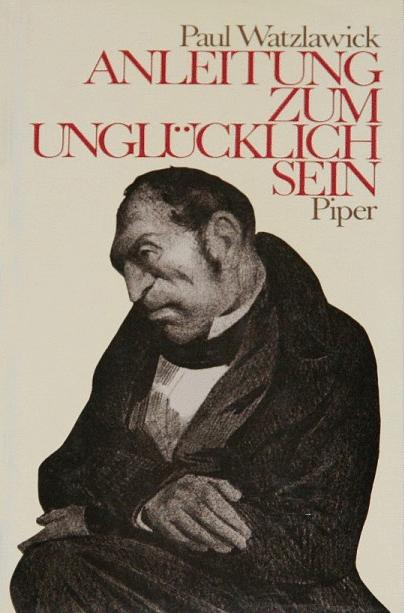 [Vorbemerkung des Verlages 7
[Vorbemerkung des Verlages 7
Vor allem eins: Dir selbst sei treu … 17
Vier Spiele mit der [sic!] Vergangenheit 21
1. Die Verherrlichung der
Vergangenheit .22
2. Frau Lot 23
3. Das
schicksalhafte Glas Bier 24
4. Der verlorene Schlüssel, oder »mehr desselben« 27
Die Geschichte mit dem Hammer 37
Die verscheuchten Elefanten 51
Selbsterfüllende Prophezeiungen 57
Wenn du mich
wirklich liebtest, würdest du gern
Wer mich liebt, mit dem stimmt
etwas nicht 97
Edel sei der Mensch, hilfreich und gut 105
Diese verrückten Ausländer 115
Epilog 127
Literaturverzeichnis 130; P.W, 1985 wiederholt neu aufgelegt; verlinkende
Hervorhebungen O.G.J. bemerkend, dass/wie
schief zumal Such(- äh Erhaltungs-)bedürfnisse gefährdend Gefundenes ja gar nicht länger …]  [Jedenfalls für, bis gegen,
[Jedenfalls für, bis gegen, ![]() O.G.J.‘s Biographie,
von basaler (Schutzpanzerungs-)Bedeutung
/ ‚eulenspiegelischer‘ ‚Wirkung:
Glücksverbote / Unglücksgebote betreffend]
O.G.J.‘s Biographie,
von basaler (Schutzpanzerungs-)Bedeutung
/ ‚eulenspiegelischer‘ ‚Wirkung:
Glücksverbote / Unglücksgebote betreffend] 
Zu den besonders gewichtigen Strategien um sich, und/oder andere ‚Glückssucher‘, möglichst zuverlässig/nachhaltig unglücklich zu machen, bzw. leidend zu erhalten, äh so vorzufinden und anzutreffen, gehören, mit P.W. etal. kategorisiert/formuliert, bekanntlich basal:
 [Auch ‚die zehn (nach deren
Bekunden) dümmsten Fehler kluger Leute‘ listen-begründet
wesentliche Fallen des Denkens, bis Empfindens, zumal (falsch) nachdenkender Menschen, mit
‚richtigstellenden‘, bis ups
gehbaren, (Hinaus-)Wegen / 25
Techniken (kognitiver Therapie), auf: »The 10 Dumbest Mistakes Smart People Make
And How to Avoid Them«
[Auch ‚die zehn (nach deren
Bekunden) dümmsten Fehler kluger Leute‘ listen-begründet
wesentliche Fallen des Denkens, bis Empfindens, zumal (falsch) nachdenkender Menschen, mit
‚richtigstellenden‘, bis ups
gehbaren, (Hinaus-)Wegen / 25
Techniken (kognitiver Therapie), auf: »The 10 Dumbest Mistakes Smart People Make
And How to Avoid Them«  „Achtung,
[zehn sehr
wichtige/verheerende: O.G.J.]
„Achtung,
[zehn sehr
wichtige/verheerende: O.G.J.] ![]() Denkfallen!“
Denkfallen!“
![]() Forschungsfragestellung: „Warum tun wir Dinge, von denen wir genau wissen, daß sie dumm sind, wenn wir sie tun oder wenn wir
sie getan liaben?
Forschungsfragestellung: „Warum tun wir Dinge, von denen wir genau wissen, daß sie dumm sind, wenn wir sie tun oder wenn wir
sie getan liaben?
Arthur
Freeman und Rose DeWolf zeigen überzeugende Möglichkeiten auf, wie man selbstbehinderndes Denken ändern und damit mehr persönliche Lebensfreude gewinnen kann.“ (Klappentext des Verlages; verlinkende
Hervorhebungen O.G.J.)  [Richterin: ‚Es hat manchmal schon eine
äußerst entmutigende Wirkung, dass der Mensch im stande ist, sich seiner
Verantwortung einfach zu entziehen.‘]
[Richterin: ‚Es hat manchmal schon eine
äußerst entmutigende Wirkung, dass der Mensch im stande ist, sich seiner
Verantwortung einfach zu entziehen.‘]
![]() Vorwort 7
Vorwort 7
 [Mehr, nicht erst/allein apokalyptische,
Bedrohungsszenarien wirken zwar durchaus
– doch selten, bis nie, vorgeblichen
Erwartungen gemäß] Zumal angesichts gemeinwesentlicher
Zielvorgaben, bis globaler Koordinierungsbedürfnisse, erschreckend/entlarvend, dass/wo/falls Menschen,
[Mehr, nicht erst/allein apokalyptische,
Bedrohungsszenarien wirken zwar durchaus
– doch selten, bis nie, vorgeblichen
Erwartungen gemäß] Zumal angesichts gemeinwesentlicher
Zielvorgaben, bis globaler Koordinierungsbedürfnisse, erschreckend/entlarvend, dass/wo/falls Menschen, ![]() zu allen Zeiten, allen Mahnungen und besseren
Einsichten zum Trotz
[oder ‚warum‘ auch immer sonst; O.G.J.], ihre Ideen in den einmal eingefahrenen Bahnen
bis zum Exzeß, bis gum „geht nicht mehr" weiter trieben. Vgl. Eva Schmidt
Vorwort in/zu Ilse Wolf’s Anlass sich so intensiv mit dem abendländischen ‚Mode-Reigen durch fünf Jahrhunderte‘ zu
befassen; Ausstellungskatalog 1993.
zu allen Zeiten, allen Mahnungen und besseren
Einsichten zum Trotz
[oder ‚warum‘ auch immer sonst; O.G.J.], ihre Ideen in den einmal eingefahrenen Bahnen
bis zum Exzeß, bis gum „geht nicht mehr" weiter trieben. Vgl. Eva Schmidt
Vorwort in/zu Ilse Wolf’s Anlass sich so intensiv mit dem abendländischen ‚Mode-Reigen durch fünf Jahrhunderte‘ zu
befassen; Ausstellungskatalog 1993.

[Menschen
bleiben erstaunlich zäh – in
mancherlei Hinsichten]
![]() Einführung:
Woher wissen wir, welches die zehn dümmsten
Einführung:
Woher wissen wir, welches die zehn dümmsten
Fehler sind? 9 ![]()
Auch, da
jene die sie machen selbst diese, spätestens
hinterher, so bezeichnen/erkennen: „Zugegebenermaßen ist eine Liste von dummen Denkfehlern ![]() keine genauso präzise Angelegenheit wie das Feststellen
einer Blutgruppe unter dem Mikroskop oder
die Aufreihung der
zehn größten Städte […], aber hinter der […] vorgestellten Liste stehen Tausende von Jahren menschlicher Beobachtung. Diese zehn Denkmuster
sind diejenigen, die uns den meisten Ärger zu bereiten scheinen. Keines von ihnen ist irgendwie kompliziert. Und dennoch [sic!] verursachen sie endlose
Komplikationen, Sorgen und Unannehmlichkeiten.
keine genauso präzise Angelegenheit wie das Feststellen
einer Blutgruppe unter dem Mikroskop oder
die Aufreihung der
zehn größten Städte […], aber hinter der […] vorgestellten Liste stehen Tausende von Jahren menschlicher Beobachtung. Diese zehn Denkmuster
sind diejenigen, die uns den meisten Ärger zu bereiten scheinen. Keines von ihnen ist irgendwie kompliziert. Und dennoch [sic!] verursachen sie endlose
Komplikationen, Sorgen und Unannehmlichkeiten.
[Durchaus (leichter, bis überhaupt nur) mit Humor zu nehmen
– da/wo ‚es sehr ernst wird/ist‘] Allen Fehlern, die in den Kapiteln [zwei
bis elf] beschrieben werden, ist
folgendes gemeinsam:
Allen Fehlern, die in den Kapiteln [zwei
bis elf] beschrieben werden, ist
folgendes gemeinsam:
1. Sie
ereignen sich in unseren Denkprozessen.
2. Sie
bereiten uns große Schwierigkeiten.
3. Sie haben
zur Folge, daß es uns schlecht geht.
4. Sie sind
relativ leicht zu vermeiden.
5. Sie sind
Reaktionen, die wir vermeiden würden, wenn wir klar und vernünftig
über sie nachdächten.“ (Zitat
S. 16; Kursievdrzck im Original, Fettdruck und alle verlinkenden Hervorhebungen
O.G.J.)
![]() Die Verantwortung für Ihre Gefühle
übernehmen
12
Die Verantwortung für Ihre Gefühle
übernehmen
12
 Kernthese: „Sie können
die Art und Weise ändern, wie Sie über die Ereignisse in Ihrem Leben denken. […] unsere Gefühle und unsere
Handlungen sind nicht von unseren Gedanken getrennt. Sie stehen alle in Beziehung zueinander. Das Denken ist das Tor zu
unseren Gefühlen - und unsere Gefühle bilden das Tor zu unseren Handlungen.
Kernthese: „Sie können
die Art und Weise ändern, wie Sie über die Ereignisse in Ihrem Leben denken. […] unsere Gefühle und unsere
Handlungen sind nicht von unseren Gedanken getrennt. Sie stehen alle in Beziehung zueinander. Das Denken ist das Tor zu
unseren Gefühlen - und unsere Gefühle bilden das Tor zu unseren Handlungen.
 Während Sie dieses Buch lesen, werden Sie entdecken, wie die
Änderung Ihrer Denkweise Sie dazu befähigen kann, Verantwortung [sic!] für Ihre Gefühle zu übernehmen,
statt sich von Ihren Gefühlen beherrschen zu lassen.
Sie werden entdecken, daß die Gefühle, die Ihnen Probleme bereiten, nicht irgendwo tief in Ihrem Innern lagern und
dort vor sich hin schäumen. Gefühle werden tatsächlich in dem Augenblick
produziert, in dem wir sie brauchen. Und wir rufen sie durch die Art, wie wir denken,
hervor.
Während Sie dieses Buch lesen, werden Sie entdecken, wie die
Änderung Ihrer Denkweise Sie dazu befähigen kann, Verantwortung [sic!] für Ihre Gefühle zu übernehmen,
statt sich von Ihren Gefühlen beherrschen zu lassen.
Sie werden entdecken, daß die Gefühle, die Ihnen Probleme bereiten, nicht irgendwo tief in Ihrem Innern lagern und
dort vor sich hin schäumen. Gefühle werden tatsächlich in dem Augenblick
produziert, in dem wir sie brauchen. Und wir rufen sie durch die Art, wie wir denken,
hervor. 
Wenn Sie das nicht glauben [sic! ‚sich dies
nicht vorstellen, so etwas nicht für
möglich halten,‘; O.G.J. ‚Glauben‘
(bereits/auch ‚begrifflich‘ primär) nicht für eine vorläufige, gar
schlechte/re, irgendwann dadutch abzulösende ‚ Vorform von Wissen‘
haltend/verwendend] können,
betrachten Sie einmal folgende Beispiele:“
![]() Die unzuverlässige Freundin
Die unzuverlässige Freundin
![]() Die schlechten Eltern
Die schlechten Eltern
![]() Was Ihre Handlungen bestimmt 14
Was Ihre Handlungen bestimmt 14
![]() Kluge Leute sind auch nur [sic!] Menschen 15
Kluge Leute sind auch nur [sic!] Menschen 15
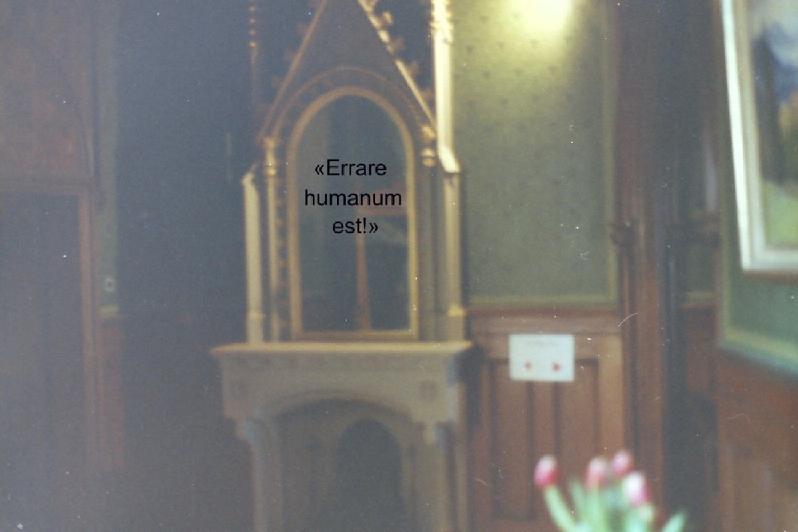 [Spiegel
menschenheitlicher Grunderfahrung: ‚Erare hzmanum est‘] Lassen / Können sich also auf kognitiv( therapeutisch-geschult-vernünftig)e Weise nicht vor folgenden ups Fehlerarten bewahren / gegen alle Irrtümer schützen (lassen).
[Spiegel
menschenheitlicher Grunderfahrung: ‚Erare hzmanum est‘] Lassen / Können sich also auf kognitiv( therapeutisch-geschult-vernünftig)e Weise nicht vor folgenden ups Fehlerarten bewahren / gegen alle Irrtümer schützen (lassen).
![]() Die Rolle der kognitiven
Therapie
16
Die Rolle der kognitiven
Therapie
16
„[…] Wird
das Erlernen dieser Ihre Entscheidungsfähigkeiten verbessernden
Techniken es Ihnen
ermöglichen, in Zukunft alle Fehler zu vermeiden? Leider [sic!] nein. ![]() Schließlich ist es stets möglich, daß sich
auch die sorgfältigst bedachten Entscheidungen als
falsch erweisen. Viele unserer Handlungen schienen zu dem gegebenen
Zeitpunkt eine gute Idee zu sein. Aufgrund
der Informationen [sic!], die Ihnen
zur Verfügung standen, würden Sie wahrscheinlich das selbe
wieder tun. Sie können [sic!] nicht sagen, daß Sie nicht klar gedacht haben.
Schließlich ist es stets möglich, daß sich
auch die sorgfältigst bedachten Entscheidungen als
falsch erweisen. Viele unserer Handlungen schienen zu dem gegebenen
Zeitpunkt eine gute Idee zu sein. Aufgrund
der Informationen [sic!], die Ihnen
zur Verfügung standen, würden Sie wahrscheinlich das selbe
wieder tun. Sie können [sic!] nicht sagen, daß Sie nicht klar gedacht haben.
 [Abb.
Wahlsaal Venedig! Unvollkommene Wahlen
und endlich begrenzte Auswahlmöglichkeiten]
[Abb.
Wahlsaal Venedig! Unvollkommene Wahlen
und endlich begrenzte Auswahlmöglichkeiten]
Manchmal tun
Sie vielleicht etwas, von dem Sie genau wissen, daß es
dumm ist,
aber Sie haben sich ziemlich bewußt entschieden,
es trotzdem
zu tun. ![]() Meistens [sic!] sind dies Fälle, in denen dem
sofortigen Vergnügen vor einem längerfristigen Ziel der Vorzug gegeben wird.
[…]
Meistens [sic!] sind dies Fälle, in denen dem
sofortigen Vergnügen vor einem längerfristigen Ziel der Vorzug gegeben wird.
[…]
Sie würden
sich dann einfach besser fühlen. Sie können natürlich [sic!] einwenden, daß sie sich weigern, der [sic!]
harten Realität ins Gesicht zu sehen. Und manche tun das vielleicht auch.
![]() Aber es ist
ebenso [sic!] gut möglich, daß sie zwischen
zwei unangenehmen Alternativen wählen. Leider ist
das oft die einzige Wahl,
die wir haben.
Aber es ist
ebenso [sic!] gut möglich, daß sie zwischen
zwei unangenehmen Alternativen wählen. Leider ist
das oft die einzige Wahl,
die wir haben.
In [dem zuvor systematisch ausgeführten/verallgemeineterten] Fall bestand die Wahl darin, entweder ihr medizinisches Risiko z u erhöhen oder ohne ihre geliebte Bräune aus zu kommen. Die Liebhaber der Sonnenbräune entschieden sich eben
für die ihnen am wenigsten unangenehmer scheinende Alternative - auch
wenn andere dies für einen Fehler halten.
Sie handeln kaum ungewöhnlich, wenn Sie sich manchmal
ganz kühl,
klar und bewußt entscheiden, etwas zu tun,
von dem Sie genau wissen,
daß Sie es
besser nicht tun sollten, wie zum Beispiel ein
zweites Stück [zu essen, oder … etwa zu rauchen].
[Wenn und solange, bis da, ‚unsere/die ה-Realität/en‘
nicht vollständig determiniert
(Freiheiten existent), respektive ‚wieder und dagegen
neu betretbar‘ (Unterschiede, gar Respektsabstände
/ Diskontinuitätslücken,
zwischen Repräsentationen und Rקפר,דקמאןקראקצ) sind/werden … ] 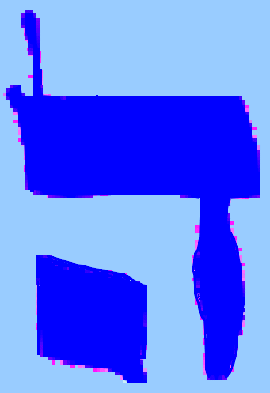 Daher werden die Informationen [sic!] dieses Buches Sie nicht
davon abhalten, sogenannte ehrliche [sic! was O.G.J. hier
fehlt: (Weitere) Fälle
Daher werden die Informationen [sic!] dieses Buches Sie nicht
davon abhalten, sogenannte ehrliche [sic! was O.G.J. hier
fehlt: (Weitere) Fälle ![]() besserer, bis durchaus kluger, Fehler, die (längst nicht nur kluge) Menschen und deren
Figurationen durchaus machen; vgl. zumindest
V.F.B. Lückenmanagement] Fehler zu begehen - solche, die Sie
begehen, weil Sie die Zukunft nicht vorhersagen können, oder
solche, die Sie begehen, weil Sie sie begehen wollen.
besserer, bis durchaus kluger, Fehler, die (längst nicht nur kluge) Menschen und deren
Figurationen durchaus machen; vgl. zumindest
V.F.B. Lückenmanagement] Fehler zu begehen - solche, die Sie
begehen, weil Sie die Zukunft nicht vorhersagen können, oder
solche, die Sie begehen, weil Sie sie begehen wollen.
 [Dero Fürstlichkeiten
der Fehler Wohnung, drüben, oben im Hochschloss
über des ‚Glauberns‘
Überzeugtheitenfestung]
[Dero Fürstlichkeiten
der Fehler Wohnung, drüben, oben im Hochschloss
über des ‚Glauberns‘
Überzeugtheitenfestung] ![]() Und sie
werden Sie vermutlich auch nicht davon
abhalten, »unehrliche« Fehler zu machen, wenn Sie dazu neigen. Die folgenden
Kapitel beschäftigen sich nicht mit negativen Charaktereigenschaften
wie Unehrlichkeit [sic! Was
ist/wäre dann mit Unhöflichkeiten pp.?
O.G.J. eher an vorherrschenden Erkenntnisfehlern orientiert, etwa: ‚hätten nur
alle die gleiche (einfache), da richtige, Einsicht, dann …‘] oder Gier [sic! zumal Überzehungen
von Polaritäten das stets ambivalent
doppelgesichtige Dualismen-Problemsyndroms
sind/werden; O.G.J. gentelness, mindestens aber ethisch Mass,
statt
Und sie
werden Sie vermutlich auch nicht davon
abhalten, »unehrliche« Fehler zu machen, wenn Sie dazu neigen. Die folgenden
Kapitel beschäftigen sich nicht mit negativen Charaktereigenschaften
wie Unehrlichkeit [sic! Was
ist/wäre dann mit Unhöflichkeiten pp.?
O.G.J. eher an vorherrschenden Erkenntnisfehlern orientiert, etwa: ‚hätten nur
alle die gleiche (einfache), da richtige, Einsicht, dann …‘] oder Gier [sic! zumal Überzehungen
von Polaritäten das stets ambivalent
doppelgesichtige Dualismen-Problemsyndroms
sind/werden; O.G.J. gentelness, mindestens aber ethisch Mass,
statt Moralismen, orientiert] 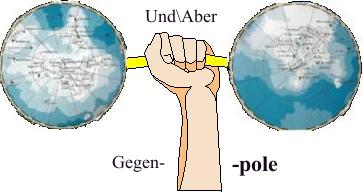 oder Unmoral [sic!], weil sich
oder Unmoral [sic!], weil sich ![]() zum einen nicht alle
einig darüber sind, wie diese Begriffe
definiert werden
sollten.
zum einen nicht alle
einig darüber sind, wie diese Begriffe
definiert werden
sollten. ![]() Zum anderen kommt es selten vor, daß ein Gewohnheits-Einbrecher sich mit den Worten verteidigt:
»Ich hab einfach nicht nachgedacht. Euer Ehren« und ihm geglaubt [sic!] wird.
Zum anderen kommt es selten vor, daß ein Gewohnheits-Einbrecher sich mit den Worten verteidigt:
»Ich hab einfach nicht nachgedacht. Euer Ehren« und ihm geglaubt [sic!] wird.
 [Selbst wo alle
dasselbe für ‚richtig/nötig/gut halten‘ – unterbleibt es durchaus häufig] Was diese Techniken können, ist, Fehlurteile und falsche Schritte bekämpfen [sic!], zu denen
es“ komme,
„weil
Sie zu dem jeweiligen Zeitpunkt
nicht nachgedacht haben. Und das ist ein sehr wichtiger Beitrag. Durch
das Erlernen dieser
Techniken können Sie Fehler, die entscheidende
Auswirkungen auf Ihr Lehen haben, vermeiden
oder zumindest lernen, besser mit ihnen umzugehen.“
(Ar.Fr. R.DW. S. 17; kursiv im Original, verlinkenden
und illustrierende Hervorhebungen O.G.J.)
[Selbst wo alle
dasselbe für ‚richtig/nötig/gut halten‘ – unterbleibt es durchaus häufig] Was diese Techniken können, ist, Fehlurteile und falsche Schritte bekämpfen [sic!], zu denen
es“ komme,
„weil
Sie zu dem jeweiligen Zeitpunkt
nicht nachgedacht haben. Und das ist ein sehr wichtiger Beitrag. Durch
das Erlernen dieser
Techniken können Sie Fehler, die entscheidende
Auswirkungen auf Ihr Lehen haben, vermeiden
oder zumindest lernen, besser mit ihnen umzugehen.“
(Ar.Fr. R.DW. S. 17; kursiv im Original, verlinkenden
und illustrierende Hervorhebungen O.G.J.)
![]() Ihre Denkkraft mobilisieren 18
Ihre Denkkraft mobilisieren 18  [Dichte Schiebtüre
zum/vom Roten Salon, äh analytischen Denken geöffnet] [Farbe
der Fehlerfandung
des Roten Salons der analytischen
Modalität: Wie stark trifft für Sie/Euer Gbaden, auf
mich, 1.-50. zu?]
[Dichte Schiebtüre
zum/vom Roten Salon, äh analytischen Denken geöffnet] [Farbe
der Fehlerfandung
des Roten Salons der analytischen
Modalität: Wie stark trifft für Sie/Euer Gbaden, auf
mich, 1.-50. zu?]
![]() Ein
Fehler-Quiz 19 gäbe (in
fünf Graden des Zutreffens von Fragebogen-Aussagen auf/für einen) Hinweise (ob
und) welche der zehn verheerendsten, ohnehin meist (bis
individuell) gemischten, Denkformen einem jeweils besonders zu
schaffen machen:
Ein
Fehler-Quiz 19 gäbe (in
fünf Graden des Zutreffens von Fragebogen-Aussagen auf/für einen) Hinweise (ob
und) welche der zehn verheerendsten, ohnehin meist (bis
individuell) gemischten, Denkformen einem jeweils besonders zu
schaffen machen: ![]()
[א ‚Klein Hühnchen‘/Schreckenszenarien anfällig?] ![]() „1. Auch geringfügige Probleme können
mich schon aus der Fassung bringen.
„1. Auch geringfügige Probleme können
mich schon aus der Fassung bringen.
2. Andere werfen mir vor, aus Mücken Elefanten zu machen.
3. Ich rege mich leicht auf.
4. Es hat keinen Zweck, es zu versuchen, denn ich weiß, daß
es nichts nützen wird.
5. Ich weiß schon im voraus, daß
es schief gehen wird.
[ב Sind
Euer Gnaden gedankenlesend?]
![]() 6. Ich weiß oft, was andere denken.
6. Ich weiß oft, was andere denken.
7. Menschen, die mir nahe stehen, sollten meine Wünsche
kennen.
8. Man kann von der Körpersprache der Leute auf ihre
Gedanken schließen.
9. Wenn Menschen viel Zeit miteinander verbringen, sind
ihre Gedanken oft in Einklang miteinander.
10. Ich war schon oft grundlos beunruhigt über das, was
andere denken könnten.
[ auf
mich/sich personalisierend?] ![]() 11. Ich bin für das Glück meiner Lieben
verantwortlich.
11. Ich bin für das Glück meiner Lieben
verantwortlich.
12. Wenn etwas schiefgeht, denke ich immer, daß es mein Fehler ist.
13. Ich finde, daß ich mehr als andere Leute kritisiert werde.
14. Ich weiß genau, wenn Leute etwas gegen mich haben - sie
müssen es noch nicht mal direkt sagen oder meinen Namen erwähnen.
15. Ich bin schon unfairerweise für Dinge getadelt worden,
für die ich gar nichts kann.
[ד Mir/Sich selbst vertrauend?] ![]() 16. Mein allzu großes Selbstvertrauen bringt
mich oft in Schwierigkeiten.
16. Mein allzu großes Selbstvertrauen bringt
mich oft in Schwierigkeiten.
17. Mein Selbstvertrauen
scheint die Leute abzuschrecken.
18. Ich finde, wenn man bei einer Sache Erfolg hat, kann man bei
allem anderen genauso erfolgreich sein.
19. Für meine Mißerfolge sind andere Leute verantwortlich
gewesen.
20. Wenn man erst einmal Erfolg gehabt hat, kann man sich
zurücklehnen, weil der Schwung einen auf der Erfolgsleiter hält.
[ה Kritikern vertrauend?] ![]() 21. Irgendwie schaffen es die Leute immer, mit ihrer Kritik auf meine empfindlichsten Stellen zu
zielen.
21. Irgendwie schaffen es die Leute immer, mit ihrer Kritik auf meine empfindlichsten Stellen zu
zielen.
22. Was Kritik angeht, habe ich einen sechsten Sinn. Ich merke genau, wann ich gemeint bin.
23. Negative Bemerkungen von anderen können mich wirklich
verletzen, mich sogar ![]() [sic!] deprimieren.
[sic!] deprimieren.
24. Ich höre die negativen Bemerkungen und überhöre
Komplimente.
25. Ich glaube,
daß alle wertenden Bemerkungen etwa gleich viel zählen.
[ו perfektionistisch?] ![]() 26. Ich bin beunruhigt, wenn ich etwas nicht zu Ende bringen kann.
26. Ich bin beunruhigt, wenn ich etwas nicht zu Ende bringen kann.
27. Als »durchschnittlich« oder »einer unter vielen«
bezeichnet zu werden, ist eine Beleidigung.
28. Ich reiche lieber gar keine Arbeit ein als eine. die
meine selbst gesetzten Maßstäbe nicht
erfüllt.
29. Es ist mir wichtig, als jemand zu gelten, der nie von
den untadeligsten Maßstäben abweicht.
30. Auch ein geringfügiger
Fehler kann mir schon den ganzen Tag ruinieren - oder mein Leben.
[ז vergleichensanfällig?] ![]() 31. Verglichen mit anderen bin ich ein
Versager.
31. Verglichen mit anderen bin ich ein
Versager.
32. Ich sehe mich immer im
Wettbewerb mit anderen.
33. Es beunruhigt mich, von den Erfolgen anderer zu hören.
34. Es ![]() [sic!] deprimiert mich, daß ich noch nicht die Position erreicht habe, die
ich zu diesem Zeitpunkt erreicht haben sollte.
[sic!] deprimiert mich, daß ich noch nicht die Position erreicht habe, die
ich zu diesem Zeitpunkt erreicht haben sollte.
35. Ich finde, man muß sich mit anderen vergleichen, wenn
man Erfolg haben will.
[ח Eventuallitätensorge?] ![]() 36. Das Leben
ist gefährlich.
36. Das Leben
ist gefährlich.
37. Man muß bei allem, was man tut und sagt, sehr
vorsichtig sein, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten.
38. Ich gehe nicht gern Risiken ein.
39. Ich habe schon einige Chancen verpaßt, weil ich nicht
bereit war, etwas zu riskieren.
40. Ich unterlasse manche Handlungen,
wenn ich glaube, daß ich verletzt
oder zurückgewiesen werden könnte.
[ט sollensorientiert?] ![]()
![]()
![]() 41. Ich fühle mich schuldig wegen
etwas, das ich in der
Vergangenheit zu tun versäumt habe.
41. Ich fühle mich schuldig wegen
etwas, das ich in der
Vergangenheit zu tun versäumt habe.
42. Ich glaube,
daß es wichtig ist, sich nach den Regeln zu richten.
43. Wenn ich auf meine
Vergangenheit zurückblicke, sehe ich mehr Mißerfolg als Erfolg.
44. Ich fühle mich unter Druck, immer das Richtige zu tun.
45. All meine Pflichten und Aufgaben überwältigen mich oft.
[י affiziert’s mich (jetzt)?] ![]() 46. Die Meinung
anderer interessiert mich nicht.
46. Die Meinung
anderer interessiert mich nicht.
47. Mir wird oft vorgeworfen, daß ich nicht richtig zuhöre.
48. Ich fühle mich sofort angegriffen, wenn Leute mich bitten - oder mir gar auftragen -, etwas zu tun.
49. Ich finde, daß die
Dinge auf meine Art oder gar nicht
gemacht werden sollten.
50. Ich neige dazu, Dinge aufzuschieben, sogar solche, die wichtig sind.“
 [Insofern vernünftigerweise, doch/eben von der so eng benachbarten
roten Modalität des Analytischen her aufgezogen/gesehen –
[Insofern vernünftigerweise, doch/eben von der so eng benachbarten
roten Modalität des Analytischen her aufgezogen/gesehen – ![]() vor (‚Rotkäppchens innere Schweinehündin‘) Verhaltensfragen umfassender (als ‚nur/immerhin‘ rationell verständig/so oft
vor (‚Rotkäppchens innere Schweinehündin‘) Verhaltensfragen umfassender (als ‚nur/immerhin‘ rationell verständig/so oft
![]() ‚denkerisch‘-genannt)
empfindender Psyche gestellt]
‚denkerisch‘-genannt)
empfindender Psyche gestellt] 
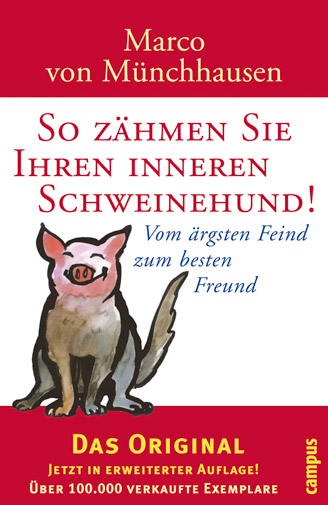 [‚Wegen‘
ihrer enormen Wichtigkeit ist
Urteilskraft die ups
schwächste aller Kräfte – denn sie exekutiert
selbst überhaupt nicht/s]
[‚Wegen‘
ihrer enormen Wichtigkeit ist
Urteilskraft die ups
schwächste aller Kräfte – denn sie exekutiert
selbst überhaupt nicht/s]
 [Ob
Startblock- oder Kotau-Haltung – erstes/mutiges Kapital, äh Anfangskapitel, ups]
„1. Es
besser wissen 24
(können & dürfen als die 50 vorstehenden Überzeugtheiten einem suggerieren wollen)
[Ob
Startblock- oder Kotau-Haltung – erstes/mutiges Kapital, äh Anfangskapitel, ups]
„1. Es
besser wissen 24
(können & dürfen als die 50 vorstehenden Überzeugtheiten einem suggerieren wollen)
![]() Wenn Ihre Intelligenz [gar /koxmah/ חכמה; O.G.J. von Kenntnissenmengen bis Klugheit unterscheidend] Sie im Stich läßt 25
Wenn Ihre Intelligenz [gar /koxmah/ חכמה; O.G.J. von Kenntnissenmengen bis Klugheit unterscheidend] Sie im Stich läßt 25
![]() Wenn Sie Ihre Streßschwelle
überschreiten 27
Wenn Sie Ihre Streßschwelle
überschreiten 27 ![]()
![]() Ihre Schwelle
Ihre Schwelle ![]() verschieben 29
verschieben 29
![]() Verwundbarkeitsfaktoren
30
Verwundbarkeitsfaktoren
30
![]() Eine Verwundbarkeits-Checkliste 31
Eine Verwundbarkeits-Checkliste 31
![]() Streß vermehrt Fehler
32
Streß vermehrt Fehler
32  [Stresslage (als) Fünfstufen-Verwundbarkeitenquitzfornuliert: Wie stark (0/1 - 4/5),
zunächst separat betrachtet, „Ihre
[Stresslage (als) Fünfstufen-Verwundbarkeitenquitzfornuliert: Wie stark (0/1 - 4/5),
zunächst separat betrachtet, „Ihre ![]() Gefühle (spüren Sie eine emotionale Veränderung?), Ihre
Gefühle (spüren Sie eine emotionale Veränderung?), Ihre ![]() Gedanken
(neigt [nachstehender] Faktor [jeweils] dazu, Ihre Gedanken zu
beherrschen?) und Ihr
Gedanken
(neigt [nachstehender] Faktor [jeweils] dazu, Ihre Gedanken zu
beherrschen?) und Ihr ![]() Verhalten (verhalten
Sie sich anders, wenn dieser
Faktor auftritt?)“ beeinflussbar durch/von
(den
Faktoren/Größen):
Verhalten (verhalten
Sie sich anders, wenn dieser
Faktor auftritt?)“ beeinflussbar durch/von
(den
Faktoren/Größen):
„1. Hunger [sonstige,
zumal basale, ‚Mängel- äh Bedarfsbefriedigungen‘ lassen grüßen/treiben an bis um; O.G.J. zumal für ‚Hunger‘ Gehaltenes und andere ‚beruhigend-beschäftigende‘
/ ‚überbietende‘ Substituierungen entblößend]
2. Ärger [etwa Enttäuschungen, Erfordernisse/Kausalismen, Lücken, Provokationen und Störungen durch/in/über/von äußerlichen
respektive innerlichen Dingen/Worten und Ereignissen wie: Affekte/n, Aktion/en, Arglist, Argumente/n, Arroganz, Aussehen, Benehmen / Höflichkeit, Berührung/en, Deutungen
/ ‚Lesarten‘
/ Sichtweisen / Verständnisse, Erinnerung/en,
Erwartung/en, Extase / Fanatismen, Furchten / Ängste, Gedanken, Gefühle/n, Geräusch/e, Gerüche,
Gerüchte/n, Grundlosigkeit/en, Geschmack, Hass, Hilfe/n, Hyperrealität/en, Ideale / Ideen, Irrtümer/n bis Fehler/n,
Kräfte/n, Lehren, Liebe/n, ‚Medien‘ / Mittel / Möglichkeiten, Menschenverhalten, Opposition/en, Physis, Politik / Praxis / Publizistik, Prognosen
/ Risiken, Psyche, Reden, Reflexe, Regeln, Sachverhalte/n,
Schweigen, Sozialwesen, Technik/en, Überwältigtheit
/ Überzeugtheiten, Unrecht und dafür/-dagegen-Gehaltenes, Verfehlung/en, Vergleiche / Vorstellungen, Weg/e, Wollen (gar Begehren bis Bedarf); O.G.J.
gerade ‚in
Tiefen‘ solcher Begrifflichkeit mehr bis stärkeres gar ‚Desselben witternd‘]
3. Drogen-
und Tablettenmißbrauch [sic! ‚Dosierungsfragen‘
gehem zwar eher noch tiefer und weiter (als
Gebrauchsmaße, Medizin/Physiologie,
Rechtslage/n und Überbietungen), betreffen jedoch
– zumal aktuell – Individuen unterschiedlich;
O.G.J. altagssprachennahe, ‚unscharfe‘ Begrifflichkeiten
und kategoriale Überlappungen gerade hier
diagnostisch/therapeutisch begrüßend]
4.
Einsamkeit [zumal psychische, physische und soziale
‚Nähe/n‘ nicht davor schützen – spätestens Isolationszwangs-Erfahrungen, etwa
während Seuchen bis Pandemien, relativieren und substituieren auch manch
zwischenwesentliche Bedürfnisformen (gar ‚innermenschlich[er sich
bemerkend bis hamdhabend]‘); O.G.J. auch ‚den Sumpf der Langeweile‘ etwa mit M.v.M. zu potenziellen Über-
und aber zu den Unterforderungen zählend, und G.P.s F-Motivations-Typen
anstrengend/l#stig empfinden( mögen)d]
5. Müdigkeit
[‚Wer
müde ist, irrt sich/andere häufigen, wider
besseres Können, ohne (zumal diese) Fehler zu
bemerken‘; N.N.]
6. Schmerzen
[‚Geist
gegen Materie‘ ausspielen zu müssen/wollen hat sich u.E. auch nicht
bewährt: O.G.J. mit A.K., Ka.Ha., Et al.]
7. Krankheit
8. Großer
Verlust (Job, geliebter Mensch [enttäuschte Gewissheiten / Geborgenheiten / Hoffnungen / Lieben
bis Leidenschaften;
O.G.J. vgl. 10. bis /chet/ unten mit/und
Gewohnheiten])
9.
Schlafmangel [nicht
nur ‚im Schlaf‘ findet TiKuN תיקון wesentlich
statt – doch Erholung, Erkrankung, Erkenntnis, Furchten, Jass, ‚Innerliches
(zumal Ändern. Entscheiden, Verstehen, Wissen, Wollen)‘/Intuition, Können,
Kreativität, Lernen und Üben auch kaum gan ohne ihnm und ‚des Nachts‘ sind nochmal andere Themen/Angelegenheiten; O.G.J.
auch biographisch, besonders solche Bestimmungs- und Veränderungsversuchungen
bemekend bis entblößend]
10. Große
Veränderung“
CHeT-Spannungs-‚Zerissen‘-‚
äh Gleichzeitigkeit/en-חית]
Hat sie zu bemerken Einfluss darauf?
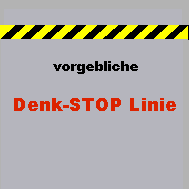 [Da/Wo gerade
der ‚Sprung des/im Denken/s‘ eine
wesentliche Handlung sein/werden darf
– können (bis
hyperrealisieren/tun)
[Da/Wo gerade
der ‚Sprung des/im Denken/s‘ eine
wesentliche Handlung sein/werden darf
– können (bis
hyperrealisieren/tun) 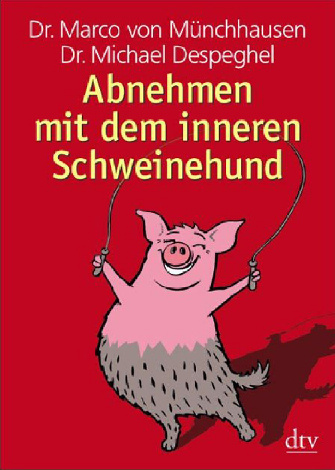 Gefühlsgewohnheiten
dennoch … Sie ahnten schon] Zu leichte/schwere Aufgaben,
Lasten und/oder Ziele nicht ausgeschlossen –
Liste was ‚Ausdauern und Gelassenheiten
auzufressen‘ droht.
Gefühlsgewohnheiten
dennoch … Sie ahnten schon] Zu leichte/schwere Aufgaben,
Lasten und/oder Ziele nicht ausgeschlossen –
Liste was ‚Ausdauern und Gelassenheiten
auzufressen‘ droht.  Abb.-av-wassetropenfolter-ani???
[Auch falls/obwohl Psyche weder rein elektro-chemisch
‚Nervositäten‘. noch mechanische
Dampfkessel – brauchen energetische Phänomene nicht bestritten/gestrichen
zu werden (zumal
gerade/immerhin Physik nicht weiß, oder bestimmt, was Energie [qaußer
rechnischem Materie-Äquivalent, oder diese] ist)] Belastbarkeits- und Toleranzangelegenheiten
grüén.
Abb.-av-wassetropenfolter-ani???
[Auch falls/obwohl Psyche weder rein elektro-chemisch
‚Nervositäten‘. noch mechanische
Dampfkessel – brauchen energetische Phänomene nicht bestritten/gestrichen
zu werden (zumal
gerade/immerhin Physik nicht weiß, oder bestimmt, was Energie [qaußer
rechnischem Materie-Äquivalent, oder diese] ist)] Belastbarkeits- und Toleranzangelegenheiten
grüén.
![]() Ihre Denkmuster erkennen 33
Ihre Denkmuster erkennen 33 ![]() [Hilt zwar beim/zum
Ändern/Unterlassen
– ersetzt/erzwingt es jedoch nicht; O.G.J. mit den Autoren]
[Hilt zwar beim/zum
Ändern/Unterlassen
– ersetzt/erzwingt es jedoch nicht; O.G.J. mit den Autoren]
![]() Das
Klein-Hühnchen-Syndrom (1)
Das
Klein-Hühnchen-Syndrom (1)
![]() Gedankenlesen (2)
Gedankenlesen (2)
![]() Alles
persönlich nehmen / auf sich bezogen deuten (3)
Alles
persönlich nehmen / auf sich bezogen deuten (3)
![]() Ihren PR-Agenten vertrauen (4)
Ihren PR-Agenten vertrauen (4)
![]() Ihren Kritikern vertrauen oder
welche erahnen (5)
Ihren Kritikern vertrauen oder
welche erahnen (5)
![]() Perfektionismus (6)
Perfektionismus (6)
![]() Vergleichssucht (7)
Vergleichssucht (7)
![]() Bestimmte Gebote des Sollens (9)
Bestimmte Gebote des Sollens (9)
![]() Ja-Aber-( mich affiziert es [jetzt/überhaupt] nicht-)Sucht (10)
Ja-Aber-( mich affiziert es [jetzt/überhaupt] nicht-)Sucht (10)
![]() Durch kognitive Therapie Fehler bekämpfen [sic! besser/lieber ‚Hürden
überwinden‘, die
diese Schwierigkeiten/Fehler noch fördern, bis (gerad durch Kräfte iher
Bekämpfugngen/paradox) provozieren; O.G.J.
Durch kognitive Therapie Fehler bekämpfen [sic! besser/lieber ‚Hürden
überwinden‘, die
diese Schwierigkeiten/Fehler noch fördern, bis (gerad durch Kräfte iher
Bekämpfugngen/paradox) provozieren; O.G.J. ![]() eher
didaktisch ritualisiend / ‘gentlehood‘] 36
eher
didaktisch ritualisiend / ‘gentlehood‘] 36
„Hier geht es um logische Analyse, was etwas
ganz anderes“ sei als eine Art und Weise psycho-logisch suggestiver
‚Kosmetik‘/des Gemurmels, ‚positiven Denkens‘ [sic! folglich
alleine auch nicht genügt: um bereits ‚Dummheiten‘ zu
unterlassen/ersetzen; O.G.J. mit den
Autoren, zu überspringende /
durchschreittanzende ‚Lücken‘ / Unterschiede
zwischen Einsichten undווaber
Taten anerkennend]  „um die Dinge besser erscheinen zu öassen, als sie“
seien. „Es geht darum, unsere
Fähigkeit, vernünftig zu urteilen, zu verbessern, und nicht unsere Fähigkeit, Entschuldigungen zu finden (was die meisten
von uns heutzutage schon allzugut können).
„um die Dinge besser erscheinen zu öassen, als sie“
seien. „Es geht darum, unsere
Fähigkeit, vernünftig zu urteilen, zu verbessern, und nicht unsere Fähigkeit, Entschuldigungen zu finden (was die meisten
von uns heutzutage schon allzugut können).
[…] Manchmal sagt Ihnen Ihr gesamter Erfahrungsschatz, wie Sie am besten handeln sollen.
Manchmal stimmt das auch, aber manchmal ist »instinktive
Reaktion« nur ein Deckname für
emotionales Denken  [sic! ‚emotionslose/emotionsfreies‘ Denken
wäre/wird allerdings vergessen/es; O.G.J. wider einen wesentlichen Entweder-oder-Irrtum,
seit/nach/mit Kant], welches einen Fehler nach dem
anderen nach sich zieht. Anders formuliert: Es
gibt Zeiten, in denen Ihre Instinkte der
Unterstützung durch Ihren Verstand bedürfen.
[sic! ‚emotionslose/emotionsfreies‘ Denken
wäre/wird allerdings vergessen/es; O.G.J. wider einen wesentlichen Entweder-oder-Irrtum,
seit/nach/mit Kant], welches einen Fehler nach dem
anderen nach sich zieht. Anders formuliert: Es
gibt Zeiten, in denen Ihre Instinkte der
Unterstützung durch Ihren Verstand bedürfen.
[Die Stop-Stelle, gar um
zu kontrollieren ob ein Zug kommt, zu ignorieren empfielt sich auch nicht immer, und gleich gar nicht nur da dies amtlich geahndet werden kann/soll]  [… immer mehr Stopstellen, helfen immer weniger, bis schaden/entwerten inflationär #hoer mehr – Grenzenfragen namentlich rücksichtsvoller Achrsamkeit/en] Wenn ein wenig [sic!]
zusätzliches Denken Sie vor den Rädern der
Lokomotive bewahren kann, warum nicht?“
(S. 36 f.; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.)
[… immer mehr Stopstellen, helfen immer weniger, bis schaden/entwerten inflationär #hoer mehr – Grenzenfragen namentlich rücksichtsvoller Achrsamkeit/en] Wenn ein wenig [sic!]
zusätzliches Denken Sie vor den Rädern der
Lokomotive bewahren kann, warum nicht?“
(S. 36 f.; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.)
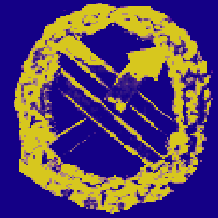 [Fachliche Gründe, gar ‚wider‘ Vermutungen/Besorgnis ‚unklares
Denken‘, Entfernung von/der ‚inneren Gartenbank‘, für möglich/beteiligt zu halten] Mehrere therapeutische/theoretische Ansätze der Psychologie:
[Fachliche Gründe, gar ‚wider‘ Vermutungen/Besorgnis ‚unklares
Denken‘, Entfernung von/der ‚inneren Gartenbank‘, für möglich/beteiligt zu halten] Mehrere therapeutische/theoretische Ansätze der Psychologie:
#hier„![]() Kognitive [Verhaltens-]Therapeuten
Kognitive [Verhaltens-]Therapeuten ![]() [Kompetente
Überzeugungstäter/innen – vom
Lateinisch: /profess/ ‚sich bekennen/vertrauen auf‘ repräsentierend
her, berufene – ringen um den Weg] unterscheiden sich von
Vertretern anderer Therapierichtungen durch ihre
Betonung der Rolle [sic!], die das »klare Denken« bei der Befreiung [sic!] von seelischen [sic!] Leiden spielt.
Innerhalb der therapeutischen Gemeinde [sic!] gibt es eine Vielzahl
widerstreitender Meinungen über den besten Weg, die Ursachen solcher Leiden zu erkennen und sie zu lindern. Die Debatte dreht sich hauptsächlich um die Frage, wo man zuerst ansetzen muß: ob bei den Gefühlen, den Handlungen oder
den Gedanken.
[Kompetente
Überzeugungstäter/innen – vom
Lateinisch: /profess/ ‚sich bekennen/vertrauen auf‘ repräsentierend
her, berufene – ringen um den Weg] unterscheiden sich von
Vertretern anderer Therapierichtungen durch ihre
Betonung der Rolle [sic!], die das »klare Denken« bei der Befreiung [sic!] von seelischen [sic!] Leiden spielt.
Innerhalb der therapeutischen Gemeinde [sic!] gibt es eine Vielzahl
widerstreitender Meinungen über den besten Weg, die Ursachen solcher Leiden zu erkennen und sie zu lindern. Die Debatte dreht sich hauptsächlich um die Frage, wo man zuerst ansetzen muß: ob bei den Gefühlen, den Handlungen oder
den Gedanken.

[Soweit bis da dies denkerisch-definierte Trennungen, zum be- bis ergreifenden, Verstehen-s/wollen
Vorfindlichens – ist/wird sowohl die Heftigkeit der Realitäten-handhaberischen (philosophisch/theologischen) Auseinandersetzungen in Methodenfragen, als
auch die, zumal ‚kenntnisreich(
begründet)e‘
dennoch/daher änderbare ‚Willkür‘ solcher Aufteilungen, zumal von Messbarem,
erwartbar] 
![]() [Omnipräsente Varianten gehen von
Bestimmtheit/en durch Gehinbotenstoffe, bis Hormone etc. oder ‚neuronale
Verschaltungen‘, aus – seltenere fragen eher wann solche, warum bis wie,
entstehen] Manche Therapeuten“
seien davon überzeugt, „daß wir ganz und gar von unseren Gefühlen regiert
werden. Das heißt, sie behaupten, daß
die Gefühle unsere Gedanken und Handlungen bestimmen. Diese Therapeuten glauben [sic!
‚vermuten, bis behaupten‘; O.G.J.], daß wir nur »in Kontakt mit unseren
Gefühlen kommen« müssen, unsere »Empfindungen nicht mehr unterdrücken« dürfen
und »alles herauslassen« sollen, um besser mit den Problemen, die uns das [sic!] Leben unweigerlich präsentiert, zurecht zu kommen.
[Omnipräsente Varianten gehen von
Bestimmtheit/en durch Gehinbotenstoffe, bis Hormone etc. oder ‚neuronale
Verschaltungen‘, aus – seltenere fragen eher wann solche, warum bis wie,
entstehen] Manche Therapeuten“
seien davon überzeugt, „daß wir ganz und gar von unseren Gefühlen regiert
werden. Das heißt, sie behaupten, daß
die Gefühle unsere Gedanken und Handlungen bestimmen. Diese Therapeuten glauben [sic!
‚vermuten, bis behaupten‘; O.G.J.], daß wir nur »in Kontakt mit unseren
Gefühlen kommen« müssen, unsere »Empfindungen nicht mehr unterdrücken« dürfen
und »alles herauslassen« sollen, um besser mit den Problemen, die uns das [sic!] Leben unweigerlich präsentiert, zurecht zu kommen. 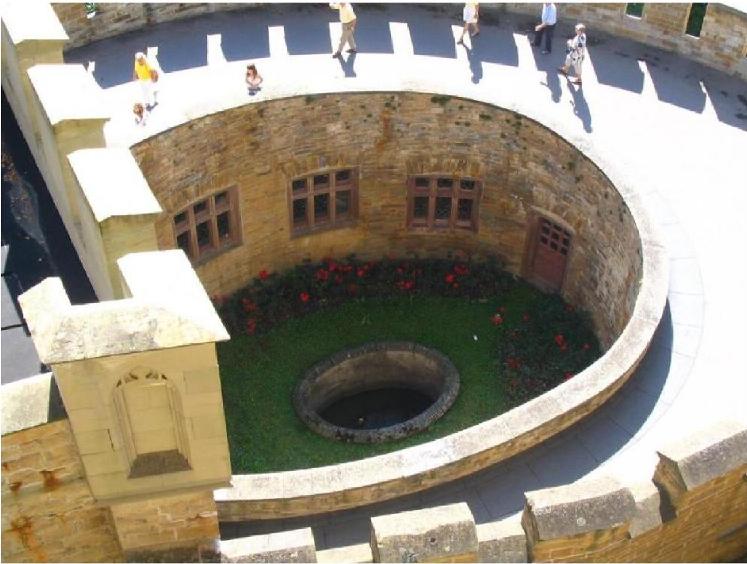 [Unterfloriger Zisterntiefbrunnen im Willensrund-Turm der
Überzeugtheitenfestung-Denkvorburg] Sie behaupten, daß man nur tief genug in sich selbst graben muß, um auf
einen Brunnen unterdrückter Gefühle zu stoßen - bis zum Rand gefüllt mit den
Taten unserer Eltern, unseres Lebenspartners, oder den Auswirkungen unserer
Lebensumstände. Sie glauben [sic!], daß wir einen Zustand des Wohlbefindens
[Unterfloriger Zisterntiefbrunnen im Willensrund-Turm der
Überzeugtheitenfestung-Denkvorburg] Sie behaupten, daß man nur tief genug in sich selbst graben muß, um auf
einen Brunnen unterdrückter Gefühle zu stoßen - bis zum Rand gefüllt mit den
Taten unserer Eltern, unseres Lebenspartners, oder den Auswirkungen unserer
Lebensumstände. Sie glauben [sic!], daß wir einen Zustand des Wohlbefindens
erreichen
können, wenn wir unser Inneres von diesen vergrabenen Gefühlen säubern, so wie
ein Zahnarzt Karies entfernt.
![]() [] Andere Therapeuten“ seien
überzeugt, „daß wir nicht nur diesen
unterirdischen Brunnen von Gefühlen angraben, sondern auch lernen müssen, auf
positivere, lebensbejahendere Art zu handeln. Anders ausgedrückt, diese
Einsicht in Ihre innersten Gefühle und Empfindungen muß von einer Änderung in
Ihrem Verhalten begleitet sein.
[] Andere Therapeuten“ seien
überzeugt, „daß wir nicht nur diesen
unterirdischen Brunnen von Gefühlen angraben, sondern auch lernen müssen, auf
positivere, lebensbejahendere Art zu handeln. Anders ausgedrückt, diese
Einsicht in Ihre innersten Gefühle und Empfindungen muß von einer Änderung in
Ihrem Verhalten begleitet sein.
![]() [] Wieder andere vertreten die Ansicht, daß allein in unserem
Verhalten der Schlüssel zu einem besseren Leben liegt. Nach ihrer Meinung werden Sie durch das bewußte [sic!] Bemühen, positiver zu handeln, mehr
im
[] Wieder andere vertreten die Ansicht, daß allein in unserem
Verhalten der Schlüssel zu einem besseren Leben liegt. Nach ihrer Meinung werden Sie durch das bewußte [sic!] Bemühen, positiver zu handeln, mehr
im
10
Leben
erreichen, auch wenn der Aufruhr in Ihrem Innern weiter gehen mag.
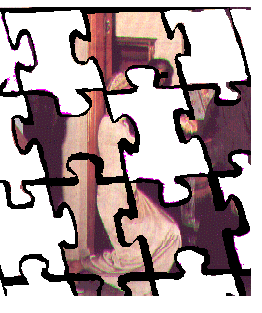 [] Die kognitive Therapie […]
[] Die kognitive Therapie […]
vertritt die Anschauung, daß jede dieser Theorien einen Teil der Antwort enthält. Aber jede von
ihnen läßt auch viele Fragen offen.
Zweifellos [sic!] ist
das, was Sie fühlen, von Bedeutung. Gefühle bilden einen zentralen Teil unseres
Seins [sic! – Müssen aber gerade nicht (nur oder
zwingend) als unabhängige/unbeeinflussbare Variable angesehen/hypothesiert
werden; O.G.J. mit den Autoren].
Dennoch hat die [sic!]
Erfahrung gezeigt, daß es
möglich ist, in Kontakt mit unseren Gefühlen zu kommen, genau zu verstehen, warum
wir so empfinden - und trotzdem zu leiden. Sie können verstehen [bis soch/anderen
erklären; O.G.J.], warum
Sie so fühlen, wie Sie fühlen, und
sich trotzdem auf eine selbstdestruktive Weise verhalten.
Sicher [sic! –
Verschlimmerungsentwicklungen bevor etwas besser wird, werden so häifig
erwartetm bis erlebt, dass dies zu archetypischen Grundpgäbomenen zählen mag;
O.G.J. eher physiologisch bis soziologisch als nur emotional
beobachtend/vermutend] kann
eine Katharsis - das Ausleben der Gefühle - bewirken [sic! oder wenigstens damit
korrelieren/zusammenhängen; O.G.J. wissenschaftlich exakter
kausalitätsskeptisch], daß es
uns besser geht.
Wenn Sie geweint [jedenfalls auf bestimmte Weise/n; O.G.J, mit
G.P. Erleichterung vin Erschöpfung unterscheidend, bis ‚wachsen‘ und ‚lernen‘
für möglich haltend] haben,
fühlen Sie sich erleichtert. Wenn Sie eine schwere Last ablegen, fühlen Sie
sich ofort wohler. Wenn jedoch das Problem, das Sie zum Weinen gebracht hat,
bestehen bleibt, werden Sie bald wieder weinen. Und wenn Sie die Last wieder
aufnehmen, werden Sie ihr Gewicht von neuem spüren.
Dies alles scheint die
Ansicht zu bestätigen, daß etwas zu tun, um
unsere Probleme zu lösen, in der Tat eine
unerläßliche Komponente dabei ist, unser Leben besser in den Griff zu bekommen.
Dennoch hat die [sic!]
Erfahrung auch gezeigt, daß es möglich ist, ![]() produktivere Verhaltensweisen
zu lernen - und sich immer noch schlecht zu fühlen.
produktivere Verhaltensweisen
zu lernen - und sich immer noch schlecht zu fühlen.
Am hilfreichsten wäre es also, eine Lebensformel [sic!] zu
finden, ie den Aufruhr in unserem Innern beruhigt und uns gleichzeitig
lehrt, auf positivere [sic!], produktivere Weise zu handeln.“ Was kognitive
Therapie unterscheide, sei „daß sie die versch i e d e n e n Elemente auf eine
neue Weise kombiniert -
e i n e W e i s e , d
i e M e n s c h e n n a c h e i g e n e r A u s s a g e schneller hilft,
leichter anzuwenden ist und dauerhaftere E r g e b n i s s e
erzielt.
Die kognitive Therapie verlangt nicht, daß Sie
zuerst in Ihrer emotionalen Vergangenheit graben, bevor S i e e t w a s z u r V
e r b e s s e r u n g I h r e r
G e g e n w a r t u n d I h r e r Z u k u n f t
u n t e r n e h m e n können. Was immer a n -
d e r e Ihnen in der Vergangenheit a n g e t a
n h a b e n , S i e müssen s i e n i c h t
z u e r s t b e s t r a f e n o d e r i h n e n
v e r g e b e n , b e v o r S i e sich selbst
gestatten
können, sich weiterzuentwickeln. Auch wenn die Umstände i n Ihrer V e r g a n g
e n h e i t ungünstig waren - und trotz sehrr e a l er Gründe für Qual und U n
s i c h e r h e i t - , w e r d e n S i e e n t d e c k e n , daß Sie in
sich selbst die
Fähigkeit tragen, Ihr Leben jetzt zum
Besseren zu ändern, wenn Sie be –
11
die Verantwortung für s i c h s e l b s t z u
übernehmen b e d e u t e t , d i e V e r a n t w o r t
u n g für d i e e i g e n e n Gefühle z u übernehmen. Es ist immer verlockend , anderen - oder den unglücklichen Umständen -
die Schuld für
Gefühle wie Wut oder Niedergeschlagenheit,
Angst oder Scham, Unsicherheit oder ein schlechtes Gewissen zu geben.
Aber die Schuld anderer kommt nicht ohne unser
Zutun zustande. Andere Menschen oder unglückhche Umstände mögen den Schmerz,
den Sie empfinden, verursacht haben, aber nur Sie haben die Kontrolle
darüber, ob Sie diesem
Schmerz gestatten, Sie weiterhin zu
beherrschen. Wenn Sie
wollen, daß diese Gefühle verschwinden, dann müssen [sic!] Sie
sich sagen: »Es liegt bei mir.«
[…]
Die kognitive Therapie […] basiert auf einer
Reihe von Entwicklungen in der klinischen Psychologie, die von der
Voraussetzung ausgehen, daß die meisten von
uns genug gesunden [sic!]
Menschenverstand besitzen, um die Krisen und Herausforderungen des Lebens zu
bewältigen. Doch allzu oft verläßt uns dieser [sic!] gesunde
Menschenverstand genau dann, wenn wir ihn am meisten brauchen. Unser
sogenanntes Urteilsvermögen wird von einer Flutwelle von Gefühlen überschwemmt,
die aus Liebe, Aufregung, Wut,
16
Unglücklichsein, Angst oder was auch immer bestehen kann. Die
Gefühle übernehmen die Kontrolle, und der Verstand macht Urlaub. Wirsuchen
lieber nach Scheinerklärungen, als logisch zu analysieren. Das geschieht so
häufig und bei so vielen Menschen , daß Formulierungen
wie »blind vor Liebe«, »trunken vor Glück«, »gelähmt vor Furcht« und »vor Angst
den Kopf verlieren« als Klischees in unsere Sprache eingegangen sind.
Um diese verbreiteten Denkfehler zu vermeiden,
brauchen wir einen Satz
praktischer Denkwerkzeuge, mit denen wir die Gefühle zurückdrängen [sic! Summenverteilungsparadigmatische
Schwäche, bis ‚dummheit‘, solcher Änsätze da und wo verdr+ngte/bekämpfte
Persönlichkeitsanteile im so bissiger sind/werden je mehr wir sie bekämpfen;
O.G.J. mit M.v.M. etal.] und zu
unserer Vernunft zurückkehren können. [sic!]
Die kognitive Therapie gibt uns diese Werkzeuge
in die Hand. Die fünfundzwanzig in diesem Buch beschriebenen Techniken stützen
sich auf ein therapeutisches Modell, das Aaron T. Beck entwickelt hat,
Psychiater an der Universität von Pennsylvania, der weltweit als einer der
wichtigsten Theoretiker der Psychologie anerkannt ist. (S. 10-12 u. 16) #hier ![]()
 ‚Die
Welt / Das Lebensglas ist voller …‘ In Häufigkeiten iher Nennungen
(V.F.B.)
‚Die
Welt / Das Lebensglas ist voller …‘ In Häufigkeiten iher Nennungen
(V.F.B.)
![]() [Ups
‚Pessimismuspflicht‘ äh
‚Realismus‘ bedeuten, dass nicht mehr als 60% positiver Nennungen zu
erwarten/vernünftig – Menschen lernfähige Versager – sind]
[Ups
‚Pessimismuspflicht‘ äh
‚Realismus‘ bedeuten, dass nicht mehr als 60% positiver Nennungen zu
erwarten/vernünftig – Menschen lernfähige Versager – sind]
 „„Die eigentliche
Ursache [sic!] des Leids liegt in unserer Unwilligkeit, Tatsachen als reelle Tatsachen
und Ideen als blosse Ideen zu sehen, und
dadurch, dass wir ununterbrochen Tatsachen mit Konzepten vermischen. Wir
tendieren dazu, Ideen für Tatsachen zu halten, was Chaos
in der Welt [sic!] schafft.“
„„Die eigentliche
Ursache [sic!] des Leids liegt in unserer Unwilligkeit, Tatsachen als reelle Tatsachen
und Ideen als blosse Ideen zu sehen, und
dadurch, dass wir ununterbrochen Tatsachen mit Konzepten vermischen. Wir
tendieren dazu, Ideen für Tatsachen zu halten, was Chaos
in der Welt [sic!] schafft.“ ![]() P.W.etwa 1955 zitiert (verlinkende
und andere Hervorhebungen O.G.J.)
P.W.etwa 1955 zitiert (verlinkende
und andere Hervorhebungen O.G.J.)
“
 [Es
kommt längst nicht nur/immerhin darauf an, ‚sich (fachlich)sprachlich
hinreichend präzise und (Empirie/Vorfindliches aspektisch) zutreffend
repräsentierend auszudrücken/darzustelleb – sondern (gar entscheidender, da wechselseitig
beeimflusst, bis unerzwingbar, auch) darauf
wie etwas von/bei wem verstanden, bis verwedet wird] Insbesondere/Zumindest
typische Denkfehlerfallen beschreibend bis diagnostisch bleiben – hingegen eher
Darstellungsfprm unabhängig wählbar – wesentlich:
[Es
kommt längst nicht nur/immerhin darauf an, ‚sich (fachlich)sprachlich
hinreichend präzise und (Empirie/Vorfindliches aspektisch) zutreffend
repräsentierend auszudrücken/darzustelleb – sondern (gar entscheidender, da wechselseitig
beeimflusst, bis unerzwingbar, auch) darauf
wie etwas von/bei wem verstanden, bis verwedet wird] Insbesondere/Zumindest
typische Denkfehlerfallen beschreibend bis diagnostisch bleiben – hingegen eher
Darstellungsfprm unabhängig wählbar – wesentlich:
![]() Unausgesprochene [sic] Gedanken aussprechen 37
Unausgesprochene [sic] Gedanken aussprechen 37
Beim/Im  methodischen Ansatz, der
auch an/bei schweren psychischen
Erkrankungen bewährten Therapie, gehe es eher um die, aktuell selbst unbemerkten eigenen,
Denkmuster/individuellen Schemata: „Die kognitive Therapie lehrt, unausgesprochene
Gedanken in Worte[/begrifflich] zu fassen beziehungsweise auszusprechen. Diese
unausgesprochenen Gedanken liegen direkt unterhalb der Bewußtseinsebene,
und es ist nicht schwer, ihrer gewahr zu werden. Viele Leute glauben [sic!], daß
Gedanken streng in bewußte und unbewußte [sic!]
unterteilt sind, wobei letztere so tief vergraben sind, daß es einer großen
Anstrengung bedarf, um sie auf die
Bewußtseinsebene zu bringen. Doch für die unausgesprochenen Gedanken gilt
das nicht. Sie mögen zwar nicht an vorderster
Stelle in Ihrem Kopf [sic!] vorhanden sein, aber es kostet nicht viel
Mühe, sie nach vorne zu ziehen - genau so wie Sie am Tuner einen Radiosender
deutlicher einstellen können.
methodischen Ansatz, der
auch an/bei schweren psychischen
Erkrankungen bewährten Therapie, gehe es eher um die, aktuell selbst unbemerkten eigenen,
Denkmuster/individuellen Schemata: „Die kognitive Therapie lehrt, unausgesprochene
Gedanken in Worte[/begrifflich] zu fassen beziehungsweise auszusprechen. Diese
unausgesprochenen Gedanken liegen direkt unterhalb der Bewußtseinsebene,
und es ist nicht schwer, ihrer gewahr zu werden. Viele Leute glauben [sic!], daß
Gedanken streng in bewußte und unbewußte [sic!]
unterteilt sind, wobei letztere so tief vergraben sind, daß es einer großen
Anstrengung bedarf, um sie auf die
Bewußtseinsebene zu bringen. Doch für die unausgesprochenen Gedanken gilt
das nicht. Sie mögen zwar nicht an vorderster
Stelle in Ihrem Kopf [sic!] vorhanden sein, aber es kostet nicht viel
Mühe, sie nach vorne zu ziehen - genau so wie Sie am Tuner einen Radiosender
deutlicher einstellen können.
Wenn Sie sich
nicht jedes Gedankens […] bewußt
sind. Liegt das wahrscheinlich daran, daß viele Gedanken auf Gewohnheit beruhen. Die meisten Menschen
denken bei Gewohnheiten nur an Handlungen. Es gibt gute Gewohnheiten, wie
Zähneputzen, und schlechte Gewohnheiten, wie Nägelkauen. Aber in der Tat haben
wir auch beim Denken gute und schlechte
Gewohnheiten.  [Zwar gerade
‚individuelles‘, gar einzigartiges, aber eben doch wiederkehrendes,
mithin erkennbares, Schema]
[Zwar gerade
‚individuelles‘, gar einzigartiges, aber eben doch wiederkehrendes,
mithin erkennbares, Schema] 
Handlungs- und Denkgewohnheiten gleichen sich
insofern, als beide automatisch ablaufen. Normalerweise kostet es Sie
keine Konzentration oder Planung, Ihren
Schlüssel in die Haustür zu stecken, um diese auf zu schließen. Sie tun es einfach
[sic! weder nur ein einmaliger Vorgang, eher
im Gegenteil, noch einer der nicht komplex
wäre, sondern einem allenfalls so vorkommt; O.G.J. mit den Autoren nachstehend] - automatisch, gewohnheitsmäßig. Ihr Gehirn arbeitet
zwar, aber unauffällig [sic! jedenfalls bis zur, gar irritierenden,
‚Bemerkung‘ vorbereitender Potenziale: O.G.J. pro endlicher Willensfreiheiten].
Die Gewohnheiten, die wir beim Denken
entwickeln, werden stark von etwas beeinflußt, das Psychologen unser
individuelles »Schema« nennen. Das Schema umfaßt die grundlegenden Muster, nach
denen wir erhaltene Informationen [sic! eher sinnliche bis neuronale Reize/Daten
deutend; O.G.J. gerne basal ‚natur- bis Komunikationswissenschaftlich‘ exformativ] ordnen und
verarbeiten. Wir erwerben unser eigenes spezielles Schema, indem wir uns einige
oder alle Lebensregeln aneignen, die uns zu
Hause oder in der Schule beigebracht werden, oder die wir durch unsere Religion
oder von Freunden lernen.
Ein individuelles Schema ist wie eine Brille, durch die Sie die Welt [sic!
Realitäten interessiert
selektierend anleuchtend; O.G.J. namentlich
mit sir Karl Reimund wider das ‚Kübelmodell‘ unserer
Wahrnehmung] betrachten.
Wenn Ihre Brille purpurrote Gläser hat, sehen Sie die Welt [sic!]
purpurn gefärbt. Genau
[sic!] so glaubt [sic!] wahrscheinlich jemand, der die Welt [sic!] durch Gläser
betrachtet, auf denen »abhängig und hilflos« steht, daß es gefährlich ist, zu
widersprechen, daß es gefährlich ist, sich zu beschweren, daß es wichtig ist, von allen gemocht zu
werden.
 Ihr
persönliches Schema - die Art, wie
Sie die Welt [sic!] sehen – erklärt auch, warum manche der zehn dümmsten Denkfehler Sie mehr
betreffen als andere. Wenn Ihr Schema besagt, daß die Welt [sic!] ein
gefährlicher Ort ist, an dem das Überleben [oder gleich gar darüber hinaus
Gehendes etwa ‚Schicksale/Karma‘ bis ‚Ihr/anderer Seelenheil‘ im Futurum exactum; O.G.J. theologisch]
davon abhängt, daß man sehr, sehr vorsichtig ist, dann neigen Sie vermutlich
dazu, automatisch - aus Gewohnheit - auf die »Klein-Hühnchen«- oder »Was
ist-wenn«-Art zu denken.
Ihr
persönliches Schema - die Art, wie
Sie die Welt [sic!] sehen – erklärt auch, warum manche der zehn dümmsten Denkfehler Sie mehr
betreffen als andere. Wenn Ihr Schema besagt, daß die Welt [sic!] ein
gefährlicher Ort ist, an dem das Überleben [oder gleich gar darüber hinaus
Gehendes etwa ‚Schicksale/Karma‘ bis ‚Ihr/anderer Seelenheil‘ im Futurum exactum; O.G.J. theologisch]
davon abhängt, daß man sehr, sehr vorsichtig ist, dann neigen Sie vermutlich
dazu, automatisch - aus Gewohnheit - auf die »Klein-Hühnchen«- oder »Was
ist-wenn«-Art zu denken.
Wenn Ihr Schema besagt, daß es das Wichtigste im Leben ist, sich
vor anderen auszuzeichnen, könnten Ihre Denkgewohnheiten »Vergleichssucht«, »Ihren Kritikern glauben« oder »Ihren PR-Agenten glauben« umfassen.
Weil wir in dem Glauben
[sic!] aufwachsen, daß unser spezielles Schema
die Dinge einfach
zeigt, »wie sie sind«, stellen wir es meistens nicht in Frage.
Aber weil Sie etwas
glauben [sic!] - und alle anderen, die Sie kennen, es auch Glauben [sic!] -, wird
es dadurch nicht notwendigerweise wahr. Wenn Sie
eine Brille mit blauen Gläsern tragen, sehen Sie alles blaustichig. Wenn Sie
mit diesen Gläsern eine Zitrone ansehen, welche Farbe hat diese Zitrone?
Viele Leute würden ohne zu zögern »Grün«
antworten, denn das erhält man, wenn man Blau und Gelb mischt. Aber die Antwort
lautet, daß die Zitrone immer noch gelb ist. Nur weil Sie und die anderen Leute
mit blauen Gläsern sie grün sehen, verwandelt sich die Zitrone nicht in eine
Limone.
Wenn Sie beginnen, Ihre eigenen speziellen Denkgewohnheiten zu analysieren,
werden Sie eventuell die Gläser wechseln wollen - um die Welt [sic!] auf eine neue [sic!] Art zu betrachten.“
![]() Neue Denkgewohnheiten 39
Neue Denkgewohnheiten 39  [Sehr viele versuchen, oder versprechen/verlangen, Ihre Gewohnheiten / Verhaltensmuster zu ändern /
auszusetzen – nicht etwa erst/allein/nur ‚Motivations-‘ bis Verhaltenstrainer;
O.G.J.]
[Sehr viele versuchen, oder versprechen/verlangen, Ihre Gewohnheiten / Verhaltensmuster zu ändern /
auszusetzen – nicht etwa erst/allein/nur ‚Motivations-‘ bis Verhaltenstrainer;
O.G.J.] 
![]() Eine benutzerfreundliche Therapie
40
Eine benutzerfreundliche Therapie
40
![]() 2. Das Klein-Hühnchen-Syndrom 42
2. Das Klein-Hühnchen-Syndrom 42 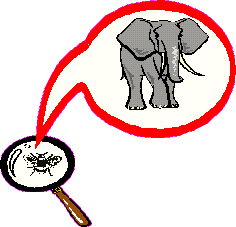
![]() Die Nerven verlieren und andere Symptome 43
Die Nerven verlieren und andere Symptome 43
![]() /
/![]() Herbeidenken, was Sie fürchten 44
Herbeidenken, was Sie fürchten 44
![]() Realistisch denken 46
Realistisch denken 46
![]() Sich selbst zuhören 47
Sich selbst zuhören 47
![]() Ihre Gedanken in Frage
stellen
50
Ihre Gedanken in Frage
stellen
50
![]() Ent-Katastrophisieren 51
Ent-Katastrophisieren 51
![]() Die Beweise in Frage stellen 53
Die Beweise in Frage stellen 53
![]() Den Argumentationsverlauf
aufzeichnen
54
Den Argumentationsverlauf
aufzeichnen
54
![]() Ihre eigene Verteidigung
übernehmen
55
Ihre eigene Verteidigung
übernehmen
55
![]() Was stimmt nicht in diesem
Bild?
57
Was stimmt nicht in diesem
Bild?
57
![]() Die vielen Pfade nach
Katastrophenheim
58
Die vielen Pfade nach
Katastrophenheim
58
![]() In Zwischenschritten denken 61
In Zwischenschritten denken 61
![]() Selbsterhaltung statt
Selbstzerstörung
62
Selbsterhaltung statt
Selbstzerstörung
62
[Was
das/unser gar wegweisend wichtiges Schwellenphänomen ‚Angst‘ und\aber
insbesondere die erschreckenden Schrecken davor angeht – wird, nicht nur hier,
zu häufig Gegenübermächtiges ‚übersehen‘: Des uns der Menschen ‚Behaustheit‘
auf Erden, bis in sozialen Beziehungsrelationen, sind/werden weniger durch, gar
‚narzistisch‘ zu nennende, Kränkungen (darunter übrigens hauptsächlich, doch
seltener erwähnte: Sterblichkeit) bedroht – als etwa durch von Alleinheiten /
Pantheismussehnsüchten]
![]() 3. Gedankenlesen 64
3. Gedankenlesen 64 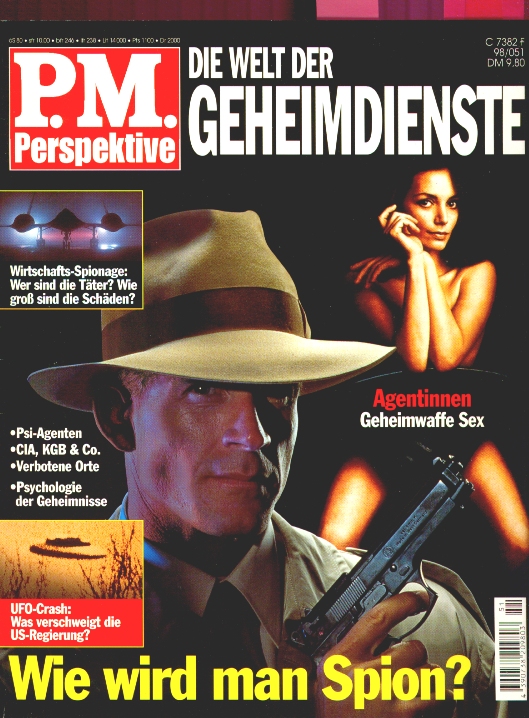 Die Illusion Gedankenlesen sei ‚etwas ganz
natürliches‘ wirke sich nach zwei Seiten aus: „1. Wir setzen voraus, daß wir
wissen was andere denken. […] 2. Wir setzen voraus, dass andere Menschen wissen
können und sollten, was wir denken, ohne daß wir es ihnen mitteilen
müssen.“ Besagt/Bemerkt ‚vor-aussetzen‘,
dass vorher (der
Verstand)
aussetzt? #hier
Die Illusion Gedankenlesen sei ‚etwas ganz
natürliches‘ wirke sich nach zwei Seiten aus: „1. Wir setzen voraus, daß wir
wissen was andere denken. […] 2. Wir setzen voraus, dass andere Menschen wissen
können und sollten, was wir denken, ohne daß wir es ihnen mitteilen
müssen.“ Besagt/Bemerkt ‚vor-aussetzen‘,
dass vorher (der
Verstand)
aussetzt? #hier
 [‚Wenn
Du denkst, Du denkst, dann hast Du nur Du nur‘ gedacht: was sie denkt,
empfindet, weiß, und will, bis zumal (warum / wozu) tut]
[‚Wenn
Du denkst, Du denkst, dann hast Du nur Du nur‘ gedacht: was sie denkt,
empfindet, weiß, und will, bis zumal (warum / wozu) tut] 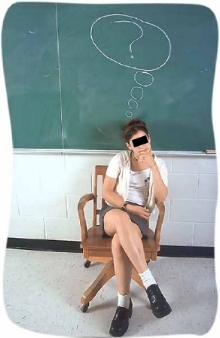
![]() Je enger die Beziehung desto größer die Illusion 65 Wenn wir einander gut kennen, ‚wissen‘/erinnern
wir manchmal begründet vermutend, statt immer, zutreffend vorher, wie wir
wechselseitig wahrscheinlich reagieren. Doch: „Menschen neigen [stets] zur
Unberechenbarkeit.“ Außerdem neigen sie dazu „ihre kleinen Geheimnise sogar vor
ihren liebsten und engsten Vertrauten2 zu wahren.
Je enger die Beziehung desto größer die Illusion 65 Wenn wir einander gut kennen, ‚wissen‘/erinnern
wir manchmal begründet vermutend, statt immer, zutreffend vorher, wie wir
wechselseitig wahrscheinlich reagieren. Doch: „Menschen neigen [stets] zur
Unberechenbarkeit.“ Außerdem neigen sie dazu „ihre kleinen Geheimnise sogar vor
ihren liebsten und engsten Vertrauten2 zu wahren.
![]() Warum wir Vermutungen anstellen 67
Warum wir Vermutungen anstellen 67
 [Eine
wichtige Grenze bleiben wohl Notwendigkeiten sich/anderen Verhalten (gleich gar/zumal von Menschen – ‚eigenes‘ bis ‚fremdes‘) erklären,
zumindest aber deuten(d kategorisieren***), zu s/wollen; O.G.J.]
[Eine
wichtige Grenze bleiben wohl Notwendigkeiten sich/anderen Verhalten (gleich gar/zumal von Menschen – ‚eigenes‘ bis ‚fremdes‘) erklären,
zumindest aber deuten(d kategorisieren***), zu s/wollen; O.G.J.]
![]() Zeichen und Spuren 68
Zeichen und Spuren 68
![]() Das Phänomen der Komplettierung 70
Das Phänomen der Komplettierung 70
![]() Anzeichen mißdeuten 72
Anzeichen mißdeuten 72
![]() Wenn Sie die Botschaft falsch deuten 73
Wenn Sie die Botschaft falsch deuten 73
![]() Wenn andere die Botschaft falsch deuten 76
Wenn andere die Botschaft falsch deuten 76
![]() Warum es so schwer ist, die Gewohnheit des Gedankenlesens
aufzugeben
79
Warum es so schwer ist, die Gewohnheit des Gedankenlesens
aufzugeben
79
![]() Das Problem benennen 80
Das Problem benennen 80
![]() Ihre Vermutungen in Frage
stellen
81
Ihre Vermutungen in Frage
stellen
81
![]() Eine Vermutung testen 83
Eine Vermutung testen 83
![]() Eine negative Vorstellung
durch eine positive ersetzen 83
Eine negative Vorstellung
durch eine positive ersetzen 83
anstatt/ohne simpel (und schon gar nicht um
einfach/naiv)
‚positiv zu denken‘.
![]() Sagen, was Sie denken 84
Sagen, was Sie denken 84
![]() Ihre eigenen Gedanken lesen 85
Ihre eigenen Gedanken lesen 85
![]() 4.
Personalisieren 86
4.
Personalisieren 86 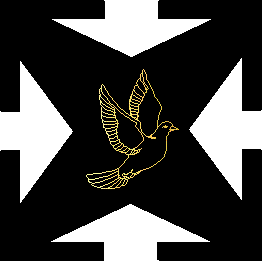 [Eine
durchaus gängige Variante, sich (bis gleich gar anderen) alles (überhaupt Wahrgenommene/Wesentliche) ursächlich erklären
/ deutend zu verstehen geben ‚müssen‘/wollen: Abstrakta. zumal negativ wirkende, werden stereotypisch personifizierend
Schuldigen / ‚Sündenböcken‘ zugeschreiben – gleich gar kollektivierten Andren /
Fremden / Ungläubigen]
[Eine
durchaus gängige Variante, sich (bis gleich gar anderen) alles (überhaupt Wahrgenommene/Wesentliche) ursächlich erklären
/ deutend zu verstehen geben ‚müssen‘/wollen: Abstrakta. zumal negativ wirkende, werden stereotypisch personifizierend
Schuldigen / ‚Sündenböcken‘ zugeschreiben – gleich gar kollektivierten Andren /
Fremden / Ungläubigen]
![]() Eine Bemerkung - vielfältige Reaktionen 87
Eine Bemerkung - vielfältige Reaktionen 87
![]() Der Ich-Scanner 88
Der Ich-Scanner 88
![]() Was dabei herauskommt, wenn Sie Dinge persönhch nehmen 88
Was dabei herauskommt, wenn Sie Dinge persönhch nehmen 88
![]() Die häufigsten Auslöser des Personahsierens 92
Die häufigsten Auslöser des Personahsierens 92
![]() Der Akkumulationseffekt 96
Der Akkumulationseffekt 96
![]() Analysieren und
Depersonalisieren
97
Analysieren und
Depersonalisieren
97
![]() Wenn Sie sich zu Recht
angegriffen fühlen
98
Wenn Sie sich zu Recht
angegriffen fühlen
98
![]() Überlegt reagieren 101
Überlegt reagieren 101
![]() 5. Ihrem PR-Agenten glauben 103
5. Ihrem PR-Agenten glauben 103  [Auch s/Sie sind
besser als I/ihr Ruf,
doch so gut wie i/Ihr Nachruf … (sahen die
wenigsten jemals …)]
[Auch s/Sie sind
besser als I/ihr Ruf,
doch so gut wie i/Ihr Nachruf … (sahen die
wenigsten jemals …)]
![]() Wie eine Überdosis positiven
Denkens negative Resultate erzielen kann [sic!] 104
Wie eine Überdosis positiven
Denkens negative Resultate erzielen kann [sic!] 104
![]() Auf den Lorbeeren ausruhen
Auf den Lorbeeren ausruhen
![]() Unflexible Erfolgsvorstellungen
Unflexible Erfolgsvorstellungen
![]() Ihre Mutter
Ihre Mutter ![]() Ihre Freunde
Ihre Freunde ![]() Leute, die für Sie arbeiten
Leute, die für Sie arbeiten ![]() Leute, für die Sie arbeiten
Leute, für die Sie arbeiten ![]() Die Stimme des Privilegs
Die Stimme des Privilegs
![]() Die Stimme der Religion
Die Stimme der Religion ![]() Leute, die Sie motivieren wollen
Leute, die Sie motivieren wollen
![]() Der innere PR-Agent 113
Der innere PR-Agent 113
![]() Realitätskontrolle 115
Realitätskontrolle 115
![]() Die Kraft des praktischen
Denkens
Die Kraft des praktischen
Denkens
![]() In eine andere Richtung vorrücken
In eine andere Richtung vorrücken
![]() Ihren PR-Agenten entgegentreten
Ihren PR-Agenten entgegentreten
![]() Die wahre [sic!] Erfolgseinstellung
119
Die wahre [sic!] Erfolgseinstellung
119
 [‚Revisionen küssen?‘ gehört zu dem falschen/überzogenen
Entweder-Oder-Fragestellungen]
[‚Revisionen küssen?‘ gehört zu dem falschen/überzogenen
Entweder-Oder-Fragestellungen]
Gar Gemeinsames
am ‚Fremdvertrauensproblem‘ umd am ‚Selbstvertrauenssyndrom‘ bleiben
deren Unabwendlichkeiten.
_knickst_vor_Ronja_auf_3G_Hotelpier_ueber_Mototboot-7479.jpg) ‚Anschauung‘ und ‚Begriff‘ sond
zwar nicht ohne einander gegeben, doch müssen diese aspektische Komplexität weder Empirismen noch
Idealismen bemerken / zugeben.
‚Anschauung‘ und ‚Begriff‘ sond
zwar nicht ohne einander gegeben, doch müssen diese aspektische Komplexität weder Empirismen noch
Idealismen bemerken / zugeben.
_knickst_vor_Birgitte_auf_3G_Hotelpier_ueber_Mototboot-7480.jpg) [Komplexitäten ‚bedürfen‘/werden
[Komplexitäten ‚bedürfen‘/werden
![]() mindestens so weitgehend
reduziert, dass Verhalten fientisch / ‚handlungsfähig‘ /
zurechenbar erscheint] Längst nicht immer alle (wenigstens Wahrhaftigen)
mindestens so weitgehend
reduziert, dass Verhalten fientisch / ‚handlungsfähig‘ /
zurechenbar erscheint] Längst nicht immer alle (wenigstens Wahrhaftigen) ![]() ‚sehen‘ (‚hier‘
zumal/zumindest) auch was (manch)
andere dafür, bis davon, halten.
‚sehen‘ (‚hier‘
zumal/zumindest) auch was (manch)
andere dafür, bis davon, halten. 
![]() 6. Ihren
Kritikern glauben 120
6. Ihren
Kritikern glauben 120 
![]() Der Stimmgabel-Faktor 120
Der Stimmgabel-Faktor 120
![]() Woher die
Kritikempfänghchkeit kommt 122
Woher die
Kritikempfänghchkeit kommt 122
![]() Lernen, Kritikern zu widersprechen 123
Lernen, Kritikern zu widersprechen 123
![]() Filtern und Bewerten 124
Filtern und Bewerten 124
![]() Wer
sagt das?
Wer
sagt das?
![]() Was
alle sagen
Was
alle sagen
![]() Mit
Vorurteilen umgehen
Mit
Vorurteilen umgehen
![]() Der innere Kritiker 129
Der innere Kritiker 129
![]() Hilfreiche Kritik erkennen können 131
Hilfreiche Kritik erkennen können 131
![]() Ihre Reaktion aufschieben 132
Ihre Reaktion aufschieben 132
![]() /
/![]() Mit Kritik umgehen 133
Mit Kritik umgehen 133
Es gibt viele mögliche Reaktionen auf Kritik [mit ettlichen Untervarianten]:
![]() Sie können sie einfach zurückweisen.
Sie können sie einfach zurückweisen.
![]() Sie können Kritik gleichzeitig akzeptieren und zurückweisen.
Sie können Kritik gleichzeitig akzeptieren und zurückweisen.
![]() Sie können Kritik auf ein Minimum beschränken, wenn Sie
sich mit ähnlich denkenden Menschen umgeben.
Sie können Kritik auf ein Minimum beschränken, wenn Sie
sich mit ähnlich denkenden Menschen umgeben.
![]() Sie können sich Kritik zunutze machen.
Sie können sich Kritik zunutze machen.
![]() Es ist kein Fehler, sich Kritik anzuhören 137
Es ist kein Fehler, sich Kritik anzuhören 137
![]() Die Schwingungen unterbrechen 137
Die Schwingungen unterbrechen 137
![]() 7. Perfektionismus 139
7. Perfektionismus 139  [
[Stets
und ausnahmslos gar film- oder zumindest druckreif vorbildliches Verhalten als
aktueller Massstab anstatt als eherend
hochgehaltene Orientierungshilfe / (nicht
einmal bedingungslos, um jeden Preis)
anzustrebende
Fernziele] 
![]() Die Unperfektheiten der Perfektion 129
Die Unperfektheiten der Perfektion 129
![]() Oft ist Perfektion eine Frage der persönlichen Meinung.
Oft ist Perfektion eine Frage der persönlichen Meinung.
![]() Perfektion ist manchmal zeitabhängig.
Perfektion ist manchmal zeitabhängig.
![]() Perfektion kann Unperfektes erzielen.
Perfektion kann Unperfektes erzielen.
![]() Perfektion kann schädlich sein.
Perfektion kann schädlich sein.
![]() Hohe Maßstäbe sind in Ordnung 141
Hohe Maßstäbe sind in Ordnung 141
![]() Das perfekte Maß an Perfektion 142
Das perfekte Maß an Perfektion 142
![]() Warum es so schwer fällt, Kompromisse einzugehen 145
Warum es so schwer fällt, Kompromisse einzugehen 145
![]() Den
Weg bereiten für Veränderungen
Den
Weg bereiten für Veränderungen
![]() Der »perfekte« Standpunkt 146
Der »perfekte« Standpunkt 146
![]() Ihre Maßstäbe setzen 150 [Können & dürfen
sich von jenen anderer Leute, bis der Mehrheit/Minderheit, unterscheiden;
O.G.J. mit der gar apostolischen Warnung bis zum Zielverlust durch Verwechslung
von Komass und gar Maßstab damit]
Ihre Maßstäbe setzen 150 [Können & dürfen
sich von jenen anderer Leute, bis der Mehrheit/Minderheit, unterscheiden;
O.G.J. mit der gar apostolischen Warnung bis zum Zielverlust durch Verwechslung
von Komass und gar Maßstab damit]
![]() Flexibilität entwickeln 153 [Grüße vom bis
Zusammenarbeit mit M.v.M. / ‚innerem Schweinehunf bis Freund‘]
Flexibilität entwickeln 153 [Grüße vom bis
Zusammenarbeit mit M.v.M. / ‚innerem Schweinehunf bis Freund‘]
![]() Ein schrittweises Verfahren 157
Ein schrittweises Verfahren 157
![]() Etwas, nicht nichts 159
Etwas, nicht nichts 159
![]() 8. Vergleichssucht 160
8. Vergleichssucht 160 ![]()
[Irrgartenbastion des Vergleichens der
Überzeugtheitenfestungsanlage]
Die
Fähigkeit Vergleiche anzustellen 160
Der Ich-Faktor 161
Wenn andere vergleichen 165
Vergleiche als Mittel zur
Motivierung
167
Stumpfer Gegenstand statt Ansporn 168
Wie wirkt es bei Ihnen? 169
Wenn Sie unter Vergleichssucht leiden 170
Die Realität ins Spiel bringen 173
![]() Was vergleichen Sie?
Was vergleichen Sie?
![]() Wie korrekt ist Ihr Vergleich?
Wie korrekt ist Ihr Vergleich?
![]() Schließen Sie von einer Tatsache, die Sie über eine Person
wissen, auf ihr gesamtes Leben?
Schließen Sie von einer Tatsache, die Sie über eine Person
wissen, auf ihr gesamtes Leben?
![]() Heben Sie bei Vergleichen alle positiven Aspekte auf der
anderen Seite hervor, ignorieren aber diejenigen auf Ihrer Seite? Listen Sie
gerechterweise die negativen Aspekte beider Seiten auf?
Heben Sie bei Vergleichen alle positiven Aspekte auf der
anderen Seite hervor, ignorieren aber diejenigen auf Ihrer Seite? Listen Sie
gerechterweise die negativen Aspekte beider Seiten auf?
![]() Verwechseln Sie »dort hinkommen« mit »schon da sein«?
Verwechseln Sie »dort hinkommen« mit »schon da sein«?
Die Meinung anderer einholen 176
Die Na-und-Lösung 177
Was sind Sie bereit aufzugeben? 178
Einen anderen Vergleich finden 178
Ein Schritt nach dem anderen 179
Vor- und Nachteile vergleichen 181
Weniger vergleichen 181
![]() 9. Was-ist-wenn-Denken 183
9. Was-ist-wenn-Denken 183 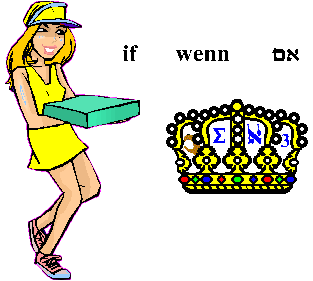 [‚Alles was schief gehen kann, das geht auch
schief.‘ – ‚Murphy war ein
Optimist!‘ N.N.] drehe
sich nur um Sorgen, Sorgen, Sorgen zusätzlich zu den ‚normalen‘ Bedrohungen /
Risiken um Dinge und Umstände besorgt, die sehr unwahrscheinlich oder nicht existent. „Und die Sorgen um die realen
Probleme nehmen ein Ausmaß an, das Ihre
Kompetenz, etwas gegen sie zu unternehmen, schwächt statt stärkt.“
Im Unterschied zum ‚Klein-Hühnchen-Syndrom‘
gehe es ‚Was-ist-Wenn‘-Persönlichkeiten nicht
darum, dass gerade/zeitnah etwas Schreckliches
passiere, sondern darum, dass es passieren könnte. Solche Fragen /
Problemstellungen die ein Verwundbarkeits- und
Exponiertheitsgefühl, wie über einem Abgrund hängend erzeugen.
[‚Alles was schief gehen kann, das geht auch
schief.‘ – ‚Murphy war ein
Optimist!‘ N.N.] drehe
sich nur um Sorgen, Sorgen, Sorgen zusätzlich zu den ‚normalen‘ Bedrohungen /
Risiken um Dinge und Umstände besorgt, die sehr unwahrscheinlich oder nicht existent. „Und die Sorgen um die realen
Probleme nehmen ein Ausmaß an, das Ihre
Kompetenz, etwas gegen sie zu unternehmen, schwächt statt stärkt.“
Im Unterschied zum ‚Klein-Hühnchen-Syndrom‘
gehe es ‚Was-ist-Wenn‘-Persönlichkeiten nicht
darum, dass gerade/zeitnah etwas Schreckliches
passiere, sondern darum, dass es passieren könnte. Solche Fragen /
Problemstellungen die ein Verwundbarkeits- und
Exponiertheitsgefühl, wie über einem Abgrund hängend erzeugen.  [To think in front of the tiger …]
Was-ist-wenn-Denken paralysiere, untergrabe Ihre Fähigkeiten auf Ideen und Lösungen zu kommen, beeinträchtige „die Freude
über glückliche und gelungene Lebensphasen. Die Risiken des Scheiterns erscheinen
viel größer „als die potenziellen Freuden des Erfolges.“
[To think in front of the tiger …]
Was-ist-wenn-Denken paralysiere, untergrabe Ihre Fähigkeiten auf Ideen und Lösungen zu kommen, beeinträchtige „die Freude
über glückliche und gelungene Lebensphasen. Die Risiken des Scheiterns erscheinen
viel größer „als die potenziellen Freuden des Erfolges.“
Murphys Gesetz neu schreiben 184 Einwand: Tatsächlich
passieren ständig schreckliche Dinge. „Wenn sie von Sorgen verzehrt werden,
erscheint das Unwahrscheinliche nur allzu wahrscheinlich.“ Sie
visualisierten geradezu was sich abspielen werde – sehr kreativ(e Eignung
Drehbücher zu schreiben).
Obwohl schlimme Dinge
passieren täten sie dies empirisch nicht so
häufig, wie wir uns Gedanken darüber zu machen vermögen [vgl. den eben
‚hochnotpeinlichen Unterschied zwischen Wahrscheinlichkeit und ‚Schicksal‘, mit ständig hyperreal gemurmeltem
Medien-Rauschen‘;
O.G.J. ‚mathematisch‘ mit Ru.Te.].
Vielleicht weniger
witzig, doch realistischer: »Wenn etwas schiefgehen kann,
tut es das möglicherweise auch – unter bestimmten Umständen, zu bestimmten
Zeiten, bei bestimmten [sic!] Leuten;
aber die meisten dieser Leute werden merken, daß sie mit den
nachfolgenden Problemen durchaus fertig werden können,«
Die fehlerhafte Prämisse 185 auf der anschließend, insofern durchaus
plausibel / folgerichtig, unser ‚Turm der Angst (vor
den Ängsten; O.G.J. etal.)‘ errichtet werde. Es besser zu wissen hindere
uns nämlich nicht unbedingt daran, einen Denkfehler
zu machen. Ein häufig zu verlockendes Versäumnis sei, seine Gedanken losraßen
zu lassen, ohne die Prämisse zu überprüfen / hinterfragen.
Unsere Reaktion hänge (nicht nur/erst bei
nächtlichem Aufschrecken) davon ab, wie
wir das ‚Geräusch‘ (gar überhaupt Ereignisse) interpretieren.
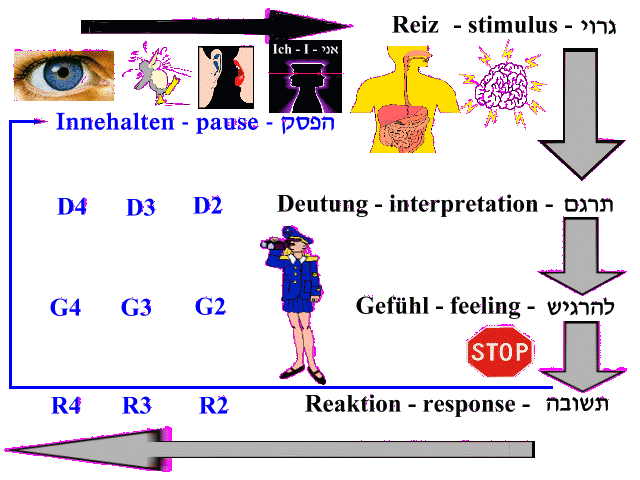 Zwar
müsse die beängstigendste Erklärung nicht die
wahrscheinlichste sein, doch wenn Ihre Gedanken erst einmal damit/daran loß
gerast um diese Was-ist-wenn-Frage zu beantworten, sei bereits das Fundament
gelegt, auf dem unsere Furcht in immer
neue Höhen aufzusteigen vermag. [Gar G’ttesfurcht
überbietend/ersetzend: O.G.J.] Im Ergebnis
sei Ihr Verstand zu sehr mit Katastrophenszenarien beschäftigt, um realistische
Lageeinschätzungen zustande zu bringen.
Zwar
müsse die beängstigendste Erklärung nicht die
wahrscheinlichste sein, doch wenn Ihre Gedanken erst einmal damit/daran loß
gerast um diese Was-ist-wenn-Frage zu beantworten, sei bereits das Fundament
gelegt, auf dem unsere Furcht in immer
neue Höhen aufzusteigen vermag. [Gar G’ttesfurcht
überbietend/ersetzend: O.G.J.] Im Ergebnis
sei Ihr Verstand zu sehr mit Katastrophenszenarien beschäftigt, um realistische
Lageeinschätzungen zustande zu bringen.
Um fehlerhaft
sein/wirken zu können, brauche eine Prämisse keineswegs absurd zu sein, es
genüge ein geringerer Wahrscheinlichkeitsgrad (als ihre Alternative/n ihn
aufwiese/n).
Sich Probleme borgen 187  [Gleich
gar (massenmedial
aufklärerisch-scheinend, erzieherisch bevormundende, bis gemeinwesentlich gemurmelte) allenfalls am Rande (von Sollens-Wert-Vorstellungen, diesseits verbindlicher
Normen bleibend),
bis noch wirksamer solche jenseits, des individuellen
Einflussbereiches, in/auf politischen Feldern; zumal nach den
beliebten/vorbildlich(
avangardistisch)en
‚Motivations(bewegungs)‘-Mustern (vgl. zumindest/durchaus Immanuel Kant): ‚Wenn viele/alle das täten …‘-moralisch( empörend)en ‚schlecht- und/oder entsprechend
überlegen‘-Fühlen(
s/wollen)s; O.G.J. denn ‚ceteris paribus‘
(vorausgesetzt/unterstellend, alles andere
bleibt unveränderlich gleich):
Was ist wenn es nur noch weiter regnet, ausschließlich ‚die Sonne scheint‘, die
Kosten / Verantwortungsträger (bis Menschenheit) genau so weiter …?]
[Gleich
gar (massenmedial
aufklärerisch-scheinend, erzieherisch bevormundende, bis gemeinwesentlich gemurmelte) allenfalls am Rande (von Sollens-Wert-Vorstellungen, diesseits verbindlicher
Normen bleibend),
bis noch wirksamer solche jenseits, des individuellen
Einflussbereiches, in/auf politischen Feldern; zumal nach den
beliebten/vorbildlich(
avangardistisch)en
‚Motivations(bewegungs)‘-Mustern (vgl. zumindest/durchaus Immanuel Kant): ‚Wenn viele/alle das täten …‘-moralisch( empörend)en ‚schlecht- und/oder entsprechend
überlegen‘-Fühlen(
s/wollen)s; O.G.J. denn ‚ceteris paribus‘
(vorausgesetzt/unterstellend, alles andere
bleibt unveränderlich gleich):
Was ist wenn es nur noch weiter regnet, ausschließlich ‚die Sonne scheint‘, die
Kosten / Verantwortungsträger (bis Menschenheit) genau so weiter …?] 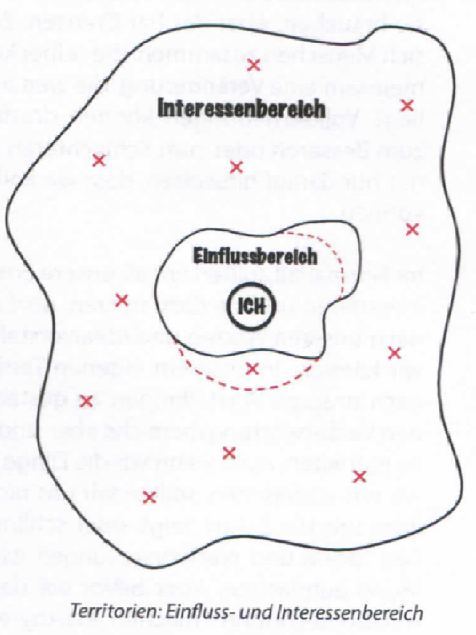
)as positive [sic!] oder realistische Was-ist-wenn-Denken 189 Es könne schließlich manchmal besser sein, auf potenzielle Probleme vorbereitet zu
sein (wogegen Gleichwertigkeits- bis Gleichgewichtsvorstellungen zwischen positivem und
negativem Denken zu kurz, bis daneben greifen; O.G.J. mit V.F.B. et. al.).  ]‚Virtuell‘
visualisierte Realitätenvorstellungen, etwa
in denen jemand Fähigkeiten die er gerade erlernt anwendet, können sehr
hilfreich (bis
geradezu erforderlich) sein/werden (vgl. etwa V.F.B. bis M.v.M.) ersetzen dabei weder das Üben / Mühen, noch
müssen / werden (derartige) ‚Träume‘ / ‚Visionen‘ bis ‚Simulationen‘
deckungsgleich ‚ ‚in Erfüllung gehen‘ / mit den
Realitäten verwechselt / vertauscht werden]
]‚Virtuell‘
visualisierte Realitätenvorstellungen, etwa
in denen jemand Fähigkeiten die er gerade erlernt anwendet, können sehr
hilfreich (bis
geradezu erforderlich) sein/werden (vgl. etwa V.F.B. bis M.v.M.) ersetzen dabei weder das Üben / Mühen, noch
müssen / werden (derartige) ‚Träume‘ / ‚Visionen‘ bis ‚Simulationen‘
deckungsgleich ‚ ‚in Erfüllung gehen‘ / mit den
Realitäten verwechselt / vertauscht werden]
Selektives Sorgenmachen 190 Obwohl/Da stets eine nahezu unendliche Zahl
von Was-ist-wenn-Fällen möglich,
werde bis kann sich niemand über alle davon Sorgen machen. Sorgen seien eine
sehr individuelle Sache. Bei der unausweichlichen Konzentration auf wenige /
ein Risiko werden andere
übersehen.
Die Was-ist-wenn-Frage in Frage stellen 191 Bei solchem Denken genüge es nicht zu wissen,
dass etwas nicht sehr wahrscheinlich. Auch nichts zu ändern berge, hier
gleichwohl seltener gesehene Risiken. Die Frage wäre, ob Ihnen Was-ist-Wenn-Denken
nützt oder schadet? Zumal in Bezug auf wesentlich(er)e Dinge / Ereignisse im/des Lebens.
 Da es
sich um noch nicht eingetretene Ereignisse handele, die zudem kaum jemals
eintreten werden, gelte es die Beweis(kräft)e dieses Denkens in Frage zu
stellen – was ja im Umgang mit allen Denkfehlern
besonders wichtig sei.
Da es
sich um noch nicht eingetretene Ereignisse handele, die zudem kaum jemals
eintreten werden, gelte es die Beweis(kräft)e dieses Denkens in Frage zu
stellen – was ja im Umgang mit allen Denkfehlern
besonders wichtig sei.
[Holzschittartig
vereinfacht mag es die
wesentliche ‚Motivatoren‘ zudem in Mischungsverhältnissen
,geben: Interesse, Freude und Lust/Wohlsein; G.P. keinen davon
riskierend/vernichtend]  In jedem
Szenario lasse sich jederzeit inne halten und fragen, wie wahrscheinlich es ist, ob es
andere Erklärungen / Deutungen gibt? Dies verlangsame den geradezu
automatischen „Prozess, der
Ihre Anspannung ins Unerträgliche steigert, Ängste
aufbaut, Sorgen vermehrt und Sie handlungsunfähig macht.“
In jedem
Szenario lasse sich jederzeit inne halten und fragen, wie wahrscheinlich es ist, ob es
andere Erklärungen / Deutungen gibt? Dies verlangsame den geradezu
automatischen „Prozess, der
Ihre Anspannung ins Unerträgliche steigert, Ängste
aufbaut, Sorgen vermehrt und Sie handlungsunfähig macht.“
Manchen würde das Infragestellen manchmal nicht
genügen, sie würden perfekte Beweise
fordern / vollkommene Sicherheit suchen und damit ihre Lebensfreude riskieren.
Ihre Gedanken ablenken 193 andere (tendenzill gegenteilige)
Was-ist-wenn-Fragen stellen, konkrete Antworten finden, ein spannendes Buch
lesen, körperliche Entspannungsübungen durchmachen, alles was helfe die
eigene Konzentration und Aufmerksamkeit auf etwas anders zu lenken / dabei zu
halten.
Einen Sorgentermin festsetzen 194 sei nicht so schwierig
wie viele meienten, da wir durchaus häufiger ‚keine Zeit für von außen an uns
herangetragenes‘ haben / verwenden, um uns auf eine wichtige Aufgabe zu konzentrieren. – Wichtig nicht
zuzulassen, dass sich die Was-ost-wenn-Sorgen zu anderen Zeitpunkten
breitmachen (wollen).
 [Ups: Rutinen,
bis Rituale, sind/werden zu häufig
unterschätzt, bis verachtet: ‚Das will ich nicht, Das brauche ich nicht. Ich
kann ohne das leben.‘-Mantras können helfen] Zu viele Menschen gingen von der irrigen Annahme aus, das Leben
verlaufe hauptsächlich spontan. Doch obwohl sich
vieles weder vorhersagen noch kontrollieren lasse, gelte dies eben nicht für alles:
„Ein großer Teil des Lebens
ist Routine.“ Ein erheblicher Teil sei
planbar, so entstehen Mahlzeiten nicht ‚von
selbst‘, müssten gekocht / organisiert werden. Diesbezüglich unterschiede sich
die Notwenigkeit / der Bedarf ‚Wäsche zu waschen‘
nicht grundsätzlich von jenem ‚sich sorgen zu machen‘.
[Ups: Rutinen,
bis Rituale, sind/werden zu häufig
unterschätzt, bis verachtet: ‚Das will ich nicht, Das brauche ich nicht. Ich
kann ohne das leben.‘-Mantras können helfen] Zu viele Menschen gingen von der irrigen Annahme aus, das Leben
verlaufe hauptsächlich spontan. Doch obwohl sich
vieles weder vorhersagen noch kontrollieren lasse, gelte dies eben nicht für alles:
„Ein großer Teil des Lebens
ist Routine.“ Ein erheblicher Teil sei
planbar, so entstehen Mahlzeiten nicht ‚von
selbst‘, müssten gekocht / organisiert werden. Diesbezüglich unterschiede sich
die Notwenigkeit / der Bedarf ‚Wäsche zu waschen‘
nicht grundsätzlich von jenem ‚sich sorgen zu machen‘.
[‚Sei spontan‘-Paradoxien
lassen Planungen grüßen] 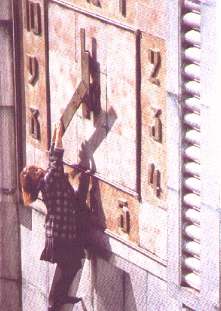 Ohnehin helfe ein Zeitplan eine (bessere) Übersicht zu gewinnen, womit Sie Ihre Zeit verbringen, bis welche davon wofür auch
immer zu finden / tauschen. „Sie werden feststellen, dass Sie in
Ihren festgelegten sorgenfreien Stunden wesentlich mehr zuwege bringen als
bisher.“
Ohnehin helfe ein Zeitplan eine (bessere) Übersicht zu gewinnen, womit Sie Ihre Zeit verbringen, bis welche davon wofür auch
immer zu finden / tauschen. „Sie werden feststellen, dass Sie in
Ihren festgelegten sorgenfreien Stunden wesentlich mehr zuwege bringen als
bisher.“
Weiterbildung und Vergnügen planen 19 Auch, bis gerade, wer sich von Aufgaben und
Sorgen überlastet fühle, tue gut daran, „Zeit für Aktivitäten einzuplanen, die“ helfen das
eigene Leben „besser zu
gestalten oder es einfach
(sic!) mehr zu genießen.“  [Unbestrittene
Lebensrisíken, Technikfolgen etc. lassen sich professionell begrenzend handhaben: Kaum jemand
möchte / sollte es hingegen (außer
vielleicht im Film oder Roman) wagen,
mit einer optimistischen Pilotin, einem leichtsinnigen Arzt etc. die ihre
Sorgfalts-, Bildungs- und/oder etwa Wartungsaufgaben vernachlässigten]
[Unbestrittene
Lebensrisíken, Technikfolgen etc. lassen sich professionell begrenzend handhaben: Kaum jemand
möchte / sollte es hingegen (außer
vielleicht im Film oder Roman) wagen,
mit einer optimistischen Pilotin, einem leichtsinnigen Arzt etc. die ihre
Sorgfalts-, Bildungs- und/oder etwa Wartungsaufgaben vernachlässigten]
[Was – eben ‚Seele aufessende‘ – Schrecken
(zumal
vor den so wichtigen / orientierungsrelevanten Ängsten) angeht, sind Sie Euer Gnaden/wir gar nicht
alleine auf Erdem / unter der Sonne, und eben dies gehört gerade mit zum
Problemsyndrom: Wer jedoch Gegenübermacht,
und wäre/n es (immerhin,
gar überraumzeitliche)
Vorstellungen, respektiert – werde (so verspricht es immer hin die תזרה inklusive/nach apostolischer wie
talmudischer Auslegung) sich nicht von Schrecken überwältigen lassen müssen]
![]() 10. Gebote des
Sollens 197
10. Gebote des
Sollens 197 ![]()
![]()
![]() [Nicht jede ‚moralische Empörung‘ / (ethische) Gesetzestreue disqualifiziert sich / alle ‚guten
bis verantwortbaren Gründe‘ sofort
selbst; doch «allen Leuten ‚recht getan, verbleibt ‚eine Kunst, die niemand kann»; O.G.J.
nicht allein mit J.P.H. auch nicht etwa nur gegen Kant etal, bis eben darüber hinaus, und gleich gar nicht wider תורה
[Nicht jede ‚moralische Empörung‘ / (ethische) Gesetzestreue disqualifiziert sich / alle ‚guten
bis verantwortbaren Gründe‘ sofort
selbst; doch «allen Leuten ‚recht getan, verbleibt ‚eine Kunst, die niemand kann»; O.G.J.
nicht allein mit J.P.H. auch nicht etwa nur gegen Kant etal, bis eben darüber hinaus, und gleich gar nicht wider תורה  Zu den immerhin
Zu den immerhin
grammatikalischen / sprachlichen Pointen gehört zudem / dabei / dagegen: Dass
gerade die angeblichen, biblischen ‚Sollensgebote‘, ,der ‚zehn Worte G'ttes‘ als/in hebräische/n LO-Formeln-לא des Zukunftsversprechens ausgedrückt / eindrücklich – «Du/Ihr
wirst/werdet nicht müssen
/ nicht gezwungen
sein-werden falsch /
kriminell zu handeln!»
– lauten]  Klar
könnte zu recht gefragt / gefürchtet
werden „ob die
Menschheit überlebensfähig, wenn Mord als individuelle Laune betrachtet würde
und Raub und Folter zum alltäglichen Verhaltenskodex gehörten.“
Klar
könnte zu recht gefragt / gefürchtet
werden „ob die
Menschheit überlebensfähig, wenn Mord als individuelle Laune betrachtet würde
und Raub und Folter zum alltäglichen Verhaltenskodex gehörten.“ ![]() Ohnehin handele es sich da gerechterweise / beispielsweise um ‚Mordverbote‘, nicht etwa um
grundsätzlich ausnahmsloses Tötungsverbot, auch um ‚Betrugsbekämpfung‘ (weder
um Verzicht auf jedwede List, noch auf Klugheit /
Lernen: O.G.J.).
Ohnehin handele es sich da gerechterweise / beispielsweise um ‚Mordverbote‘, nicht etwa um
grundsätzlich ausnahmsloses Tötungsverbot, auch um ‚Betrugsbekämpfung‘ (weder
um Verzicht auf jedwede List, noch auf Klugheit /
Lernen: O.G.J.).
Werde das Wortfeld ‚sollen‘ nun aber als Abkürzungsformel für ‚richtig und falsch‘ gebraucht / verstanden, fragen manche, was dagegen einzuwenden sei? Das Problem liege in der Bedeutung die viele der alltäglich geläufigen ‚sollens‘-Formel zuschreiben.
Das Wesen von »sollen« 197 ‚Sollen‘-zu-sagen sei das Einfordern /
Erearten von „handeln ohne zu
denken.“ Jener „erhobene
Zeigerfinger, an dem sie nicht vorbeisehen können.“ Enthalte einen
Befehl in dem die Warnung mitschwinge, ja keinerlei Abweichung zu wagen, oder
‚Du machst dich schuldig!‘ Meist werde ‚sollen‘
benutzt, wenn wir uns auf eine konkrete, perfektionistische
schwarz-weiße
Vorstellung von ‚richtig und falsch‘ bezögen, die keine Graustufen zulasse.
Viele zu scharfe kindische Trennungen bestünden auch noch, gar anerzogen, fort
wenn Menschen abstrakt/er denken können würden. Ein Teil entstamme der Zeit als
wir zu jung waren um die Existenz von so etwas wie Zwischenstufen zu verstehen / verantworten;
den anderen (‚entweder-oder‘-)Teil absorbierten wir, wenn wir die vielen
verschiedenen Lebensregel unserer Familie, unserer sozialen Gruppen, unseres
Landes und der Menschheit bestimmten. Dies werde zu unseren Normen, die keinen
Spielraum. für Abweichungen oder gar Irrtümer, ließen, an welchen wir uns
selbst und andere mäßen.
Sagen (bis ‚dächten /
empgänden‘; O.G.J.) wir ‚sollen‘., „meinen wir gewöhnlich: »Denk nicht
darüber nach, stell keine Fragen – tu es einfach[!], denn es ist richtig. Alles andere
andere ist falsch.«“ 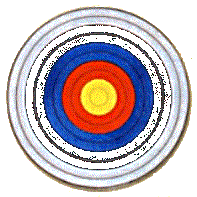 [Jene ‚indoeuropäische Rechthaberei‘, die
manche Leute etwa aus/in Südostasien nie/nicht verstehen;
O.G.J. mit V.F.B., sowie auch
mit M.v.M. weniger, bis nicht etwa
jene, gar ‚schweinehündischen‘
bis kriminellen, Zielverfehlungen
meinend (und gleich gar nicht irgendwie ‚wegerklärend / entschuldigend‘, eher in Gegenteilen),
die ‚wider besseres Wissen(können), fahrlässig bis absichtslos oder geplant zufallend, erfolgten‘, oder wenigstens ‚eigene
Beschlüsse/Vorhaben nicht ausführten/sabotierten‘;
[Jene ‚indoeuropäische Rechthaberei‘, die
manche Leute etwa aus/in Südostasien nie/nicht verstehen;
O.G.J. mit V.F.B., sowie auch
mit M.v.M. weniger, bis nicht etwa
jene, gar ‚schweinehündischen‘
bis kriminellen, Zielverfehlungen
meinend (und gleich gar nicht irgendwie ‚wegerklärend / entschuldigend‘, eher in Gegenteilen),
die ‚wider besseres Wissen(können), fahrlässig bis absichtslos oder geplant zufallend, erfolgten‘, oder wenigstens ‚eigene
Beschlüsse/Vorhaben nicht ausführten/sabotierten‘; vielmehr und allerdings
Zielkonflikte bis Mittel- und Wegstreitigkeiten, einander wechselseitig
ausschließender (einem jedenfalls, zumal quälend, so vorkommenden)
Verhaltensanforderungen (gleich gar sozialer
Rollen-Identitätenselbst-Verständnisse) bis Handlungsoptionen]
vielmehr und allerdings
Zielkonflikte bis Mittel- und Wegstreitigkeiten, einander wechselseitig
ausschließender (einem jedenfalls, zumal quälend, so vorkommenden)
Verhaltensanforderungen (gleich gar sozialer
Rollen-Identitätenselbst-Verständnisse) bis Handlungsoptionen] 
Eine sittenabhängige Liste 199 mithin zwar/eben keine Universalie, denn es gäbe mehr als eine Art und Weise bestimmte Dinge (‚richtig‘ – genauer:
situationsangemessen, gar etwa menschenfreundlich, umweltverträglich pp.:
O.G.J. ohne deswegen/damit Kriminalität zu leugnen / föedern) zu tun, und sogar
 [Aktuell unbestimmte, bis gar
unbestimmte, Urteile über ‚richtig und/oder falsch‘, erhellen / betonen das
jeweilige Bezogenheiten-Firmament höchst selbst – plötzlich befremdet weitaus mehr eigene Fehler bemerken( könnend
bis dürfen)d] bestimmte Dinge/Ereignisse zu bedenken/empfinden (bleibt individuell
variabel, wie kulturell verschieden). Beispielsweise
in den USA ‚erhalte ‚das individuell quietschende Rad das Öl‘, während etwa in
Japan ‚der ungleichförmig herausstehende Nagel‘ sprichwörtlich
gleichmachend ‚eingeschlagen werde‘. „Menschen, die sehr überzeugt von einem
bestimmten Gebot sind und denken, daß dieses von jedem befolgt werden sollte,
bezeichnen wir je nach Zustimmung oder Ablehnung als engagiert oder fanatisch.“
[Aktuell unbestimmte, bis gar
unbestimmte, Urteile über ‚richtig und/oder falsch‘, erhellen / betonen das
jeweilige Bezogenheiten-Firmament höchst selbst – plötzlich befremdet weitaus mehr eigene Fehler bemerken( könnend
bis dürfen)d] bestimmte Dinge/Ereignisse zu bedenken/empfinden (bleibt individuell
variabel, wie kulturell verschieden). Beispielsweise
in den USA ‚erhalte ‚das individuell quietschende Rad das Öl‘, während etwa in
Japan ‚der ungleichförmig herausstehende Nagel‘ sprichwörtlich
gleichmachend ‚eingeschlagen werde‘. „Menschen, die sehr überzeugt von einem
bestimmten Gebot sind und denken, daß dieses von jedem befolgt werden sollte,
bezeichnen wir je nach Zustimmung oder Ablehnung als engagiert oder fanatisch.“
Zudem bleibe ‚Wandel‘ die Kontinentalhauptstadt menschlicher Erlebniswelten.  [Doch lassen sich interkulturell
konsnsfähig, durchaus wenige
Kriminalitätsfelder abgrenzen, sowie manch moralisierende
Globalisierungen ‚bürgerlicher‘ Ideale
beobachten; O.G.J. immer wieder beeindruckt wie viele vermeintlich
individualitätsfreundliche Indo-Europäer ‚moralisch empört‘ sind/werden, dass/wenn sich jemand erlaubt. ‚anderer
Meinung zu sein‘, etwas (nicht
etwa erst/alleine ‚sexuell‘ oder gar ‚ästhetisch‘) Anderes ‚für zulässig‘, bis sogar ‚für
richtig, zu halten‘ als sie/wir]
[Doch lassen sich interkulturell
konsnsfähig, durchaus wenige
Kriminalitätsfelder abgrenzen, sowie manch moralisierende
Globalisierungen ‚bürgerlicher‘ Ideale
beobachten; O.G.J. immer wieder beeindruckt wie viele vermeintlich
individualitätsfreundliche Indo-Europäer ‚moralisch empört‘ sind/werden, dass/wenn sich jemand erlaubt. ‚anderer
Meinung zu sein‘, etwas (nicht
etwa erst/alleine ‚sexuell‘ oder gar ‚ästhetisch‘) Anderes ‚für zulässig‘, bis sogar ‚für
richtig, zu halten‘ als sie/wir] 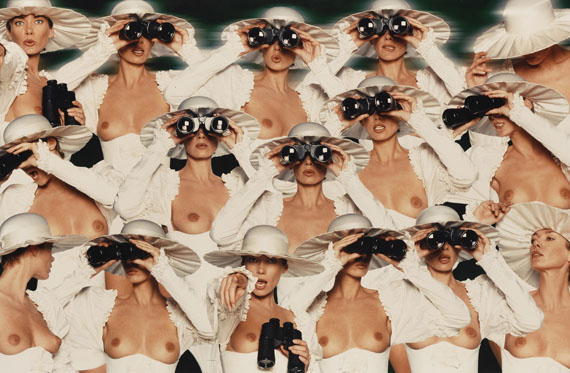
Erleichterung und
moralischer Halt
200 Komplexitätsreduzierungen, Rituale / Gewohnheiten bis ‚Automatismen‘ und
Grundüberzeugungen seien hilfreich; wobei
Unerwartetes, zumal im Straßenverkehr (gleich gar in Gegenden mit anderen ‚Selbstverständlichkeitens‘ als den
antrainiertem) drohe.
Die Störenfriede identifizieren 201 Gebote des Sollens – genauer, die Überzeugung es gäbe nur einen Weg, ohne Alternativen, ohne Wahlmöglichkeiten
– würden zu lästigen Störenfrieden: 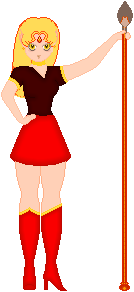

![]() „wenn Sie etwas zu tun versäumen, von dem Sie glauben [sic! ‚überzeugt
sind‘], daß Sie es tun
sollten - und sich am Ende schuldig und wertlos fühlen;
„wenn Sie etwas zu tun versäumen, von dem Sie glauben [sic! ‚überzeugt
sind‘], daß Sie es tun
sollten - und sich am Ende schuldig und wertlos fühlen;
![]() wenn Sie in der Vergangenheit etwas getan
haben (oder versäumt haben zu tun), worüber Sie
jetzt in Reue versinken;
wenn Sie in der Vergangenheit etwas getan
haben (oder versäumt haben zu tun), worüber Sie
jetzt in Reue versinken;
![]() wenn andere etwas
getan haben oder verfehlt haben, etwas zu tun, was sie tun sollten - und
Sie sich dadurch verletzt oder wütend oder beides fühlen;
wenn andere etwas
getan haben oder verfehlt haben, etwas zu tun, was sie tun sollten - und
Sie sich dadurch verletzt oder wütend oder beides fühlen;
![]() wenn Sie pflichtgemäß tun, was Sie Ihrer Meinung nach tun sollten - aber tief im Innern wünschen, es nicht tun zu müssen, und daher sowohl
Groll als auch Schuldgefühle empfinden;
wenn Sie pflichtgemäß tun, was Sie Ihrer Meinung nach tun sollten - aber tief im Innern wünschen, es nicht tun zu müssen, und daher sowohl
Groll als auch Schuldgefühle empfinden; ![]()
![]()
![]() wenn Sie etwas tun möchten, was
Sie nicht tun sollten - und dadurch gleichzeitig von Schuldgefühlen, Angst
und Stress geplagt werden;
wenn Sie etwas tun möchten, was
Sie nicht tun sollten - und dadurch gleichzeitig von Schuldgefühlen, Angst
und Stress geplagt werden; ![]()
![]()
![]() wenn Ihre Überzeugung (Ihr Gebot des Sollens)
mit der eines anderen in Konflikt
gerät,“
wenn Ihre Überzeugung (Ihr Gebot des Sollens)
mit der eines anderen in Konflikt
gerät,“ ![]() [Solches / חית ist durchaus der
Fall! So schlimm]
[Solches / חית ist durchaus der
Fall! So schlimm] ![]()
Ein erster konstruktiver
Schritt zur Identifizierung sei aufschreiben:
![]() Wenn Ihre Gebote des Sollens Sie
drücken
202 Wie
Schuhe müssten Regeln / Gebote eine gewisse Struktur und Festigkeit haben, um
unseren Füßen den nötigen Halt zu geben; geben sie aber überhaupt nicht nach,
oder seien sie zu eng geschnürt, beginnen sie zu drücken und verhindern gar das
Weitergehen, dem sie dienen sollten.
Wenn Ihre Gebote des Sollens Sie
drücken
202 Wie
Schuhe müssten Regeln / Gebote eine gewisse Struktur und Festigkeit haben, um
unseren Füßen den nötigen Halt zu geben; geben sie aber überhaupt nicht nach,
oder seien sie zu eng geschnürt, beginnen sie zu drücken und verhindern gar das
Weitergehen, dem sie dienen sollten.
Das omnipräsente,
hochangesehene Bild vom so schmalen Pfad erweiternd, indem sie es auf eine derart schmale Brücke reduzieren, dass
immer nur ein Fuss vor den anderen gesetzt werden kann – leuchten ups die Folgen dabei zu
enger, unflexsiebler Schuhe gar
deutlicher ein.  [Gerade im Interesse,
auch geführt-werden/folgen-S/Wollender,
bleiben weder über- noch
unterfordernde Wege und Brücken. – Zwänge sind weniger wesentlich als
Passformen]
[Gerade im Interesse,
auch geführt-werden/folgen-S/Wollender,
bleiben weder über- noch
unterfordernde Wege und Brücken. – Zwänge sind weniger wesentlich als
Passformen]
![]() Die Brücke verbreitern 203 stelle weiterhin die
Grundstruktur, bis Zielereichbarkeit, sicher, reduziere allerdings die
Absturzgefahren (mehrt folgkich die ‚zur Ernte
drängenden/Anstehenden‘; O.G.J.) und ermögliche gar Pausen. – Vermittels nachdenken über
Alternativen »Es wäre besser« zu sagen / denken erweise sich als flexibler
gegenüber »sollen«.
Die Brücke verbreitern 203 stelle weiterhin die
Grundstruktur, bis Zielereichbarkeit, sicher, reduziere allerdings die
Absturzgefahren (mehrt folgkich die ‚zur Ernte
drängenden/Anstehenden‘; O.G.J.) und ermögliche gar Pausen. – Vermittels nachdenken über
Alternativen »Es wäre besser« zu sagen / denken erweise sich als flexibler
gegenüber »sollen«.
Jedes ‚Land‘ mache
Ausnahmen sogar vom Tötungsverbot für Soldaten in Kriegszeiten, Gesetze für
Notwehrsituationen etc. Es gäbe also durchaus
Möglichkeiten, die Brücke auf
akzeptable und verantwortbare Weisen
zu verbreitern.
Die Folgen analysieren 205 Zwar haben alle
Handlungen, auch jene ‚Sollensgebote einzuhalten‘, Folgen, doch müssten dies
längst nicht die zunächst / bisher erwarteten sein. Vor- und Nachzeile
bestimmter Konsequenzen überdenkend werde nach der besten (statt nach der
einzig möglich erscheinenden/erlaubten) Lösung gesucht.
Hätte, könnte, sollte 207 Wegen eines vergangenen Vorfalls von Reue
bis Schuld überwältigt zu werden sei eine Hauptfolge solch fehlerhaften
Denkens; doch lasse sich nichts an Vergangenem
ändern [was gerade qualifizierte
Vergebung nicht etwa ausschließt; O.G.J. diese ‚nur‘/immerhin
herrschaftlicher Verfügungsgewalt/en darüber, und\aber
Verwechslungen/Gleichsetzungen mit (gleich gar nachträglicher oder
magisch-wundersamer) Zielerreichung/Zielabschaffung, entziehend], es höchstens
nicht wiederholen. „Ihre
Gedanken darauf zu verschwenden, was“ den anderen „passieren soll, ,“
werde „Ihr
Leben kein bißchen glücklicher
machen.“
Die Vergangenheit hinter sich lassen 208 daraus zu lernen sei eine der besten Möglichkeiten [gar inklusive/durch so mancher Vergebungs- bis gar Versöhnungsbedürfnisse, namentlich sich
selbst und/oder\aber anderen
gegenüber; O.G.J. he-Scöpfungsrealitäten-ה orientiert]
Mit Schuldgefühlen umgehen 209 Sich nur schlecht zu fühlen verändere weder die
Vergangenheit, noch verbessere es die Zukunft.
Wenn unterschiedliche Gebote
des Sollens aufeinanderprallen 210 „Gebote neigen dazu, Verheerung
anzurichten, wenn sie aufeinanderprallen – selbst wenn ihr Inhalt von geringer Bedeutung ist.“ 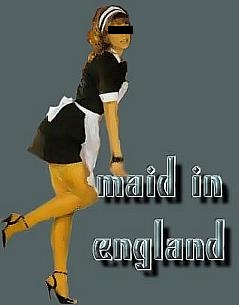 [Immerhin, bis nur. Dolmetschende erleben, wie
einfach/leicht und verheerend wirkmächtig, bereits ein einseitiger, Irrtum / Missgriff der
erwarteten Höflichkeitsformenwahl, erfolgt]
[Immerhin, bis nur. Dolmetschende erleben, wie
einfach/leicht und verheerend wirkmächtig, bereits ein einseitiger, Irrtum / Missgriff der
erwarteten Höflichkeitsformenwahl, erfolgt]
Gebote des Sollens von
anderen akzeptieren 210 sei nicht etwa leicht, zumal wenn diese die eigen kritisieren
(den eigenen ethischen Positionen widersprechen; O.G.J.). Dilemma warum sollten Sie falsches akzeptieren? Es sei
nicht nötig, einer anderen Person recht zu geben, um sich einmal [sic!] nach ihren Wünschen zu richten.
 [Sowohl Wiederholungs- als auch
Wechselseitigkeitsfragen aufwerfend; aber
auch Zulässigkeitsgrenzen des
Repektierens/Tollerierens berührend] Es genüge zu akzeptieren, dass andere andere Gebote hätten
und es manchmal günstiger sei, sich danach zu richten, „als auf einen Streit zu beharren.“
[Sowohl Wiederholungs- als auch
Wechselseitigkeitsfragen aufwerfend; aber
auch Zulässigkeitsgrenzen des
Repektierens/Tollerierens berührend] Es genüge zu akzeptieren, dass andere andere Gebote hätten
und es manchmal günstiger sei, sich danach zu richten, „als auf einen Streit zu beharren.“
 [Zumal, oder immerhin
falls, keines davon (Akzeptanz oder Streit – vielleicht nicht einmal ‚Kampftanz
versus Fruchtbarkeitstanz‘ ohne ohne jede Unterbrechungsoption /
Verpackungsform-Reverenz, wo es eben wechselseitig beziehungsrelational nicht
einmal nur bei ‚Nein‘-Antworten-לא׀אל ankommt) ständig
geschieht; O.G.J. mit M.v.E.-E. vorherrschaftsskeptisch abstandsorientiert: Bleibt
Unterwerfung (zumal dem ‚Direktions-Recht‘ pp.) gar doch mehr/anderes
als etwa ein Zugeständnis an (wenigstebs) einen
‚inneren Schweinehund‘
[Zumal, oder immerhin
falls, keines davon (Akzeptanz oder Streit – vielleicht nicht einmal ‚Kampftanz
versus Fruchtbarkeitstanz‘ ohne ohne jede Unterbrechungsoption /
Verpackungsform-Reverenz, wo es eben wechselseitig beziehungsrelational nicht
einmal nur bei ‚Nein‘-Antworten-לא׀אל ankommt) ständig
geschieht; O.G.J. mit M.v.E.-E. vorherrschaftsskeptisch abstandsorientiert: Bleibt
Unterwerfung (zumal dem ‚Direktions-Recht‘ pp.) gar doch mehr/anderes
als etwa ein Zugeständnis an (wenigstebs) einen
‚inneren Schweinehund‘ ![]() / nicht allein
karnevalistische(r) Korrektive/Komplimente?]
/ nicht allein
karnevalistische(r) Korrektive/Komplimente?] 
Gebote
des Sollens von Kritikern ablehnen 212
Gegebene
/ Vorfindliche Gebote könnten & dürfen
nicht nur variiert, sondern von inneren oder äußeren Kritikern kommende, auch
abgelehnt, der Konflikt ausgehalten / (gar Verfahrensweisem) geregelt, werden. 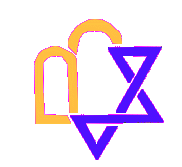 [‚Bei uns
haben die Autoritäten zwar ein Mitspracherecht, aber sie haben kein Vetorecht,
und wir müssen (bis
wollten) uns
entscheiden.‘ Sch.b.Ch.]
[‚Bei uns
haben die Autoritäten zwar ein Mitspracherecht, aber sie haben kein Vetorecht,
und wir müssen (bis
wollten) uns
entscheiden.‘ Sch.b.Ch.]
[Allerdings lassen
sich Denken und Handeln nicht etwa einfach miteinander in
Einklang/Übereinstimmung bringen bzw. halten; Lord
Ralf Gustaf]  »Besseres«
Denken 213 Wesentlich,
sich zu entscheiden, ‚es locker zu nehmen‘ möge trivialer [bis Ideale-schädigender / Prinzipien-feindlicher; O.G.J. mit G.P.] klingen, als es sei. Zumal
zu/wegen Verhaltensnotwendigkeiten vergleiche
auch, bis gar besser, semitisch/moseanisch/israelitisch
»Besseres«
Denken 213 Wesentlich,
sich zu entscheiden, ‚es locker zu nehmen‘ möge trivialer [bis Ideale-schädigender / Prinzipien-feindlicher; O.G.J. mit G.P.] klingen, als es sei. Zumal
zu/wegen Verhaltensnotwendigkeiten vergleiche
auch, bis gar besser, semitisch/moseanisch/israelitisch  [Lückenmanagement – namentlich zur/in farbiger
Handhabung / Wahl des lebendigen Bewegungsraumes-ר־ו־ח weiser, situativ aktuell lokaler Verwendung
des, respektive faktischen Verhaltens bis Handelns,
um die/hinter und von der buchstäblich / ausdrücklich
maximal kontrast-klar schwarz(-rauschend gegebeneInn /tora/-Weisungen-װרה des Denkens] Abb. SHW-Knicks???
[Lückenmanagement – namentlich zur/in farbiger
Handhabung / Wahl des lebendigen Bewegungsraumes-ר־ו־ח weiser, situativ aktuell lokaler Verwendung
des, respektive faktischen Verhaltens bis Handelns,
um die/hinter und von der buchstäblich / ausdrücklich
maximal kontrast-klar schwarz(-rauschend gegebeneInn /tora/-Weisungen-װרה des Denkens] Abb. SHW-Knicks???
E.A.S.‘s
Darstellung von ‚zwar Totalität undװaber
Antitotalitarismus in/aus den Quellen‘ der Juden:
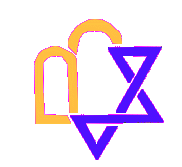 Insofern total, da/soweit alle großen
Lebensbereiche
ordnend und prägend
betreffen,
Insofern total, da/soweit alle großen
Lebensbereiche
ordnend und prägend
betreffen,
doch keiner/nichts totalitär ![]() asketisch vereinnahmend / verzweckend
oder libertinistisch beliebig
preisgebend (nicht
alles essend, was gut schmekt; nicht alles tund, was vielleicht spaß macht,
nicht alles nacherntend/mitnehmend was Gewinn
abwirft pp.).
asketisch vereinnahmend / verzweckend
oder libertinistisch beliebig
preisgebend (nicht
alles essend, was gut schmekt; nicht alles tund, was vielleicht spaß macht,
nicht alles nacherntend/mitnehmend was Gewinn
abwirft pp.). ![]() Am
Ideale-Kompass (statt
‚Maßstab‘; G.P.)
eines nicht-utopischen () Messianismus ausgerichtet;
Am
Ideale-Kompass (statt
‚Maßstab‘; G.P.)
eines nicht-utopischen () Messianismus ausgerichtet;
![]() in kritisch-loyaler Identifizierung mit
den Eigengruppen (bis Bezugsfigurationen)
und/in ihrer Berufung / Besonderheit;
in kritisch-loyaler Identifizierung mit
den Eigengruppen (bis Bezugsfigurationen)
und/in ihrer Berufung / Besonderheit;
![]() ‚rationalistisch
denkend‘ (mit
Martin Buber’s lächelnder Akzeptanz immerhin dieser idealtypischen Kategorisierung, des empirischen Komplements
‚rationalistisch
denkend‘ (mit
Martin Buber’s lächelnder Akzeptanz immerhin dieser idealtypischen Kategorisierung, des empirischen Komplements ![]() des Denkens
und\aber Empfindens) verstanden als weder rein ‚intellektuell-logisch‘ (doch
Intellektuellenfeindschaft erlebnd)
noch/oder ganz ‚spirituell-mystisch‘(doch Versuchungen und
Bezauberungen von/durch Kenntnissen das Über- bis Außerraumzeitlichen handhabend).
des Denkens
und\aber Empfindens) verstanden als weder rein ‚intellektuell-logisch‘ (doch
Intellektuellenfeindschaft erlebnd)
noch/oder ganz ‚spirituell-mystisch‘(doch Versuchungen und
Bezauberungen von/durch Kenntnissen das Über- bis Außerraumzeitlichen handhabend).
 [Die – nur zu gerne zu ‚Geboten‘
erklärten/entschärften –
‚zehn Worte‘ jener ‚Magna carta der Freiheit‘, die den/die Andere/n vor meiner
Willkür schützt (vgl. Daniel Kochmalmik) ließen und lassen sich (inhaltlich gleich
bedeutend) auch in einem, einem
anderen, zwei, drei, fünf, sieben, … elf, zwölf und so weiter Worten/Sätzen,
bis gar 613, fassen/finden]
[Die – nur zu gerne zu ‚Geboten‘
erklärten/entschärften –
‚zehn Worte‘ jener ‚Magna carta der Freiheit‘, die den/die Andere/n vor meiner
Willkür schützt (vgl. Daniel Kochmalmik) ließen und lassen sich (inhaltlich gleich
bedeutend) auch in einem, einem
anderen, zwei, drei, fünf, sieben, … elf, zwölf und so weiter Worten/Sätzen,
bis gar 613, fassen/finden]
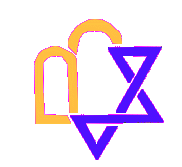
![]() Denn zumindest/gerade die hebräische Bibel / G’tt(es Selbsterschließung)
weist, zumal als Autoritätsquelle,
über sich selbst / den Weisungstext(wortlaut) hinaus, auf ‚irdisch/innerraumzeitlich‘
anwendenden Auslegungsbedarf; durch – verfahrensmäßiger Legitimierung
bedürftige – Autoritäten, deren und
denen Macht, so wie folgt ‚geerdet‘, nicht
Selbst(erhaltungs)zweck / Götze sein/werden
darf
(bis dies[e Determinismusanbetung/Pantheismushuldigung] nicht
kann/braucht):
Denn zumindest/gerade die hebräische Bibel / G’tt(es Selbsterschließung)
weist, zumal als Autoritätsquelle,
über sich selbst / den Weisungstext(wortlaut) hinaus, auf ‚irdisch/innerraumzeitlich‘
anwendenden Auslegungsbedarf; durch – verfahrensmäßiger Legitimierung
bedürftige – Autoritäten, deren und
denen Macht, so wie folgt ‚geerdet‘, nicht
Selbst(erhaltungs)zweck / Götze sein/werden
darf
(bis dies[e Determinismusanbetung/Pantheismushuldigung] nicht
kann/braucht):  [Ob
als, gar inzwischen vorzugsweise ‚naturgesetzlich‘
genannte (Eintritts-)Wahrscheinlichkeiten, oder ‚sitten- bzw. moralgesetzlich‘ bis ‚anreitend‘
respektive ‚sanktionsrechtlich‘ zu erzwingen versuchte, ‚Regelmäßigkeits‘-Erwartungen scheitern ja/zwar nicht
immer: Empirisch spätestens an
Randlosigkeiten, des gelegenheitlichen
Zufallens einerseits, und/oder der Unendlichkeit(enmächtigkeit)en weitererseits]
[Ob
als, gar inzwischen vorzugsweise ‚naturgesetzlich‘
genannte (Eintritts-)Wahrscheinlichkeiten, oder ‚sitten- bzw. moralgesetzlich‘ bis ‚anreitend‘
respektive ‚sanktionsrechtlich‘ zu erzwingen versuchte, ‚Regelmäßigkeits‘-Erwartungen scheitern ja/zwar nicht
immer: Empirisch spätestens an
Randlosigkeiten, des gelegenheitlichen
Zufallens einerseits, und/oder der Unendlichkeit(enmächtigkeit)en weitererseits]
[Längst nicht alle Debatten wurden bereits
geführt/wiederholt, und noch nicht einmal alle davon werden aktuell
hinreichend/umfassend berücksichtigt] 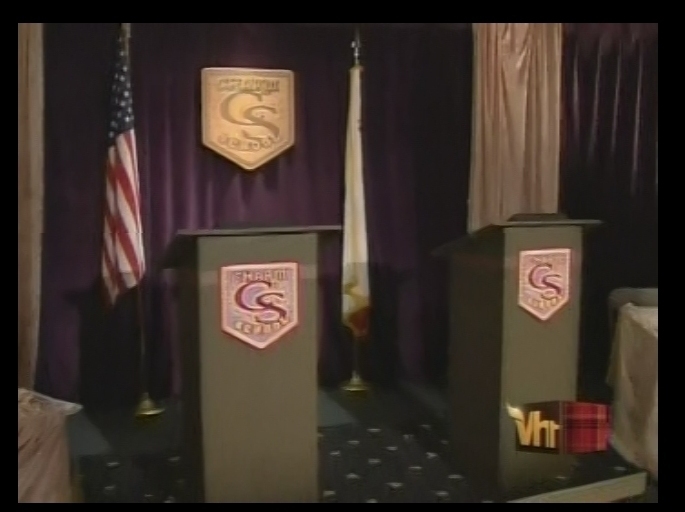 Das
‚normativ‘ debattierend/ups streitend, doch (immer wieder, zumal
mehrheitlich der Mindest-Qualifizierten) zu entscheidende, jeweils (statt ‚inhaltlich-anwendend‘
Das
‚normativ‘ debattierend/ups streitend, doch (immer wieder, zumal
mehrheitlich der Mindest-Qualifizierten) zu entscheidende, jeweils (statt ‚inhaltlich-anwendend‘
unveränderlicher) verbindlicher
/halacha/ הלכה
Gesetz(gebung/Politik,
eben zur Regelung des zeitgenössisch, lokalen Zusammenlebens) bleibt
‚kleiner / begrenzter‘ als, doch eine wichtige Teilmenge, das (jedem resch/ ר)
allumfassend vollständig
scheinenden
 [‚Hellige
Mägde‘ / ‚Töchter (einer,
respektive der übrigen, Stimm/n, bis
Sichtweise/n)‘
knien zum/beim Ein- und Auszug ideal hoch (gar/da vergottet/gemeinwesentlich) erhobener Prinzipien(heilsfiguren Ihres/Eures Denkens/Fühlens: ‚Logik/en‘, ‚Vernunft/en‘,
‚Rationalität/en‘, ‚Glaube,
Liebe, Hoffnung‘, ‚Geborgenheit‘, ‚Segen‘, ‚…‘ pp.)],
[‚Hellige
Mägde‘ / ‚Töchter (einer,
respektive der übrigen, Stimm/n, bis
Sichtweise/n)‘
knien zum/beim Ein- und Auszug ideal hoch (gar/da vergottet/gemeinwesentlich) erhobener Prinzipien(heilsfiguren Ihres/Eures Denkens/Fühlens: ‚Logik/en‘, ‚Vernunft/en‘,
‚Rationalität/en‘, ‚Glaube,
Liebe, Hoffnung‘, ‚Geborgenheit‘, ‚Segen‘, ‚…‘ pp.)],
[Auch alles Narrative, verstanden
inklusive des Normativen davon/darin/daran, bleibt zu wählende Repräsentation –
anderes/‚weniger‘ als Alles überhaupt] teils bereits ‚narrativ‘ bunt, gar
‚h/agadisch, theologisch /
philosophisch‘ im unerschöpflichen Garten-א׀הגדה / unentscheidbaren Gefecht
der Vorstellungsfirmamente
teils bereits ‚narrativ‘ bunt, gar
‚h/agadisch, theologisch /
philosophisch‘ im unerschöpflichen Garten-א׀הגדה / unentscheidbaren Gefecht
der Vorstellungsfirmamente
 [Mehr/Anderes als ‚Burgfriede‘ / ‘agreements
to disagree‘, bis
maximal auf den
noachidischen Grundkonsens (dass Fehler, bis Verbrechen, vorkommen können und\aber
zumindest zu deren Handhabung geeignete Verfahren – Gesetze plus
Gerichtshöfe – erforderlich), sind
nämlich ups nicht möglich / zu erwarten (weder ‚der jeweilige
Stand der Forschung‘ noch ‚Meditation‘, oder gar ‚qualifizierte Kontemplation‘, zwingen zu
irgendetwas): Einander wechselseitig
ausschließende Überzeugungen, bis
antagonistische Sitten, von deren singulärer/einziger / universeller
Allgemeinverbindlichkeit (Notwendigkeit
/ Richtigkeit / Heiligkeit / Gebotenheit etc.) sich andere (jedenfalls/zumindest IndoeuropäerInnen) dauerhaft nicht überzeugen lassen – regelt europäisch/‚westlich‘ erstmals
(1555), bis seit 1648 fortgeschrieben (zumeist ‚säkular‘ genannt), ‚der Augsburger Religionsfriede‘
entsprechend (‚zwei
Reiche/Rechte‘ pp. lehrend/trennend),
prototypisch zwischen
Katholiken und Protestanten]
[Mehr/Anderes als ‚Burgfriede‘ / ‘agreements
to disagree‘, bis
maximal auf den
noachidischen Grundkonsens (dass Fehler, bis Verbrechen, vorkommen können und\aber
zumindest zu deren Handhabung geeignete Verfahren – Gesetze plus
Gerichtshöfe – erforderlich), sind
nämlich ups nicht möglich / zu erwarten (weder ‚der jeweilige
Stand der Forschung‘ noch ‚Meditation‘, oder gar ‚qualifizierte Kontemplation‘, zwingen zu
irgendetwas): Einander wechselseitig
ausschließende Überzeugungen, bis
antagonistische Sitten, von deren singulärer/einziger / universeller
Allgemeinverbindlichkeit (Notwendigkeit
/ Richtigkeit / Heiligkeit / Gebotenheit etc.) sich andere (jedenfalls/zumindest IndoeuropäerInnen) dauerhaft nicht überzeugen lassen – regelt europäisch/‚westlich‘ erstmals
(1555), bis seit 1648 fortgeschrieben (zumeist ‚säkular‘ genannt), ‚der Augsburger Religionsfriede‘
entsprechend (‚zwei
Reiche/Rechte‘ pp. lehrend/trennend),
prototypisch zwischen
Katholiken und Protestanten]
strittig bleibend,  manch(e Mal)e durchaus zu erzählende.
offenlegend (zumal
selbst, als solche) zu
bemerkende, bis zu bekennende, des/der Überzeugtheiten
Gebietes persönliche
Gewissheiten.
manch(e Mal)e durchaus zu erzählende.
offenlegend (zumal
selbst, als solche) zu
bemerkende, bis zu bekennende, des/der Überzeugtheiten
Gebietes persönliche
Gewissheiten.  [Ups (‚Knickse‘ seitens der /halacha/ הלכה selbst; den Menschen, die sich ihrer bedienen wollen, zu
Diensten): Juden müssen weder der
selben Meinung/Überzegungen (schon gar nicht was G’tt, ‚die Bibel‘ תנ״ך bis תורת angeht)
sein/gemacht werden, noch immer all die selben Vorschriften in gleicher Art und
Weise erfüllen/einhalten, oder andere (nicht mal alle anderen Juden) dazu bringen/kontrollieren. – Allerdings
zerfällt und zerviel ‚das (jeweils)
gegenwärtige Judentum‘ (im
Gegensatz zur Befürchtung griechisch-hellenistischer Logik-Auffassung) durch seiner Vielfalten Vielzahlen nicht in beliebig( leer)es
Nichts: Die Einheitskonzeption des waw-װ hat eher den (verbundene
Verschiedenheiten, bis gar Individualitäten sowie Kollektive, erhaltenden) Schrägstrichcharakter, als den (letztlich pantheistischen, im, zum
Selben, bis einzig ausdehnungslosen ‚Kosmos-Universum‘ äh Zirkelpunkt,
auflösenden) Bindestrichcharakter, des
Verbindens]
[Ups (‚Knickse‘ seitens der /halacha/ הלכה selbst; den Menschen, die sich ihrer bedienen wollen, zu
Diensten): Juden müssen weder der
selben Meinung/Überzegungen (schon gar nicht was G’tt, ‚die Bibel‘ תנ״ך bis תורת angeht)
sein/gemacht werden, noch immer all die selben Vorschriften in gleicher Art und
Weise erfüllen/einhalten, oder andere (nicht mal alle anderen Juden) dazu bringen/kontrollieren. – Allerdings
zerfällt und zerviel ‚das (jeweils)
gegenwärtige Judentum‘ (im
Gegensatz zur Befürchtung griechisch-hellenistischer Logik-Auffassung) durch seiner Vielfalten Vielzahlen nicht in beliebig( leer)es
Nichts: Die Einheitskonzeption des waw-װ hat eher den (verbundene
Verschiedenheiten, bis gar Individualitäten sowie Kollektive, erhaltenden) Schrägstrichcharakter, als den (letztlich pantheistischen, im, zum
Selben, bis einzig ausdehnungslosen ‚Kosmos-Universum‘ äh Zirkelpunkt,
auflösenden) Bindestrichcharakter, des
Verbindens]
–
Ohne daher/davon aus dem Gemeinwesen – oder gar vom Jüdin oder Jude sein, schon
gar nicht von G’tt – ausgeschlossen zu
werden, weil jemand anderer/unterlegener Meinung(en) ist/bleibt, gleich gar
wo/solange die Entscheidungen anderer (durch wechselseitig loyalen Widerspruch qualifiziert) respektiert und manche (nämlich gemeinwesentlich relevante hinreichend loyal –
schließlich sogar/gerade indem
auch in rituellen/kultischen Hinsichten unterschiedliche ‚jüdische
Konfessionen‘, in/unter den bereits alten ‚Nationen‘ hinzukommen) akzeptiert werden; mehr noch (bis auf Angelegenheiten
des ihre Identität berührenden ‚Kultes‘)
akzeptieren Juuden(tümmer
– seit dem 19. Jahrhundert auch
ausdrücklich codifiziert) das Recht
des Aufenthaltslandes, als
höherrangig über dem ‚Judenrecht‘ der jeweiligen Halacha.
 [Namentlich das
Überzeugtheiten Gebiet (oder sonst irgend ein Territorium) deswegen für ‚einen rechtsfreien Raum‘ zu halten/erklären, ist entweder
eine veritable Dummheit, oder aber erfolgt strategisch – an (eigener / Bezugsgruppen-)Machtmehrung interessiert – in der (kulturalistisch-heteronomistischen) Absicht ‚seinen
[Namentlich das
Überzeugtheiten Gebiet (oder sonst irgend ein Territorium) deswegen für ‚einen rechtsfreien Raum‘ zu halten/erklären, ist entweder
eine veritable Dummheit, oder aber erfolgt strategisch – an (eigener / Bezugsgruppen-)Machtmehrung interessiert – in der (kulturalistisch-heteronomistischen) Absicht ‚seinen ![]() rechtsverbindlichen
Teilbereich normierend auf etwas anderes, bis auf Alle/s überhaupt,
auszuweiten‘]
rechtsverbindlichen
Teilbereich normierend auf etwas anderes, bis auf Alle/s überhaupt,
auszuweiten‘]
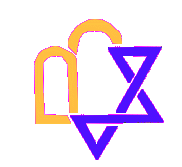 Was, wie E.A.S.
idealtypisierend nach- und vorzeichnet Konsequenzen in vier wesentlichen
Hinsichten hat:
Was, wie E.A.S.
idealtypisierend nach- und vorzeichnet Konsequenzen in vier wesentlichen
Hinsichten hat: ![]() 1.
Anti-totalitärer Charakter zudem konfligieren dürfendder, bis sollender (einander zumindest
wechselseotig kontrollierender, bis korrigierender/begrenzender), Autorität/en plus ihrer
Gelehrten-Alternative (Weiser
Weisheit).
1.
Anti-totalitärer Charakter zudem konfligieren dürfendder, bis sollender (einander zumindest
wechselseotig kontrollierender, bis korrigierender/begrenzender), Autorität/en plus ihrer
Gelehrten-Alternative (Weiser
Weisheit). ![]() 2.
Anti-totalitäre Wege der (zudem
persönlichen, durchaus von Standorten und/oder Zeiten, Lernen etc.
betroffenen/beeinflussbaren)
‚Wahrheit/en‘-Ermittlung; respektive
2.
Anti-totalitäre Wege der (zudem
persönlichen, durchaus von Standorten und/oder Zeiten, Lernen etc.
betroffenen/beeinflussbaren)
‚Wahrheit/en‘-Ermittlung; respektive ![]() 3.
der Entscheidungsfindung und deren Anfechtungsmöglichkeiten (namentlich
Oppositionsrespektierungen).
3.
der Entscheidungsfindung und deren Anfechtungsmöglichkeiten (namentlich
Oppositionsrespektierungen). ![]() 4.
Soweit/Wo dogmatische/axiomatische Grundannahmen erforderlich, seien
diese antitotalitär (תורה /tora/ gar i.w.S., mit offenem
Ende, den /torat/ תורת-‚Theorien/Lehren‘, vorziehend – gar mit דלד /daled/ ‚predigend דרש / למד lernend‘ dem ‚missionarisch belehrenden‘/dalet/ דלת). [Intersubjektiv
konsensfähig, nicht (maximal
interkulturell / uniform / unisexuell / überindividuell) erzwingend – immerhin rocklängenunabhängig (mit, bis ohne, weitere ‚Beinkleider‘-Betrachtung,
gleich gar ‚darunter‘), statt universalistisch, homogen, beobachterunabhängig, singulär,
ewig, rechthaberisch, sybchron …
totalitär]
4.
Soweit/Wo dogmatische/axiomatische Grundannahmen erforderlich, seien
diese antitotalitär (תורה /tora/ gar i.w.S., mit offenem
Ende, den /torat/ תורת-‚Theorien/Lehren‘, vorziehend – gar mit דלד /daled/ ‚predigend דרש / למד lernend‘ dem ‚missionarisch belehrenden‘/dalet/ דלת). [Intersubjektiv
konsensfähig, nicht (maximal
interkulturell / uniform / unisexuell / überindividuell) erzwingend – immerhin rocklängenunabhängig (mit, bis ohne, weitere ‚Beinkleider‘-Betrachtung,
gleich gar ‚darunter‘), statt universalistisch, homogen, beobachterunabhängig, singulär,
ewig, rechthaberisch, sybchron …
totalitär]
![]() 11.
Ja-aber-Sucht 214
11.
Ja-aber-Sucht 214 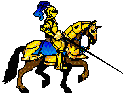 [Bis gar
des Deprimierens Geheimnisverrat;
O.G.J. mit foschungstand / konzeptionell therapeutischem Facheinwand, dass
des/der ‚Depressiven‘ Selbsteinschätzungen, wozu sie im Stande sind und wozu
nicht, realistischer als dies euphorisch gestimmten, bis veranlagten /
‚Verstimmungen‘ fürchtende (eher auf kreative Aufgaben, als sorgfältig
konzenzriert eingestellten) Leuten
zutreffend gelingt]
[Bis gar
des Deprimierens Geheimnisverrat;
O.G.J. mit foschungstand / konzeptionell therapeutischem Facheinwand, dass
des/der ‚Depressiven‘ Selbsteinschätzungen, wozu sie im Stande sind und wozu
nicht, realistischer als dies euphorisch gestimmten, bis veranlagten /
‚Verstimmungen‘ fürchtende (eher auf kreative Aufgaben, als sorgfältig
konzenzriert eingestellten) Leuten
zutreffend gelingt]
Das Küchenmesser 215
Ein schwacher Ersatz für Macht 216
![]() Wenn Sie zu sich selbst Ja-aber sagen
Wenn Sie zu sich selbst Ja-aber sagen
![]() Wenn Sie nicht nein sagen können
Wenn Sie nicht nein sagen können
![]() Andere
Verwendungsformen von Ja-aber
Andere
Verwendungsformen von Ja-aber
![]() Eine
selbstbehindernde Verteidigungsart
Eine
selbstbehindernde Verteidigungsart
Eine Mischung gefährlicher Fehler 220
Sich auf das [sic!] Ja zubewegen 222
Ja-und statt Ja-aber 223
Rollenspiele 225
Gedankenumkehrung 226
Ja zu anderen sagen 226 [gar inklusive der Akzeptanz ungeheuerlicher Anderheiten (zumal an/in sich selbst); O.G.J.]
Nein zu anderen sagen - die Kraft der Selbstbehauptung 227
Mit Ja-aber-Menschen umgehen 228  [Ablegen
selbst Ihres/Eures (zumal ‚Besser‘-Wissens-)Panzers bleibt riskant/entblößend]
[Ablegen
selbst Ihres/Eures (zumal ‚Besser‘-Wissens-)Panzers bleibt riskant/entblößend]
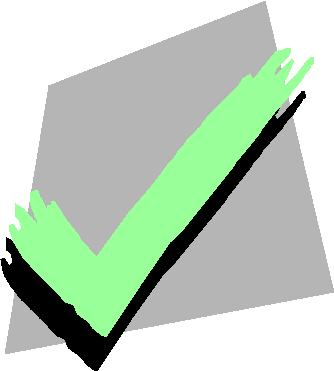 12. Ihren Verstand aktivieren 230
12. Ihren Verstand aktivieren 230
[Essen (Serviertes ‚klares Denken‘ verwenden, bis
davon/es leben) geht
über (qualifiziertes) Verstehen
hinaus]
2. Beweise in Frage stellen
3. Verantwortung zuschreiben
4. Ent-Katastrophisieren (ent-täuschen eher inklusive; O.G.J.)
5. Alternative Gedanken
entwickeln
6. Alternative Gefühle
entwickeln
7 . Alternative Handlungen entwickeln
8 . Vorteile und Nachteile vergleichen (zumal statt: sich und
andere Leute)
9. Ihre Fehler benennen (zumal statt: sich
verurteilen/strafen)
10. Und dann?
11. Übertriebene Übertreibungen
12. Auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten
13. Aus der Not eine Tugend
machen
14. ‚Negativ‘-wirkende Vorstellungen durch ‚positiv‘-empfundene ersetzen
15. ‚Positiv‘-wirkende Vorstellungen üben
16. Selbstinstruktion
17. Sich ablenken
18. Ihre eigene
Verteidigung übernehmen
Bedeutungen
untersuchen
231
Beweise in Frage stellen 233
Verantwortung zuschreiben 235
Ent-Katastrophisieren 237
Alternative Gedanken, Gefühle und Handlungen entwickeln 239
Vorteile und Nachteile vergleichen 240
Ihre Fehler benennen 242
Und dann? 242
Übertriebene Übertreibungen 244
Auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten 244
Aus der Not eine Tugend machen 245
Negativ[ wirkende]e
Phantasien durch positive ersetzen
246
Positiv[ wirkende]e Vorstellungen üben 247
Sich ablenken 249
Ihre Verteidigung übernehmen 251
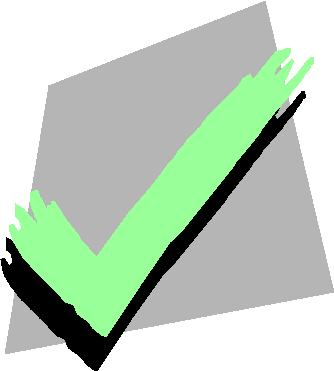 13. Über die
Erkenntnis hinausgehen 252
13. Über die
Erkenntnis hinausgehen 252
Von der Erkenntnis zur Tat 253
[Die verbotene
dreizehnte Türe durchschreiten]
1[9]. Einen Zeitplan anlegen
2[0]. Weiterbildung und Vergnügen planen
[21.] 3. Problemlösungen finden
[22.] 4. Das Ziel [/ Den Weg] in kleinere Schritte unterteilen
[23.] 5. Rollenspiele
[24.] 6. Neue Verhaltensweisen ausprobieren
[25.] 7. Entspannungsübungen
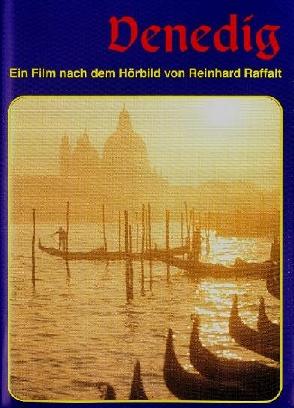 [Professionelle Expertise/n
undװaber eigenes (gar Innen- wie
Außen-)Leben,
bis ‚privater‘ sozialer Zusammenhang
(des ‚Leibes‘), könnten & brauchen weder ‚mehr
desselben‘ sein, noch
(namentlich
gar: ‚‘Verstand und Gefühl. bis Verhalten‘) einander/mir nur (verteilungsparadigmatisch) widerstreitend
werden: M/Ein ‚Glas
des Lebens ist immer vpll‘, doch haben/nehmen wir Menschen bemerk- und begrenzbare Einflüsse darauf womit/wovon]
[Professionelle Expertise/n
undװaber eigenes (gar Innen- wie
Außen-)Leben,
bis ‚privater‘ sozialer Zusammenhang
(des ‚Leibes‘), könnten & brauchen weder ‚mehr
desselben‘ sein, noch
(namentlich
gar: ‚‘Verstand und Gefühl. bis Verhalten‘) einander/mir nur (verteilungsparadigmatisch) widerstreitend
werden: M/Ein ‚Glas
des Lebens ist immer vpll‘, doch haben/nehmen wir Menschen bemerk- und begrenzbare Einflüsse darauf womit/wovon]  Einen Zeitplan anlegen
254
Einen Zeitplan anlegen
254
![]() Rückblickende
Verwendung des Zeitplans
Rückblickende
Verwendung des Zeitplans
![]() Vorausblickende
Verwendung des Zeitplans
Vorausblickende
Verwendung des Zeitplans
![]() Zeitplanung in
Krisenzeiten
Zeitplanung in
Krisenzeiten
![]() Vorbereitungszeit
einplanen
Vorbereitungszeit
einplanen
![]() Zeit für
Geselligkeit einplanen
Zeit für
Geselligkeit einplanen
![]() Selbstkontrolle
Selbstkontrolle
Weiterbildung und Vergnügen planen 260
![]() Vergnügen planen
Vergnügen planen
![]() Selbstvertrauen auf[-/aus]bauen
Selbstvertrauen auf[-/aus]bauen
Problemlösungen finden 263
![]() Aktiv nach Lösungen suchen
Aktiv nach Lösungen suchen
Den [sic!
zumal ‚flexiblen, eigenen‘; O.G.J.] Weg zum Ziel in kleinere Schritte
unterteilen 263
Rollenspiele 264 [haben weder immer / nur mit Trug, noch
mit Täuschung, zu tun; O.G.J.]
Neue Verhaltensweisen ausprobieren 267
![]() Entspannungsübungen 268
Entspannungsübungen 268
![]() Eine
Entspannungsanleitung 269 [vgl.
Venexianisches]
Eine
Entspannungsanleitung 269 [vgl.
Venexianisches]
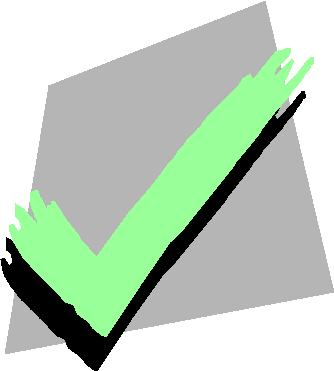 14. Ein besseres Leben 274
14. Ein besseres Leben 274
![]() Eine bessere Idee 274
Eine bessere Idee 274
![]() Handwerkszeug fürs
Leben
275
Handwerkszeug fürs
Leben
275
![]() Die Welt [sic!] ist nicht nur negativ
276
Die Welt [sic!] ist nicht nur negativ
276
![]() Verantwortung für sich selbst übernehmen 276 [Widerspricht
nicht einmal notwendigerweise ‚G-ttvertrauen‘ –
gar eher/allenfalls im Gegenteil (unqualifiziert
vorherrschenden Bedürfnissen); O.G.J.]
Verantwortung für sich selbst übernehmen 276 [Widerspricht
nicht einmal notwendigerweise ‚G-ttvertrauen‘ –
gar eher/allenfalls im Gegenteil (unqualifiziert
vorherrschenden Bedürfnissen); O.G.J.]
[…] Denken Sie daran: Was zählt, ist Ihre Einstellung zum
Leben. Was zählt, ist, was Sie denken. Was zählt, ist, was Sie tun.
Identifikation.
Entwurf.
Einsafz.
»Nimm dich deiner Gedanken
an«, sagte Platon. »Du kannst mit ihnen tun, was du willst.«
Anhang A: Tabelle der Techniken 280
![]() Anhang B: Zeitplan für Ihre täglichen Aktivitäten 282
Anhang B: Zeitplan für Ihre täglichen Aktivitäten 282
Register 285; Arthur Freeman und Rose De Wolf,
verlinkende Hervorhebungen und Illustrationen O.G.J.] ![]()
'Klein-Hühnchen-Problem'-Syndrom ![]() Noch so ein Biepiel heteronomistischer,
sich selbst kontrollierender und erhaltender Schrecknisse vor dem Schrecken, das
Menschen Pazienten sein/werden lassen kann – und
eben gerade auch klugen Leten, die brav um ihre Grenzen und Endlichkeiten, nein: vielmehr um das
was sie dafür halten s/wollen, ‚wissen‘, unterlaufen; vgl. die kurz zusammenfassende Therapieformel ‚vom/fürn Goldfund am Schabbat‘.
Noch so ein Biepiel heteronomistischer,
sich selbst kontrollierender und erhaltender Schrecknisse vor dem Schrecken, das
Menschen Pazienten sein/werden lassen kann – und
eben gerade auch klugen Leten, die brav um ihre Grenzen und Endlichkeiten, nein: vielmehr um das
was sie dafür halten s/wollen, ‚wissen‘, unterlaufen; vgl. die kurz zusammenfassende Therapieformel ‚vom/fürn Goldfund am Schabbat‘.
 [Prof. Dr. Sabine Döhring im ‚Auf ein
Wort‘-Gespräch mit Dr. Michel Friedman] Zumal in
seiner
[Prof. Dr. Sabine Döhring im ‚Auf ein
Wort‘-Gespräch mit Dr. Michel Friedman] Zumal in
seiner ![]() moralphilosophischen
Nachfolge befindliche Denktraditionen haben recht lange gebraucht Immanuel
Kants Ansatz zweiwertig konfrontativer/nullsummenparadigmatischer Dichotomisierungen
moralphilosophischen
Nachfolge befindliche Denktraditionen haben recht lange gebraucht Immanuel
Kants Ansatz zweiwertig konfrontativer/nullsummenparadigmatischer Dichotomisierungen ![]() [Maximal kontrastklar verdeutlichte
Vereinfachung] des Musters: ‚Rationaler (zumal
‚männlicher’ – jedebfalls singulär
intersubjektiv gleicher) Verstand gleich gut‘ versus
‚emotionale Gefühle gleich schlechte Übel‘ zu überwinden. Selbst / Gerade
Anhänger universalistischer, bis
zumindest naturwissenschaftlich basierter, Ansätze, wie etwa Sabine Döhring, verfolgen
inzwischen solche Fährten.
[Maximal kontrastklar verdeutlichte
Vereinfachung] des Musters: ‚Rationaler (zumal
‚männlicher’ – jedebfalls singulär
intersubjektiv gleicher) Verstand gleich gut‘ versus
‚emotionale Gefühle gleich schlechte Übel‘ zu überwinden. Selbst / Gerade
Anhänger universalistischer, bis
zumindest naturwissenschaftlich basierter, Ansätze, wie etwa Sabine Döhring, verfolgen
inzwischen solche Fährten.
[Aber auch wo/falls
(irgendwelche / manche) Gefühle
nicht (allein / nur) aus Denken
entstünden …]  Kernthese/n,
namentlich
Kernthese/n,
namentlich 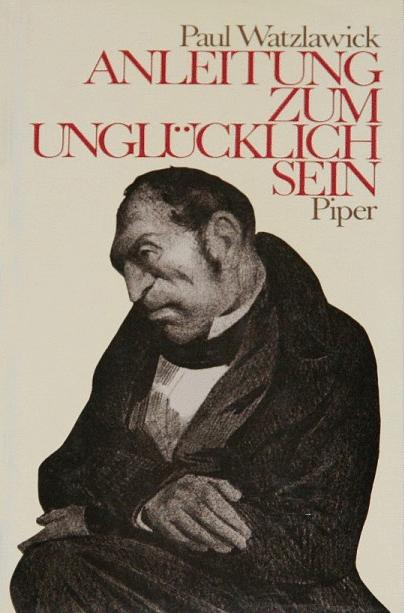 ‚kognitiver
Ansätze‘,
‚kognitiver
Ansätze‘, ![]() die davon ausgehen: dass (Gegebenheiten
deutendes) Denken den Gefühlen
vorausgeht (bis letztere Handlungen zumindest
beeinflussen – bis, dass auch ‚noch so wichtige / richtige, Gründe‘ sogar weder die einzigen, noch je allein
hinreichende ‚Motivationen zum / des Sprung/s der Tat‘,
oder dessen Verhinderungm sind/werden)
die davon ausgehen: dass (Gegebenheiten
deutendes) Denken den Gefühlen
vorausgeht (bis letztere Handlungen zumindest
beeinflussen – bis, dass auch ‚noch so wichtige / richtige, Gründe‘ sogar weder die einzigen, noch je allein
hinreichende ‚Motivationen zum / des Sprung/s der Tat‘,
oder dessen Verhinderungm sind/werden) 
müssen allerdings
[gerade (auch) non-verbale ‚Sprachen‘ sind Deutungen bis Gefühle erzeugende
Semiotika
/ Grammatiken des Denkens]  weder an ‚pre- respektive post-sprachlichen‘ Grenzen (etwa
‚frühkindlich‘ oder ‚gereatrisch‘ pp.)
weder an ‚pre- respektive post-sprachlichen‘ Grenzen (etwa
‚frühkindlich‘ oder ‚gereatrisch‘ pp.) [Wohlerzogen
höchst selbst im Kleide knicksend – genießt es die Herrin, ihr Personal
herumwirbeln zu sehen/lassen] noch nach/bei Ausfällen/Täuschungen
‚logischer‘ Denkfähigkeiten, oder
[Wohlerzogen
höchst selbst im Kleide knicksend – genießt es die Herrin, ihr Personal
herumwirbeln zu sehen/lassen] noch nach/bei Ausfällen/Täuschungen
‚logischer‘ Denkfähigkeiten, oder  mangels semiotischer
Ausdrucksmöglichkeiten
mangels semiotischer
Ausdrucksmöglichkeiten  (ein ‚Mangel
an/in ‚Sprache für etwas/jemanden‘, zumal ‚verbaler‘, belegt/illustriert
zwar ‚grammatische
Denkensvoraussetzungen‘ – verhindert/beendet wider den Umkehrtrugschluss
deswegen Gefühle keineswegs, sondern erschwert, bis verunmöglicht, nur/immerhin mancher Handhabung/en, etwa/gar auf gefühlsmäßige
verweisend/reduzierend), scheitern.
(ein ‚Mangel
an/in ‚Sprache für etwas/jemanden‘, zumal ‚verbaler‘, belegt/illustriert
zwar ‚grammatische
Denkensvoraussetzungen‘ – verhindert/beendet wider den Umkehrtrugschluss
deswegen Gefühle keineswegs, sondern erschwert, bis verunmöglicht, nur/immerhin mancher Handhabung/en, etwa/gar auf gefühlsmäßige
verweisend/reduzierend), scheitern. 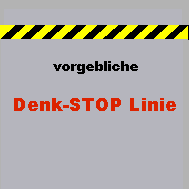
c![]() Schwarzer
Salon – der/mit PSYCHE und gar des THYMOS – beides
Schwarzer
Salon – der/mit PSYCHE und gar des THYMOS – beides ![]() wichtige Begrifflichkeiten des Griechischen, derart prägend in abendländisches
Denken eingegangen, dass sie kaum überhaupt bemerkt, und gleich gar nicht be-
bis hinterfragt werden (dürfen).
wichtige Begrifflichkeiten des Griechischen, derart prägend in abendländisches
Denken eingegangen, dass sie kaum überhaupt bemerkt, und gleich gar nicht be-
bis hinterfragt werden (dürfen).
Alltäglich/es,
immerhin ‚grau(stufig)‘, erweisen sich/wir Menschen
uns schwarz auf Rückseiten weiß
gar nicht so selten. 
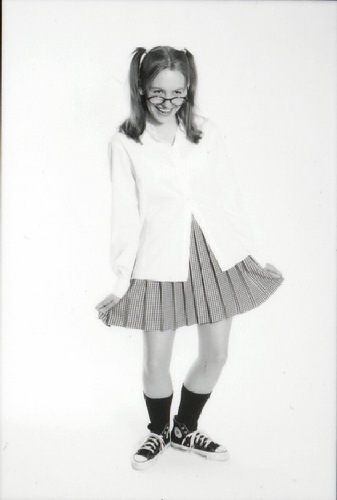 [In schwarz-weißen Schuluniformen (maximal kontrastklar deutlichen, ‚eindeutig‘-scheinenden,
eben streng zweiwertigen entweder-oders, alles/jedes dritte auszuschließend),
noch/wieder ohne? Blazer, und\aber als rein
weiße Debütantinnen – treten hier fürnf tiefere Modalitäten ein]
[In schwarz-weißen Schuluniformen (maximal kontrastklar deutlichen, ‚eindeutig‘-scheinenden,
eben streng zweiwertigen entweder-oders, alles/jedes dritte auszuschließend),
noch/wieder ohne? Blazer, und\aber als rein
weiße Debütantinnen – treten hier fürnf tiefere Modalitäten ein] 
Eine Pointe des, hier als
Analogie und Mnemohilfe herangezogenen, sigmaringer (schließlich wurden gar nicht alle preußischen Beamte ‚mitten‘ im
19. Jahrhundert vor einer Versetzung hier her ‚bewahrt‘) Schlosses
besteht bekanntlich darin/darauf, dass die beiden großen offiziellen
Türen dieses Herrenspielsalons für/vor Frauen verboten/verschlossen waren:
Obwohl, oder eher gerade weil, sie auf dieser bel Étage der ersten Dame des
Hauses (über deren ‚grünes‘
Audienzzimmer direkt mit den Josephiengemähern) verbinden, und auch mit dem ‚roten Salon‘ zum allgemeineren Empfang von
Gästen, teils sogar zum Essen. – Was hingegen die
beiden ‚verborgenen Tapetentüren‘ des zusätzlich ‚rauchgewärzten‘ Raumes (zum/vom Korridor bzw. dieser Wendeltreppe auch zum/vom Küchenbereich verbunden) für
dienstbare Frauen, bis gar ‚konkubinäre‘ …  [Wer. oder zumindest was, locke denn schon ewig? – Jedenfalls in der
abendländischen Geschichte der psychischen
Modalität, die hier im 19.
Jahrhundert, zudem erst, als eine der letzten der
fünfzehn basalen Einzelwissenschaften ausdifferenziert / empirisch wahrgenommen
wurde, hatten sich zudem Ideale
soizistischer Philosophie soweit durchgesetzt,
daass so etwas unvernünftiges, bis (noch) unbeherrschtes, wie Gefühle,
allenfalls/nur … Sie wissen schon]
[Wer. oder zumindest was, locke denn schon ewig? – Jedenfalls in der
abendländischen Geschichte der psychischen
Modalität, die hier im 19.
Jahrhundert, zudem erst, als eine der letzten der
fünfzehn basalen Einzelwissenschaften ausdifferenziert / empirisch wahrgenommen
wurde, hatten sich zudem Ideale
soizistischer Philosophie soweit durchgesetzt,
daass so etwas unvernünftiges, bis (noch) unbeherrschtes, wie Gefühle,
allenfalls/nur … Sie wissen schon]
![]() [Und\Aber was könnten wir in/von diesem schwarzgrauen Spielezimmer mindestens, als Wichtigstes, ל־מ־ד – Eure
Ladyschaft? Ups: ‚weder voll
positiv, noch negativ leer‘-Dualismen zu vergotten/verabsolutieren, gar eher
‚Negation/en‘ zu erlauben/benötigen]
[Und\Aber was könnten wir in/von diesem schwarzgrauen Spielezimmer mindestens, als Wichtigstes, ל־מ־ד – Eure
Ladyschaft? Ups: ‚weder voll
positiv, noch negativ leer‘-Dualismen zu vergotten/verabsolutieren, gar eher
‚Negation/en‘ zu erlauben/benötigen]

S/Eine, bis überhaupt die,
‚Anleitung zum unglücklich sein/werden‘
brachte und bringt #hier![]() Paul
Watzlawick so manche, zumindest unserer, Reverenz/en ein:
Paul
Watzlawick so manche, zumindest unserer, Reverenz/en ein: 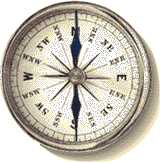 [Ist/Benötigt wenigstens keine gänige
‚denke positiv‘-Spoantanitätsverpflichtungspatadoxie] ‚Kompass‘ undווaber
‚Maßstäbe‘ auseinanderhalten!
[Ist/Benötigt wenigstens keine gänige
‚denke positiv‘-Spoantanitätsverpflichtungspatadoxie] ‚Kompass‘ undווaber
‚Maßstäbe‘ auseinanderhalten!  [Kommt absichtlich nicht einmal ohne – ihre,
zumal verhaltensfaktisch eigenen – Gegenteile / Negierung / Unterlassungen daher]
[Kommt absichtlich nicht einmal ohne – ihre,
zumal verhaltensfaktisch eigenen – Gegenteile / Negierung / Unterlassungen daher]
![]() [Weitaus leichter lesbar geschriebenes,
[Weitaus leichter lesbar geschriebenes,![]() als zu ertragendess Narrativ] Vor allem eins: Dir selbst sei treu … 17
Das Polonius–Zitat. des ‚Kämmerers‘, aus
Sir William‘s Hamlet
als zu ertragendess Narrativ] Vor allem eins: Dir selbst sei treu … 17
Das Polonius–Zitat. des ‚Kämmerers‘, aus
Sir William‘s Hamlet  [‚Schlag nach bei Shakespeare, denn‘ zu viel des (‚Egoismus‘-)Problemsyndroms (dass jeder immer nur an sich,
und/also kaum jemand je an mich, denke) verklärt zum/den Selbst/e vernichtenden Pantheismus] steht hier insbesondere für die neben
den widrigen Umständen und den so leiichtfertigen bis böswilligen anderen, die
dritte wesentliche der gar unerschöpflichen Unglücksquellen: das eigene Denken
respektive Empfinden, insbesondere seiner Selbste.
[‚Schlag nach bei Shakespeare, denn‘ zu viel des (‚Egoismus‘-)Problemsyndroms (dass jeder immer nur an sich,
und/also kaum jemand je an mich, denke) verklärt zum/den Selbst/e vernichtenden Pantheismus] steht hier insbesondere für die neben
den widrigen Umständen und den so leiichtfertigen bis böswilligen anderen, die
dritte wesentliche der gar unerschöpflichen Unglücksquellen: das eigene Denken
respektive Empfinden, insbesondere seiner Selbste. 
 [UndװAber na klar hat der/ein
Satz von/mit der ‚Selbst-Treue‘
–
zumal ‚erfahrungsweltenlich erlebt
–auch
unausweichlich wesentliche/wichtige Konnotationen eben (nicht
[UndװAber na klar hat der/ein
Satz von/mit der ‚Selbst-Treue‘
–
zumal ‚erfahrungsweltenlich erlebt
–auch
unausweichlich wesentliche/wichtige Konnotationen eben (nicht des pantheistischen
Selbstvernichtenden äh Selbstverzichtenden
sondern)
qualifizierten Seins/Werdens bis zum nur rein selbst-orientierten Problemsyndrom dies.er Dummheit] 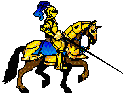
![]() [Gar knapper gefasst, als einiger Aufmerksamkeitsspanne andauert] Vier Spiele mit der
[Gar knapper gefasst, als einiger Aufmerksamkeitsspanne andauert] Vier Spiele mit der 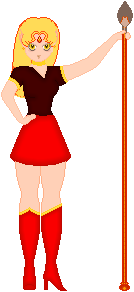 [sic! gar einer der jeglichen; O.G.J. soweit
etwa/sogar Augustinus schätzend] Vergangenheit 21
[sic! gar einer der jeglichen; O.G.J. soweit
etwa/sogar Augustinus schätzend] Vergangenheit 21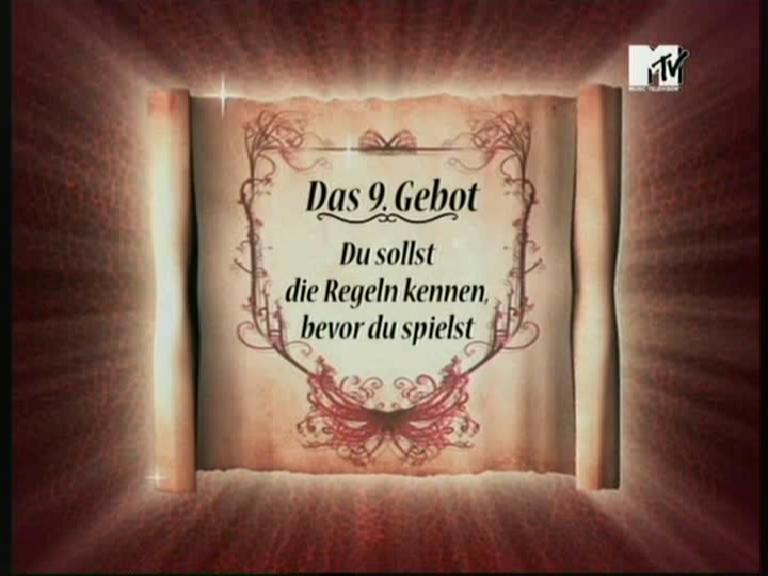 [Lasst nicht nur mit Euch spielen, spielt lieber gültig mit – Euer Gnaden] Es sei Menschen durchaus möglich sich gut gegen Wunden und Schmerzen heilende
Wirkungen vergehender Zeit abzuschirmen.
[Lasst nicht nur mit Euch spielen, spielt lieber gültig mit – Euer Gnaden] Es sei Menschen durchaus möglich sich gut gegen Wunden und Schmerzen heilende
Wirkungen vergehender Zeit abzuschirmen.  [Spätestens (mit) Blaise Pascal wurden beiderlei
Abhalterichtungsoptionen von/aus ‚der‘/unserer
Gegenwart, namens ‚Vergangenheiten‘ sowie ‚Zukunften‘,
entblößt]
[Spätestens (mit) Blaise Pascal wurden beiderlei
Abhalterichtungsoptionen von/aus ‚der‘/unserer
Gegenwart, namens ‚Vergangenheiten‘ sowie ‚Zukunften‘,
entblößt]  Seit Urzeiten
stehen uns/Ihnen
mindestens vier Methoden zur Verfügung, „die Vergangenheit zu
einer Quelle
von
Unglücklichkeit zu machen“:
Seit Urzeiten
stehen uns/Ihnen
mindestens vier Methoden zur Verfügung, „die Vergangenheit zu
einer Quelle
von
Unglücklichkeit zu machen“: ![]() Ihre
Verklärung,
Ihre
Verklärung, ![]() Ablenkung
von der Gegenwart,
Ablenkung
von der Gegenwart, ![]() unendliche Reue
und
unendliche Reue
und ![]() mehr derselben
Schlüsselsuche.
mehr derselben
Schlüsselsuche.
![]() [Kohelet/Dieser Prediger immerhin ein kanonisches Bibelbuch warnt
ausdrücklich vor der Frage ‚Warum war früher alles besser?‘]
[Kohelet/Dieser Prediger immerhin ein kanonisches Bibelbuch warnt
ausdrücklich vor der Frage ‚Warum war früher alles besser?‘]
 1. Die Verherrlichung der Vergangenheit .22 „Nur wem [es
nicht gelingt, seine Vergangenheit ausschließlich durch einen Filter zu sehen,
welcher nur gute Erinnerungen zuläßt], wird die Zeit seiner Pubertät (ganz zu schweigen von
seiner Kindheit) mit handfestem Realismus als Periode der Unsicherheit, des
Weltschmerzes und der Zukunftsangst erinnern,
und auch nicht einem einzigen Tag dieser langen Jahre nachtrauern.
1. Die Verherrlichung der Vergangenheit .22 „Nur wem [es
nicht gelingt, seine Vergangenheit ausschließlich durch einen Filter zu sehen,
welcher nur gute Erinnerungen zuläßt], wird die Zeit seiner Pubertät (ganz zu schweigen von
seiner Kindheit) mit handfestem Realismus als Periode der Unsicherheit, des
Weltschmerzes und der Zukunftsangst erinnern,
und auch nicht einem einzigen Tag dieser langen Jahre nachtrauern. 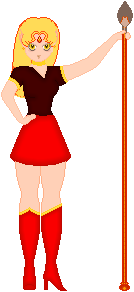 Den begabteren […]
dagegen sollte es wirklich nicht schwer fallen, seine Jugend als das unwiederbringlich verlorene
Goldene Zeitalter zu sehen und sich so ein unerschöpfliches Traueerreservoir z
u erschließen.“ In Beziehungsrelationen, einfach(!) nicht zu akzeptieren, „daß
die Trennung das bei weitem kleinere Übel ist“ eignet sich nicht minder: „bleiben
Sie dahejm in unmittelbarer Nähe des Telephons, um sofort und voll verfügbar zu
sein, wenn die glückhafte Stunde schlägt.“ Es folge schließlich gerne „das Anknüpfen einer in allen Einzelheiten identischen Beziehung zu einem ganz ähnlichen Partner
– wie grundverschieden dieser Mensch anfangs auch scheinen mag.“
Den begabteren […]
dagegen sollte es wirklich nicht schwer fallen, seine Jugend als das unwiederbringlich verlorene
Goldene Zeitalter zu sehen und sich so ein unerschöpfliches Traueerreservoir z
u erschließen.“ In Beziehungsrelationen, einfach(!) nicht zu akzeptieren, „daß
die Trennung das bei weitem kleinere Übel ist“ eignet sich nicht minder: „bleiben
Sie dahejm in unmittelbarer Nähe des Telephons, um sofort und voll verfügbar zu
sein, wenn die glückhafte Stunde schlägt.“ Es folge schließlich gerne „das Anknüpfen einer in allen Einzelheiten identischen Beziehung zu einem ganz ähnlichen Partner
– wie grundverschieden dieser Mensch anfangs auch scheinen mag.“
![]() [Allmählich arten ihre Knickse beinahe zu
einer sportlichen / dienstlichen Anstrengung aus]
[Allmählich arten ihre Knickse beinahe zu
einer sportlichen / dienstlichen Anstrengung aus]  2. Frau Lot 23 „Ein weiterer Vorteil des Festhaltens an der Vergangenheit besteht darin,
daß es einem keine Zeit läßt, sich mit der Gegenwart abzugeben. Täte man das,
so könnte es einem jederzeit passieren, die Blickrichtung rein zufällig um 90
oder gar 180 Grad zu schwenken und feststellen zu müssen, daß die Gegenwart
nicht nur zusätzliche Unglücklichkeit, sondern gelegentlich auch
Un-Unglückliches zu bieten hat. […]
2. Frau Lot 23 „Ein weiterer Vorteil des Festhaltens an der Vergangenheit besteht darin,
daß es einem keine Zeit läßt, sich mit der Gegenwart abzugeben. Täte man das,
so könnte es einem jederzeit passieren, die Blickrichtung rein zufällig um 90
oder gar 180 Grad zu schwenken und feststellen zu müssen, daß die Gegenwart
nicht nur zusätzliche Unglücklichkeit, sondern gelegentlich auch
Un-Unglückliches zu bieten hat. […]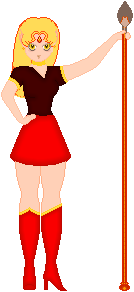 Sie erinnern sich doch? Der Engel sagte zu
Lot und den
Seinen: »Rette dich, es
gilt dein Leben. Schaue nicht hinter dich, bleibe nirgends stehen.« [...] Seine Frau aber schaute zurück und wurde zu einer Salzsäule. [Gen. XIX,
17 u . 26]“
Sie erinnern sich doch? Der Engel sagte zu
Lot und den
Seinen: »Rette dich, es
gilt dein Leben. Schaue nicht hinter dich, bleibe nirgends stehen.« [...] Seine Frau aber schaute zurück und wurde zu einer Salzsäule. [Gen. XIX,
17 u . 26]“
![]() [‚Eins von den achtzehn Bierchen gestern war
wohl schlecht‘]
[‚Eins von den achtzehn Bierchen gestern war
wohl schlecht‘] 3. Das schicksalhafte Glas Bier
24 „[…] Der
warnend erhobene (wenn
auch vor unterdrücktem Lachen leicht zitternde) Zeigefinger
ist nicht zu übersehen: Die Tat ist kurz, die Reue lang. Und wie lang! (Man
denke nur an eine andere biblische Urmutter:
3. Das schicksalhafte Glas Bier
24 „[…] Der
warnend erhobene (wenn
auch vor unterdrücktem Lachen leicht zitternde) Zeigefinger
ist nicht zu übersehen: Die Tat ist kurz, die Reue lang. Und wie lang! (Man
denke nur an eine andere biblische Urmutter:
Eva, und das bißchen Apfel [sic!] ... )” 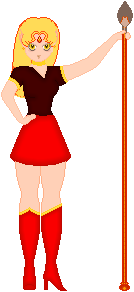
Unabhängig von ‚Reue’ wesentlich, dass das Ereignis „nicht mehr ungeschehen gemacht
werden kann.“
Doch selbst in gar seltenen [zumal als solche kaum bemerkten; O.G.J.] Ausnahmenfällen des Zufallens von unverdientem Glück/Geschick
„verzagt der Könner noch lange nicht. Die Formel, »jetzt ist es zu spät, jetzt
will ich es nicht mehr«, ermöglicht es ihm, unnahbar im Turmzimmer seiner
Indignation zu verbleiben und die von der Vergangenheit geschlagenen Wunden
durch allzu eifriges Lecken am Heilen zu hindern.
[…] 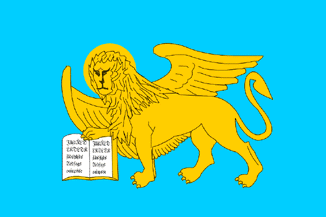 [In
‚wirtschaftlichen Notzeiten‘ leiden Menschen nicht alleine unter Hunger] Unübertroffen als Beispiel für
[die] Variante des Themas [Vergangenes
auch für Guts verantwortlich zu machen und daraus Unglückskapital zu schlagen] ist der in die
Geschichte eingegangene
Ausspruch eines venezianischen
Hafenarbeiters nach Abzug der Habsburger
aus Venetien: »Verflucht seien die Österreicher, die uns
gelehrt haben, dreimal täglich zu essen!«“
[In
‚wirtschaftlichen Notzeiten‘ leiden Menschen nicht alleine unter Hunger] Unübertroffen als Beispiel für
[die] Variante des Themas [Vergangenes
auch für Guts verantwortlich zu machen und daraus Unglückskapital zu schlagen] ist der in die
Geschichte eingegangene
Ausspruch eines venezianischen
Hafenarbeiters nach Abzug der Habsburger
aus Venetien: »Verflucht seien die Österreicher, die uns
gelehrt haben, dreimal täglich zu essen!«“
#hierfoto
 [Wohnungsangebot am Laternenpfahl: Eine
Interessentin klopft nachts daran. Eine Beraterin erstaunt, dass niemand öffnet
…]
[Wohnungsangebot am Laternenpfahl: Eine
Interessentin klopft nachts daran. Eine Beraterin erstaunt, dass niemand öffnet
…]  4. Der verlorene Schlüssel, oder »mehr
desselben« 27 „Unter einer Straßenlaterne steht ein
Betrunkener und sucht und sucht. Ein Polizist kommt daher, fragt ihn, was er verloren
habe, und der Mann antwortet: »Meinen Schlüssel.« Nun
suchen beide. Schließlich will der Polizist wissen, ob der Mann sicher ist, den
Schlüssel gerade hier verloren zu haben, und jener antwortet: »Nein, nicht
hier, sondern dort hinten – aber dort ist es viel zu finster.«
4. Der verlorene Schlüssel, oder »mehr
desselben« 27 „Unter einer Straßenlaterne steht ein
Betrunkener und sucht und sucht. Ein Polizist kommt daher, fragt ihn, was er verloren
habe, und der Mann antwortet: »Meinen Schlüssel.« Nun
suchen beide. Schließlich will der Polizist wissen, ob der Mann sicher ist, den
Schlüssel gerade hier verloren zu haben, und jener antwortet: »Nein, nicht
hier, sondern dort hinten – aber dort ist es viel zu finster.«
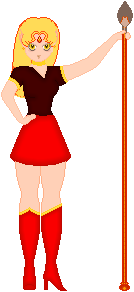 Finden Sie das absurd? Wenn ja, suchen auch Sie am falschen Ort. Der Vorteil ist nämlich, daß eine solche
Suche zu nichts führt, außer mehr desselben, nämlich nichts.
Finden Sie das absurd? Wenn ja, suchen auch Sie am falschen Ort. Der Vorteil ist nämlich, daß eine solche
Suche zu nichts führt, außer mehr desselben, nämlich nichts.
Hinter diesen beiden einfachen Worten, mehr
desselben, verbirgt sich eines der erfolgreichsten
und wirkungsvollsten Katastrophenrezepte […]“
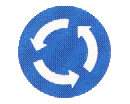 ‚Mehr des Selben‘ – Nicht allein
manche Behörden oder Erzoehungsinstanzen reagieren
auf Regelverstöße (gerne bereits/gerade auch
vorbeugend auf vermeintliche/mögliche, oder wenigstens immerhin/spätestens auf
formelle, also solche der
Höflichkeitsverletzungen), wie etwa das (gar
zunehmende) achtlose Überfahren von Stoppstellen,
‚Mehr des Selben‘ – Nicht allein
manche Behörden oder Erzoehungsinstanzen reagieren
auf Regelverstöße (gerne bereits/gerade auch
vorbeugend auf vermeintliche/mögliche, oder wenigstens immerhin/spätestens auf
formelle, also solche der
Höflichkeitsverletzungen), wie etwa das (gar
zunehmende) achtlose Überfahren von Stoppstellen,  eifrig indem sie noch
mehr Stoppstellen einrichten (schließlich wird sich totalitär äh sachlich auch nicht überall ein ja
durchaus entschleunigender ‚Kreisverkehr‘, oder eine noch teurere wiederum ignorable
Ampelanlage, einrichten lassen).
eifrig indem sie noch
mehr Stoppstellen einrichten (schließlich wird sich totalitär äh sachlich auch nicht überall ein ja
durchaus entschleunigender ‚Kreisverkehr‘, oder eine noch teurere wiederum ignorable
Ampelanlage, einrichten lassen). 
 Ein besonders gängiges, braves Beispiel:
‚Ich werde mit meiner/der
Arbeit nicht fertig. – Also muss ich mehr tun / meine
Kapazitäten erhöhen!‘ – ‚Sie haben ja offensichtlich
keine Ahnung, wie es bei/mit mir zugeht!‘ – ‚Was hülfe
es Ihnen, wenn es uns auch zu viel / zuwider?‘
Ein besonders gängiges, braves Beispiel:
‚Ich werde mit meiner/der
Arbeit nicht fertig. – Also muss ich mehr tun / meine
Kapazitäten erhöhen!‘ – ‚Sie haben ja offensichtlich
keine Ahnung, wie es bei/mit mir zugeht!‘ – ‚Was hülfe
es Ihnen, wenn es uns auch zu viel / zuwider?‘  [Die (gar
optimale – ‚bewährte‘) Lösung von gestern, ist/wird
zu häufig Problemaspekt (spätestens) von
morgen]
[Die (gar
optimale – ‚bewährte‘) Lösung von gestern, ist/wird
zu häufig Problemaspekt (spätestens) von
morgen]
Geradezu mindestens psycho-logischerweise kommt es dazu, dass insbesondere – und zwar auch durchaus angemessene etwa Ressourcen-schonende und sach- bis sogar menschengerechte – ‚Problemlösungen‘, gar Verhaltensoptimierungen, in und aus der Vergangenheit das Problem (und zwar nicht erst von morgen) sind/werden - etwa da sich die Menschen und/oder die Umstände oh Schreck geändert haben pp..
![]() [Stets findet sich die
brave Überzeugung ‚nur/immer‘ noch nicht genug Anstrengungen
unternommen zu haben …] Damit interessiert das Dosierungsgrundproblem,
dass Viel zwar keineswegs viel
schaden äh helfen muss, es aber auch zu wenige
und eher noch schlimmer (also eben
qualitativ) Falsche/s geben kann. -
«Denn schließlich war es doch schon immer ganz
genau wie jedenfalls prinzipiell so» – dass Ihre
Mahestät die Geschichte (und gleich
gar der vollständige Überblick
auch nur über die biographisch ‚eigne‘) wesentlich höherer Modalität da drüben
drunten gewesen sein werden wird.
[Stets findet sich die
brave Überzeugung ‚nur/immer‘ noch nicht genug Anstrengungen
unternommen zu haben …] Damit interessiert das Dosierungsgrundproblem,
dass Viel zwar keineswegs viel
schaden äh helfen muss, es aber auch zu wenige
und eher noch schlimmer (also eben
qualitativ) Falsche/s geben kann. -
«Denn schließlich war es doch schon immer ganz
genau wie jedenfalls prinzipiell so» – dass Ihre
Mahestät die Geschichte (und gleich
gar der vollständige Überblick
auch nur über die biographisch ‚eigne‘) wesentlich höherer Modalität da drüben
drunten gewesen sein werden wird.  [‚Querdenken‘
(gleich gar nicht nur sich dafür haltendes oder
so nennendes) ein, bis das, Rezept mit beschänkter Haftung
gegen/bei ‚mehr Desselben‘]
[‚Querdenken‘
(gleich gar nicht nur sich dafür haltendes oder
so nennendes) ein, bis das, Rezept mit beschänkter Haftung
gegen/bei ‚mehr Desselben‘] 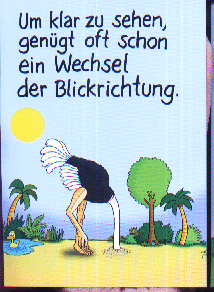
 [Auch hier sind/werden
also mehr als Einzelne betroffen] Lassen Sie sich (von/bei
Ar.Na.) jenen ‚Volksstamm‘ vorstellen, der unbeirrbar gewiss davon
überzeugt bleibt,
[Auch hier sind/werden
also mehr als Einzelne betroffen] Lassen Sie sich (von/bei
Ar.Na.) jenen ‚Volksstamm‘ vorstellen, der unbeirrbar gewiss davon
überzeugt bleibt, 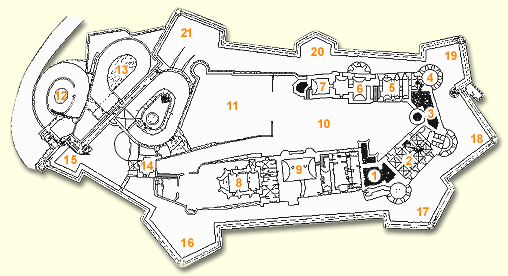 ‚dass die Sonne morgen nicht mehr
aufgehen/scheinen würde; wenn dies nicht durch dessen allabendlichen Ritualtanz zum Sonnenuntergang
bewirkt würde‘?
‚dass die Sonne morgen nicht mehr
aufgehen/scheinen würde; wenn dies nicht durch dessen allabendlichen Ritualtanz zum Sonnenuntergang
bewirkt würde‘?  [Irreparabler-Prämissen-logischerweise / Unter diesem
Vorstellungen-Firmament kann/darf
vernünftigerweise-ups gar kein
Gegenbeweis geführt/riskiert werden! – Gemeinwesentliche
Gesellschaften haben/pflegen viele so felsenfeste Überzeugtheiten]
[Irreparabler-Prämissen-logischerweise / Unter diesem
Vorstellungen-Firmament kann/darf
vernünftigerweise-ups gar kein
Gegenbeweis geführt/riskiert werden! – Gemeinwesentliche
Gesellschaften haben/pflegen viele so felsenfeste Überzeugtheiten]
![]() [Ein Buch das mich/uns zumindest über Jahrzehnte begleitet,
bis das Potenzial, über Generationen
tradiert zu werden, hat] Russen
und Amerikaner 31 Die Anthropologin Margret Meath habe den Unterschied herausgearbeitet: dass
‚Amerikaner Kopfschmerzen vortäuschen, um sich vor einer‘ sozialen / ‚
gesellschaftlichen Verpflichtung zu drücken‘; wogegen ‚Russen dazu tatsächliche
Kopfschmerzen haben’/entwickeln, also ohne
inneren Konflikt (mit ‚Sollensgeboten‘)
auskämmen.
[Ein Buch das mich/uns zumindest über Jahrzehnte begleitet,
bis das Potenzial, über Generationen
tradiert zu werden, hat] Russen
und Amerikaner 31 Die Anthropologin Margret Meath habe den Unterschied herausgearbeitet: dass
‚Amerikaner Kopfschmerzen vortäuschen, um sich vor einer‘ sozialen / ‚
gesellschaftlichen Verpflichtung zu drücken‘; wogegen ‚Russen dazu tatsächliche
Kopfschmerzen haben’/entwickeln, also ohne
inneren Konflikt (mit ‚Sollensgeboten‘)
auskämmen.
 [Anthropo-logisch wäre dem Vortäuschen,
das Haben, von Kopfschmerzen vorzuziehen]
[Anthropo-logisch wäre dem Vortäuschen,
das Haben, von Kopfschmerzen vorzuziehen] 
![]() [Zu
viele vermeinen empört,
‚doch niemals nach ihrem Unglück zu streben‘ – halten vielmehr
Negation/en für die Ursache allen
Übels] Die Geschichte mit dem Hammer 37
[Zu
viele vermeinen empört,
‚doch niemals nach ihrem Unglück zu streben‘ – halten vielmehr
Negation/en für die Ursache allen
Übels] Die Geschichte mit dem Hammer 37  [Reflexartige bis
instinktive Reaktionen sind weder die einzig richtigen, noch die einzig möglichen, ups sogar zivilisatorisch überform-
und änderbar]
[Reflexartige bis
instinktive Reaktionen sind weder die einzig richtigen, noch die einzig möglichen, ups sogar zivilisatorisch überform-
und änderbar]
Ein Mann will
ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat
einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen.
Doch da kommt ihm ein Zweifel: Was,
wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will?
Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig.
Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt, und
er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan; der bildet sich
da etwas ein.
Wenn jemand von mir ein Werkzeug
borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem
Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen?
Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. — Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch bevor er »Guten Tag« sagen kann, schreit ihn unser Mann an: »Behalten Sie sich Ihren Hammer, Sie Rüpel!«
(Paul Watzlawik, 1983 Rücktitel und S. 37 f.)
![]() [Weder ‚negativer Utilitarismus‘ (immerhin
‚das geringst mögliche Unglück für die größt mölgliche Zahl‘ Betroffener) als Zielvorgabe, noch bloße
Karikatur oder Negation, der Glückssucher, bis gar Glücksverheißer] Die Bohnen
in der Hand 47
[Weder ‚negativer Utilitarismus‘ (immerhin
‚das geringst mögliche Unglück für die größt mölgliche Zahl‘ Betroffener) als Zielvorgabe, noch bloße
Karikatur oder Negation, der Glückssucher, bis gar Glücksverheißer] Die Bohnen
in der Hand 47
 [‚Geister‘ bis Ideen (auch/dagegen) los lassen] Aha-Erlebnis:
Das harte Prüfkriterium, zumal für (gar zu gerne, bis noch irreführender, auch anders genannte/verstandene) Inspiration/Intuition:
ob/wie exakte (zumal nummerische Daten
bekannt, die mir unbekannt, unabschätzbar und unvorherberechenbar – ‚die genaue Anzahl der Bohnen
in meiner willkürlich auf einmal damit gefüllten Hand‘ läßt sich weniger leicht
als ‚böse/materealistisch interessiert‘ abweisen als etwa ‚Börsenkurse /
Gewinnzahlen der kommenden Woche‘) Daten / Eindrücke von meine/n Zugang/Wegeen zum /
Kenntnissen aus ‚über- bis
Ausserraumzeitlichem‘ vorhanden sind, oder vermeint (etwa
autosuggestiert bis imaginiert/behauptet) werden? Dies Verfahren stößt allerdings an Grenzen anderer
Personen, die solche Kenntnisansprüche (des/vom Futirum exaktum/s) erheben, welche über ‚meine
eigenen‘ Erwartungen, bis Datenbestände, hinaus- oder daran vorbei gehen. – Was
‚den Aufenthaltsort vermisster/verschollener Peronen‘ angeht, sind am meisten
brauchbar dokumentierte Untersuchungen vorhanden; weitaus mehr Belege
allerdings ‚für Einfühlungs- und/oder Erkundungsvermögen‘ anderer, erfahrerener
bis trikreicher Leute, in/über jemandem/‚mir‘ Bekanntes, bis von
‚mir‘/jemandem Vergessenes, bis
Verdrängtem (sowohl
an ‚beobachteten Sachverhalts-‚ als auch an ‚teilhavenden
Empfindungskenntnissen‘).
[‚Geister‘ bis Ideen (auch/dagegen) los lassen] Aha-Erlebnis:
Das harte Prüfkriterium, zumal für (gar zu gerne, bis noch irreführender, auch anders genannte/verstandene) Inspiration/Intuition:
ob/wie exakte (zumal nummerische Daten
bekannt, die mir unbekannt, unabschätzbar und unvorherberechenbar – ‚die genaue Anzahl der Bohnen
in meiner willkürlich auf einmal damit gefüllten Hand‘ läßt sich weniger leicht
als ‚böse/materealistisch interessiert‘ abweisen als etwa ‚Börsenkurse /
Gewinnzahlen der kommenden Woche‘) Daten / Eindrücke von meine/n Zugang/Wegeen zum /
Kenntnissen aus ‚über- bis
Ausserraumzeitlichem‘ vorhanden sind, oder vermeint (etwa
autosuggestiert bis imaginiert/behauptet) werden? Dies Verfahren stößt allerdings an Grenzen anderer
Personen, die solche Kenntnisansprüche (des/vom Futirum exaktum/s) erheben, welche über ‚meine
eigenen‘ Erwartungen, bis Datenbestände, hinaus- oder daran vorbei gehen. – Was
‚den Aufenthaltsort vermisster/verschollener Peronen‘ angeht, sind am meisten
brauchbar dokumentierte Untersuchungen vorhanden; weitaus mehr Belege
allerdings ‚für Einfühlungs- und/oder Erkundungsvermögen‘ anderer, erfahrerener
bis trikreicher Leute, in/über jemandem/‚mir‘ Bekanntes, bis von
‚mir‘/jemandem Vergessenes, bis
Verdrängtem (sowohl
an ‚beobachteten Sachverhalts-‚ als auch an ‚teilhavenden
Empfindungskenntnissen‘).
 [Falls/Wem
Wirklichkeiten wirklicher (wirkmächtig / konstruktivistisch / …), als immerhin ‚Speicherbewusstheit/en‘
– umso wesentlich
ungeheuerliche Anderheit gegebüber]
[Falls/Wem
Wirklichkeiten wirklicher (wirkmächtig / konstruktivistisch / …), als immerhin ‚Speicherbewusstheit/en‘
– umso wesentlich
ungeheuerliche Anderheit gegebüber]
![]() [Allenfalls eigene Arten
und Weisen entblößend: ‚den Alltag unerträglich und das Triviale enorm zu
machen‘] Die verscheuchten
Elefanten 51
[Allenfalls eigene Arten
und Weisen entblößend: ‚den Alltag unerträglich und das Triviale enorm zu
machen‘] Die verscheuchten
Elefanten 51
Diese kleine Geschichte scheint/wird
schnell erzählt: ein Mann
klatscht immer wieder / alle
zehn Sekunden in die Hände, ohne dass ein Grund dafür ersichtlich ist, und erklärt auf Nachfrage
schließlich, er verscheuche
damit die Elefanten. Der erstaunte Einwand, dass hier doch gar keine Elefanten
seien, bestätigt ihn jedoch nur um so mehr, in seinem ‚Vertreibungserfolg‘ und dessen Notwendigkeit.
Was auf ‚individueller
Ebene‘‘ (gar
zu) gerne auch
als ‚Zwangsstörung‘ bezeichnet, oder belächelt bis behandelt, werden mag,  [Zu leben bleibt lebensgefährlich! – rituale
der Vorsorge / Vermeidung gefallen/gefällig] tritt allerdings (wie oben
etwa Armin Nasier’s ‚Geschichte von dem Volksstamm zeigt, der überzeugt davon
ist, allabendlich einen bestimmten Tanz ausführen zu müssen, ‚dass morgen die
Sonne wieder aufgeht‘ exemplifiziert) auch auf gemeinschaftlich, bis gesellschaftlich
figurierter, ‚Ebene‘ verstärkt, zumal Zusammenhalt-stiftend, auf. – Nicht
zuletzt was die Funktionsweisen von (gleich gar Verschwörungs-)Mythen und sonstige
Auffassungen angeht:
[Zu leben bleibt lebensgefährlich! – rituale
der Vorsorge / Vermeidung gefallen/gefällig] tritt allerdings (wie oben
etwa Armin Nasier’s ‚Geschichte von dem Volksstamm zeigt, der überzeugt davon
ist, allabendlich einen bestimmten Tanz ausführen zu müssen, ‚dass morgen die
Sonne wieder aufgeht‘ exemplifiziert) auch auf gemeinschaftlich, bis gesellschaftlich
figurierter, ‚Ebene‘ verstärkt, zumal Zusammenhalt-stiftend, auf. – Nicht
zuletzt was die Funktionsweisen von (gleich gar Verschwörungs-)Mythen und sonstige
Auffassungen angeht: 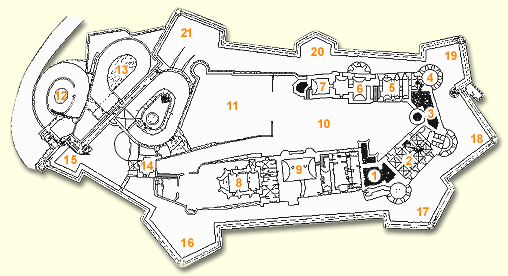 [Rundumliegende Bastionen der
Überzeugtheitenfestung] deren Überzeugte von ihren / durch ihre Gewissheiten so
umfassend abgesichert/vermauert sind/werden, dass gerade und genau das, was
andere für Gegenbeweise halten, als – geradezu notwendigerweise erwartbare,
zumindest entsprechend deutbare – Bestätigung fungiert, dass der/die andere/n
irren bis sogar zu täuschen/verführen beabsichtigen (zumal
falls/daes viel zu gefährlich, einen/den Gegenbeweise der unterstellen
Notwendigkeit anzutrenen: Da, wenn tatsächlich die Sonne nicht mehr scheint,
due Erdachse taumelt, das eis schmiltzt, der Meteroit einschlägt pp. – auch
nichts mehr nachhohlbar/korrigierbar, alles verloren untergeht). Nicht erst/nur apoalyptische
Vorstellungen bis Motivationsversuchungen funktioniern so gegen Argumente plus
gegen Sachverhalte imunisierend; auch bereits der Verdacht bis Vorwurf jemand
gehe so vor verläuft sehr beziehungsrelationenrelevant und geradezu
erschreckend unabhängig von ‚Inhalten‘ wählbar und gewählt.
[Rundumliegende Bastionen der
Überzeugtheitenfestung] deren Überzeugte von ihren / durch ihre Gewissheiten so
umfassend abgesichert/vermauert sind/werden, dass gerade und genau das, was
andere für Gegenbeweise halten, als – geradezu notwendigerweise erwartbare,
zumindest entsprechend deutbare – Bestätigung fungiert, dass der/die andere/n
irren bis sogar zu täuschen/verführen beabsichtigen (zumal
falls/daes viel zu gefährlich, einen/den Gegenbeweise der unterstellen
Notwendigkeit anzutrenen: Da, wenn tatsächlich die Sonne nicht mehr scheint,
due Erdachse taumelt, das eis schmiltzt, der Meteroit einschlägt pp. – auch
nichts mehr nachhohlbar/korrigierbar, alles verloren untergeht). Nicht erst/nur apoalyptische
Vorstellungen bis Motivationsversuchungen funktioniern so gegen Argumente plus
gegen Sachverhalte imunisierend; auch bereits der Verdacht bis Vorwurf jemand
gehe so vor verläuft sehr beziehungsrelationenrelevant und geradezu
erschreckend unabhängig von ‚Inhalten‘ wählbar und gewählt. 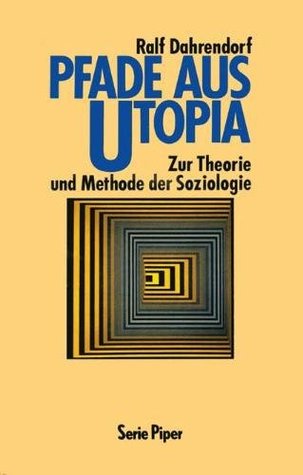 [Bereits
‚Doppelbindungen‘ setzen die (gerade dazu und deswegen so gerne/gut verborgene bis weit
verbreitete)
Fähigkeit/Bereitschaft voraus, ‚eine Hand nicht wissen zu lassen, was die
andere tut‘] Die
[Bereits
‚Doppelbindungen‘ setzen die (gerade dazu und deswegen so gerne/gut verborgene bis weit
verbreitete)
Fähigkeit/Bereitschaft voraus, ‚eine Hand nicht wissen zu lassen, was die
andere tut‘] Die ![]() sozialen
Zugehörigkeits- und Vertrauensfragen der IKS-Hacken
hat P.W. zudem in ‚Wie wirklich ist die Wirklichkeit?‘
insbesondere in einem eigenen Unterkapitel zu ‚Doppelbindungen‘
herausgearbeitet.
sozialen
Zugehörigkeits- und Vertrauensfragen der IKS-Hacken
hat P.W. zudem in ‚Wie wirklich ist die Wirklichkeit?‘
insbesondere in einem eigenen Unterkapitel zu ‚Doppelbindungen‘
herausgearbeitet.
 [Strategie/n der Vermeidung – ‚Ich fürchtet einen Schrecken, und er traf mich‘ (Hiob)] ‚Verunglücklichend‘ geht es P.W. von nun um wesentliche Strategien der
Prpblem-Vermeidung /
Vorbeugung, zur Verewigung
/ Sicherstellung der Vorhandenheit eines/dieses Problems:
[Strategie/n der Vermeidung – ‚Ich fürchtet einen Schrecken, und er traf mich‘ (Hiob)] ‚Verunglücklichend‘ geht es P.W. von nun um wesentliche Strategien der
Prpblem-Vermeidung /
Vorbeugung, zur Verewigung
/ Sicherstellung der Vorhandenheit eines/dieses Problems: 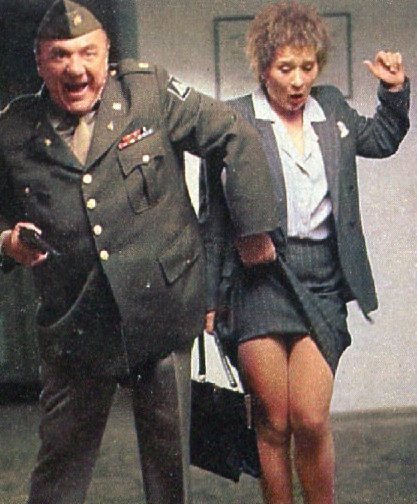 [Warum ‚eine Dame‘ immer
‚Strümpfe‘, äh
brav ‚Hosen‘, als Beinkleider trage? – So manche verwenden, bis
bemerken, gerade/sogar im/am Vorsorgebemühen, namentlich ‚gnostisch‘ jenem des Verunmöglichens bereits unwahrscheinlicher bis
aller Gefahrenmöglichkeiten überhaupt, das existenziell
Vermeidungsstrategische Vernichtungspotenzial (des und von daher/dann
germanisch ausdrücklich/am deutlichsten ‚sündig’ genannten Dasein/s) überhaupt:
[Warum ‚eine Dame‘ immer
‚Strümpfe‘, äh
brav ‚Hosen‘, als Beinkleider trage? – So manche verwenden, bis
bemerken, gerade/sogar im/am Vorsorgebemühen, namentlich ‚gnostisch‘ jenem des Verunmöglichens bereits unwahrscheinlicher bis
aller Gefahrenmöglichkeiten überhaupt, das existenziell
Vermeidungsstrategische Vernichtungspotenzial (des und von daher/dann
germanisch ausdrücklich/am deutlichsten ‚sündig’ genannten Dasein/s) überhaupt:
??INHALTSVERZEICHNISauszugsLISTEhyperlinks??]
„Die Moral
von der Geschichte ist, daß Abvehr oder Vermeidung einer gefürchteten Situation
oder eines Problems einerseits die scheinbar vernünftigste Lösung darstellt,
andererseits aber das
Fortbestehen
des Problems garantiert. Und darin liegt der Wert der Vermeidung für unsere
Zwecke.“ Nicht nur Tiere lernen rasch ein vorheriges
Signal so mit einem folgenden Schmerz oder einer futtergabe zu verbinden, dass
sie Rechtzeitig ausweichen oder Speichel absondern, auch wenn der Schmerz gar
nicht mehr auftreten würde, obwohl sie kein Futter mehr erhalten; sondern sogar
/ gerade Sicherheitseinrichtungen, bis –behörden, sind darauf angewiesen, dass
keine (dazu dann gerbe ‚100%ig‘-genannte) Sicherheit kommt/bleibt. „Und jeder
dieser Akte der Vermeidung verstärkt im Tiere (so dürfen wir wohl annehmen) die
»Überzeugung«, daß es damit die schmerzvolle Gefahr erfolgreich vermieden hat.
Was es
nicht weiß und auf diese Weise auch nie
herausfinden kann, ist, daß die Gefahr schon längst nicht mehr
besteht.“ Anmerkung; „Übrigens, das Gegenteil der Vermeidung ist die
romantische Suche nach der Blauen Blume. Die Vermeidung verewigt das Problem;
der Glaube [sic!] an die (völlig unbewiesene) Existenz der Blauen Blume
verewigt die Suche.“ Was zudem auch den ‚Pawlowschen Hund‘ weiter refelexartig
Speichel bilden lassen mag, obwohl kein Furrwe bach dem Glockensignal mehr … Sie wissen schon selbst.
„Sie sehen, es handelt sich hier nicht um einen
ganz gewöhnlichen [also: notorisch unzuverlässigen] Aberglauben. […] auf die
Wirkung der Vermeidung dagegen kann sich der Unglücksaspirant voll verlassen.
Auch ist
die Anwendung der Technik viel einfacher […]
Im
wesentlichen geht es um ein konsequenter Beharren
auf dem gesunden Menschenverstand, und was könnte vernünftiger
sein?
So kann wohl kein Zweifel
daran bestehen, daß eine große Zahl auch unserer alltäglichsten Handlungen ein
Element der Gefahr in sich tragen. Wieviel Gefahr soll
man in Kauf nehmen?
Vernünftigerweise ein Minimum, oder am besten
gar keine. […]
Aber auch zu Fuß gehen schließt viele Gefahrenmomente
ein, die sich dem forschenden Blick der Vernunft bald enthüllen. Taschendiebe,
Auspuffgase, einstürzende Häuser, Feuergefechte
zwischen Bankräubern und der Polizei,
weißglühende Bruchstücke amerikanischer oder sowjetischer Raumsonden - die Liste
ist endlos, und nur ein Narr wird sich diesen Gefahren b denkenlos aussetzen.  [Gute Gründe sein/mein Heim zu verlassen scheinen überraschend gut verborgen zu sein/werden]
[Gute Gründe sein/mein Heim zu verlassen scheinen überraschend gut verborgen zu sein/werden]
Da bleibt
man besser daheim.
Aber auch dort
ist die Sicherheit nur relativ. […] von
Gas, Heißwasser und Elektrizität ganz zu schweigen. Die einzig vernünftige
Schlußfolgerung scheint darin zu bestehen, morgens
lieber erst gar nicht aufzustehen. Aber welchen
Schutz bietet das Bett schon gegen Erdbeben?
Und was, wenn das dauernde Liegen zum
Wundliegen (Dekubitus) führt?
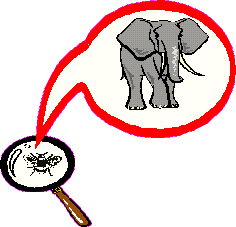 [Alles was Menschen zu sich nehmen / tun hat
potenziell/latent lebensverlängernde oder lebensverkürzende
Wirkung/en. – Eines/Etwas davon heraus zu nehmen, und zu sagen/lehren „das bringt uns um / das rettet uns“ erscheint zu bequem um zu
unterbleiben! – Hyperrealitäten
bleiben ‚motivational‘ beliebt(
äh beliebig überfordernd aktivierbar)e
Tummelplätze bis /tzafun/-‚nördlich‘-verborgene-צפון Stressfaktoren]
[Alles was Menschen zu sich nehmen / tun hat
potenziell/latent lebensverlängernde oder lebensverkürzende
Wirkung/en. – Eines/Etwas davon heraus zu nehmen, und zu sagen/lehren „das bringt uns um / das rettet uns“ erscheint zu bequem um zu
unterbleiben! – Hyperrealitäten
bleiben ‚motivational‘ beliebt(
äh beliebig überfordernd aktivierbar)e
Tummelplätze bis /tzafun/-‚nördlich‘-verborgene-צפון Stressfaktoren]

Doch ich [P:W.] übertreibe. Nur wenigen ganz großen
Könnern gelingt es, so vernünftig zu werden, daß sie alle erdenklichen
Gefahren begreifen und zu vermeiden beginnen - einschließlich Verpestung der
Luft, Verseuchung des Trinkwassers, Cholesterin, Triglyzeride, […]
Wir Minderbegabte müssen uns meist mit
Teilerfolgen bescheiden, die aber durchaus genügen
können. Sie bestehen in der konzentrierten Anwendung
des gesunden Menschenverstandes
auf ein Teilproblem: Mit Messern kann man sich verletzen,
daher soll man sie vermeiden; Türklinken sind tatsächlich mit Bakterien bedeckt
[…] oder ob man das Schloß beim Nachprüfen nicht irrtümlich aufgeschlossen hat? Der Vernünftige vermeidet daher scharfe Messer, öffnet
Türen mit dem Ellbogen, geht nicht ins Konzert [da überraschender Toilettenbedarf
droht] und überzeugt sich fünfmal , daß die Tür wirklich abgesperrt ist. Voraussetzung
ist allerdings, daß man das Problem nicht langsam aus den Augen verliert.”
Denn menschliche Aufmerksamkeitsspannen sind
kurz und Kapazitäten begrenzt. ‚Nachrichten‘ rufen den nächsten Alarm aus.
Eine alte [sic!] alleinstehende
Dame beschwert sich ‚tagtäglich‘ bei der Polizei über kleine Jungs, die nackt
im Fluss bei ihrem Haus, baden; und Polizisten schicken sie immer weiter den
Fluss hinauf [wo wenigstens dieser ‚noch ungefährlicher‘] von den Gebäuden der Siedlung weg, so dass
sie schie0lich bur noch mit dem Fernglas, vom obersten Dachboden aus, zu sehen
sind.
„Man kann sich nun fragen: Was macht die Dame,
wenn die kleinen Jungen nun endgültig außer Sichtweite sind? Vi elleicht begibt
sie sich jetzt auf lange Spaziergänge flußaufwärts, vielleicht genügt ihr die
Sicherheit, daß irgendwo
nackt gebadet wird. Eines scheint sicher; Die
Idsee wurd sie weiterhin
beschäftigen. Und das
Wicbtigste an einer so festgelegten Idee ist,
daß sie ihre eigene Wirklichkeit erschaffen kann.“ (P.W. kueauv im Oefinal; verlinkende und
sonstige Hervorhebungen / Kürzungen O.G.J.) 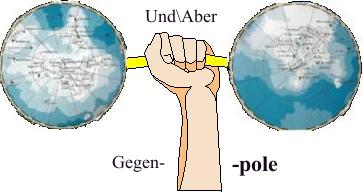 [Zudem erscheinen ‚das Herbeiziehen-‘ und ‚das Vermeiden-S/Wollens‘ zu vielen Leuten, fälschlich als
(einander
dichotom bekämpfende bis ausschließende) Gegensätzlichkeiten]
[Zudem erscheinen ‚das Herbeiziehen-‘ und ‚das Vermeiden-S/Wollens‘ zu vielen Leuten, fälschlich als
(einander
dichotom bekämpfende bis ausschließende) Gegensätzlichkeiten]
![]() [Sogar ‚Deterministen‘
predigen (wegen)/benötigen
zumindest Wahlfreiheit/en –
[Sogar ‚Deterministen‘
predigen (wegen)/benötigen
zumindest Wahlfreiheit/en – ![]() ‚deren
Ausübungen‘ manipulieren s/wollend; vgl.
Günter Rager: ‚Naturalistische
‚deren
Ausübungen‘ manipulieren s/wollend; vgl.
Günter Rager: ‚Naturalistische
Leugnung von Freiheit und radikaler
Freiheitsbegriff: Wie frei
sind wir wirklich?‘] Selbsterfüllende Prophezeiungen [sic? ‚Vorhersagen‘? O.G.J.
Prognosen von dadurch qualifizierter Prophetie unterscheidend,
dass prophetische Ankündigungen Alternativen haben, ihrer Drohungen Eintritt
vermeidlich, ausbleiben, s/wollen] 57
Bereits/Gerade Hiob (gar heftiger noch als immerhin Prototyp des ‚Pechvogels‘ –
be)fürchtete (vgl. drittes Kapitel Vdrs 25 des Bibelbuches) Schrecken, die ihn (dann auch umfänglich) trafen. 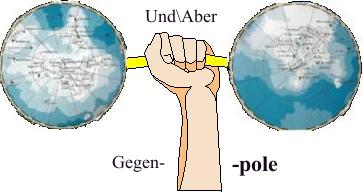 [Zudem erscheinen ‚das Herbeiziehen-‘ und
‚das Vermeiden-S/Wollens‘ zu vielen Leuten, fälschlich als
(einander
dichotom bekämpfende bis ausschließende) Gegensätzlichkeiten]
[Zudem erscheinen ‚das Herbeiziehen-‘ und
‚das Vermeiden-S/Wollens‘ zu vielen Leuten, fälschlich als
(einander
dichotom bekämpfende bis ausschließende) Gegensätzlichkeiten]
Verdächtig/Anfällig – jene
Äusserungen des Verhinderns-S/Wollens, die
fleißig/ständig thematisieren (zumal statt ‚Prinzipien/Werte
zu leben‘) was
sie für beziehungsrelational wichtig halten / (gleich gar einseitig von/m
anderen haben)
wollen: ‚Aber nicht, dass Partner eifern!‘ bleibt ein geradezu klassisches
Beispiel, da es in vielen denkbaren Konstellationen Voraussetzungen
unterstellt, bis zu schaffen beabsichtigt, äh befürchtet, die sich – und zwar,
worauf es ja besonders ankommt, unabhängig von diesen Ereignissen, befangen, äh
aufmerksam, bis vorbeugend, machend – so deuten/verwenden lassen (werden).  [Gar noch schärfere/deutlichere
Zeichendeutung: ‚Wo Rauch sei, da sei auch Feuer‘; doch bemerkte der
Aphoristiker längst, dass ‚auch ein frischer Haufen Misst‘ es zuverlässig …]
[Gar noch schärfere/deutlichere
Zeichendeutung: ‚Wo Rauch sei, da sei auch Feuer‘; doch bemerkte der
Aphoristiker längst, dass ‚auch ein frischer Haufen Misst‘ es zuverlässig …]
![]() [Eine einführende, bis große, ‚Symptombeschreibung von
Doppelbindungen‘ im Stil, bis gar
‚rechtshemisphärisch‘-genannten Gesprächssinn, der
‚Palo-Alto-Gruppe‘ in Kalifornien] Vor Ankommen
wird gewarnt 63
[Eine einführende, bis große, ‚Symptombeschreibung von
Doppelbindungen‘ im Stil, bis gar
‚rechtshemisphärisch‘-genannten Gesprächssinn, der
‚Palo-Alto-Gruppe‘ in Kalifornien] Vor Ankommen
wird gewarnt 63
It is better to travel
hopefully than to arriue, zitiert R. L. Stevenson die Weisheit eines japanischen
Sprichworts. Wörtlich
übersetzt […] etwas sinngemäßer: Im Aufbruch, nicht am Ziele liegt das Glück.“
Präzisierend folgt ![]() George
Bernard Shaw’s „Aphorismus: »Im Leben gibt es zwei Tragödien. Die eine ist
die Nichterfüllung eines Herzenswunsches. Die andere ist seine Erfüllung.« […]
George
Bernard Shaw’s „Aphorismus: »Im Leben gibt es zwei Tragödien. Die eine ist
die Nichterfüllung eines Herzenswunsches. Die andere ist seine Erfüllung.« […]
![]() [Nichtankommens-Spiele
der/mit/gegen Zukunften] Sehr frei nach [
[Nichtankommens-Spiele
der/mit/gegen Zukunften] Sehr frei nach [![]() Alfred] Adler sind die
Regeln dieses Spiels mit der Zukunft ungefähr
folgende: Ankommen – womit buchstäblich
wie metaphorisch das Erreichen eines
Alfred] Adler sind die
Regeln dieses Spiels mit der Zukunft ungefähr
folgende: Ankommen – womit buchstäblich
wie metaphorisch das Erreichen eines
![]() Zieles gemeint ist –
gilt als
Zieles gemeint ist –
gilt als
wichtiger Gradmesser für Erfolg, Macht, Anerkennung und Selbstachtung. Umgekehrt“ sei „Mißerfolg oder gar
tatenloses Dahinleben ein Zeichen von Dummheit,
Faulheit, Verantwortungslosigkeit oder Feigheit. Der
Weg zum Frfolg ist
aber beschwerlich, denn erstens müßte man
sich anstrengen und zweitens kann auch die beste Anstrengung schiefgehen.  [‚Na,
wiedermal gegrillte Ritter gefällig‘ und/oder ‚die Kunst des Scheiterns‘] Statt sich nun banal auf eine »Politik der
kleinen Schritte« auf ein überdies vernünftiges,
erreichbares Ziel hin festzulegen,
empfiehlt es sich, das Ziel bewunderungsvvürdig hoch, zu setzen.
[‚Na,
wiedermal gegrillte Ritter gefällig‘ und/oder ‚die Kunst des Scheiterns‘] Statt sich nun banal auf eine »Politik der
kleinen Schritte« auf ein überdies vernünftiges,
erreichbares Ziel hin festzulegen,
empfiehlt es sich, das Ziel bewunderungsvvürdig hoch, zu setzen.
Meinen Lesern sollten die Vorteile
offensichtlich sein. Das faustische Streben, die Suche nach der Blauen Blume,
der asketische Verzicht auf
die niedrigeren Befriedigungen des Lebens stehen gesellschaftlich hoch im
Kurs und lassen Mutterherzen noch höher schlagen. Und vorallem: Wenn
das Ziel in weiter Ferne liegt, begrejft
auch der
Dümmste, daß der Weg
dorthin lang und beschwerlich und die Reisevorbereitungen umfassend und
zeitraubend sind. Da soll einen nur jemand dafür tadeln, noch nicht
einmal aufgebrochen zu sein – und noch weniger droht einem Kritik, wenn man,
einmal unterwegs, vom Wege abkommt und im Kreis marschiert oder längere
Marschpausen einlegt. Im Gegenteil für das Verirren im Labyrinth und das
Scheitern an übermenschlichen Aufgaben gibt es heroische Vorbilder, in deren Licht man dann
selbst etwas mitglänzt.
Doch das ist keineswegs alles. Mit dem Ankommen
auch am hehrsten Ziel ist eine weitere Gefahr
verwiesen […] nämlich der
Katzenjammer. Und um diese Gefahr weiß der
Unglücksexperte; ob bewußt
oder unbewusst spielt dabei keine Rolle. Das noch unerreichte Ziel ist – so scheint es der Schöpfer unserer Welt zu wollen – begehrenswerter,
romantischer, verklärter als es das erreichte je sein kann. Machen
wir uns doch nichts vor: Die Flitterwochen
hören
vorzeitig zu flittern auf; bei Ankunft in der
fernen
exotischen Stadt
versucht uns der Taxichauffeur
übers Ohr zu hauen; die erfolgreiche Ablegung
der entscheidenden Prüfung bewirkt wenig mehr
als das Hereinbrechen zusätzlicher,
unerwarteter
Komplikationen und Verantwortungen; und mit
der Serenität
des Lebensabends nach der Pensionierung ist es bekanntlich auch nicht so
weit her.
Quatsch, werden die Heißblütigeren unter uns
sagen, wer sich mit so milden, anämischen
Idealen abgibt, verdient es, am Ende enttäuscht dazustehen. Aber gibt es vielleicht
nicht den leidenschaftlichen Affekt, der in seiner Entladung sich selbst
übersteigert? Oder den heiligen Zorn, der
zum berauschen den Akt der Rache und Vergeltung
für Unrecht führt, und der die Gerechtigkeit der Welt wieder ins Lot bringt?
Wer könnte da noch vom »Katzenjammer« des Ankommens
sprechen?
Leider, leider — auch damit scheinen die
wenigsten anzukomme.
[…]
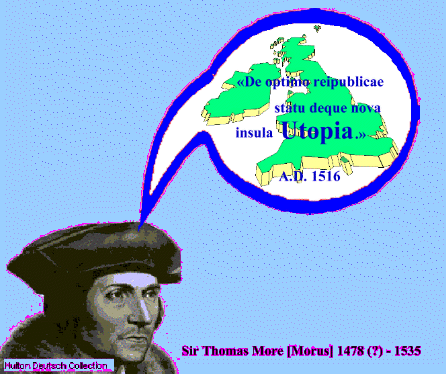 Doch zurück zum eigentlichen Thema. Wenn also
nicht einmal Rache süß ist, wie viel weniger dann
Doch zurück zum eigentlichen Thema. Wenn also
nicht einmal Rache süß ist, wie viel weniger dann
noch das Ankommen am vermeintlich
glücklichen Ziel? Deshalb: Vor Ankommen wird gewarnt. (Und,
nebenbei bemerkt, warum glauben [sic!] Sie wohl, nannte T|]pmas Morus
seine ferpe Insel der Glücklichkeit Utopia, das heißt »Nirgendwo«?)
![]() [‚Schlag nach bei Shakespeare, denn durch Kenntnis der Dramen, fällst Du
bei den Damen, total aus dem Rahmen‘]
Wenn du mich wirklich liebtest, würdest du gern Knoblauch essen 71
[‚Schlag nach bei Shakespeare, denn durch Kenntnis der Dramen, fällst Du
bei den Damen, total aus dem Rahmen‘]
Wenn du mich wirklich liebtest, würdest du gern Knoblauch essen 71
![]() [Knickst/Geht eine
Schlossbegleiterin etwa vor Ihnen/Euch oder gar zuvor/bevor?] ‚Doppelbindungen‘
bis hinauf äh hinüber zum IKS-Hacken-Syndrom,
nicht nur des Heteronomismus sondern gerade auch der Selbstverpflichtungen.
[Knickst/Geht eine
Schlossbegleiterin etwa vor Ihnen/Euch oder gar zuvor/bevor?] ‚Doppelbindungen‘
bis hinauf äh hinüber zum IKS-Hacken-Syndrom,
nicht nur des Heteronomismus sondern gerade auch der Selbstverpflichtungen.  [Doppelbindungsvollendung]
[Doppelbindungsvollendung] 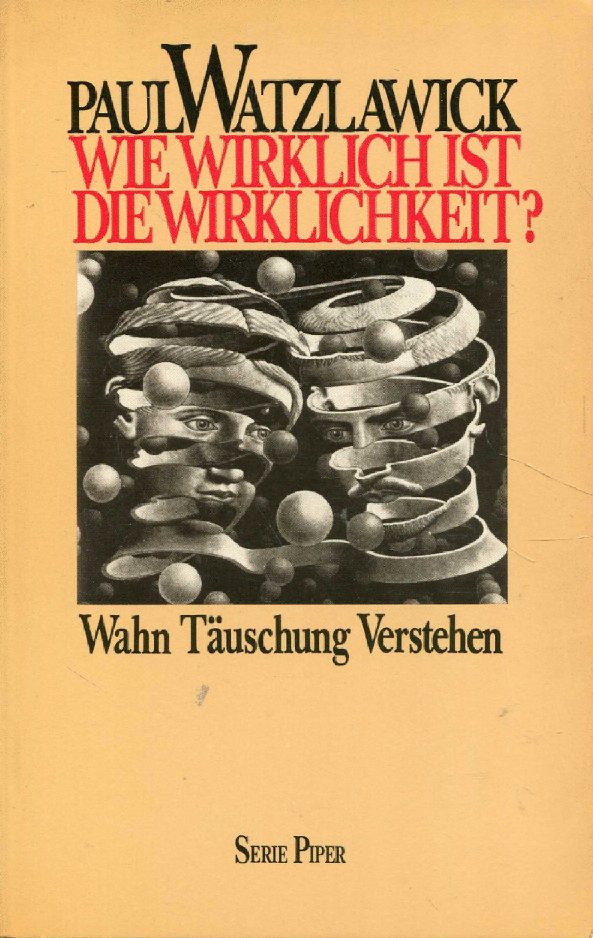
![]() [Konsumenten und/oder Patienten sind und werden weitaus
gerner gesehen, als etwa zufriedene Leute (gleich gar sich selbst so organiert
habende, dass sie nichts zu klagen haben)] »Sei spontan!« 87 „Von all den Knoten, Dilemmata und Fallen, die
sich in die Struktur menschlicher Kommunikation einbauen lassen, ist die
sogenannte »Sei spontan!«-Paradoxie sicherlich die
weitest verbreitete. […] Vom rein logischen standpunkt kann man nicht das eine
wie das andere gleichzeitig tun. […] Papier und Schallwellen sind geduldig. Der
Empfänger der Nachricht vermutlich weniger. Denn was kann er jetzt tun? “
[Konsumenten und/oder Patienten sind und werden weitaus
gerner gesehen, als etwa zufriedene Leute (gleich gar sich selbst so organiert
habende, dass sie nichts zu klagen haben)] »Sei spontan!« 87 „Von all den Knoten, Dilemmata und Fallen, die
sich in die Struktur menschlicher Kommunikation einbauen lassen, ist die
sogenannte »Sei spontan!«-Paradoxie sicherlich die
weitest verbreitete. […] Vom rein logischen standpunkt kann man nicht das eine
wie das andere gleichzeitig tun. […] Papier und Schallwellen sind geduldig. Der
Empfänger der Nachricht vermutlich weniger. Denn was kann er jetzt tun? “
Prompt folgt dem Mann der durch Zwangsmaßnahmen
verunmöglicht, was er damit zu erreichen hofft,
„das abgedroschene Paradebeispiel der Mutter, die [gar überzeugt was
gerne gesche falle leichter und/oder es läßz bereits nachstehendes elterliches
Selbstverständnis grpßen; O.G.J. durchaus kontemplationskritisch ambivalent
beidem entsprechend ‚vorgeschädigt‘] von ihrem Söhnchen verlangt, daß er
seine Hausaufgaben mache – aber nicht bloß überhaupt, sondern gerne.
Wic dcr Lcscr sieht, handelt es sich hier um
die Umkehrung der schon erwähnten Definition des Puritanismus. Dort hieß es: Es
ist deine Pflicht, keinen Spaß zu haben; hier dagegen: Deine Pflicht muß dir
Spaß machen.“ [Vgl. zudem Heinerich Heine über Immanuel Kant] 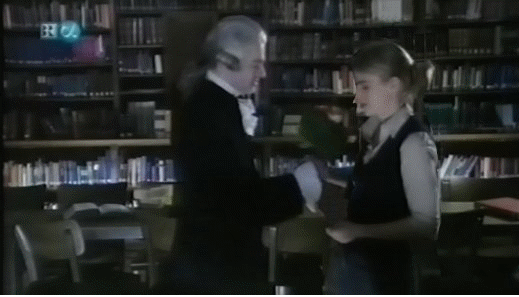
Folglich nehme man an, dass
entweder mit einem selbst oder der Umwelt etwas nicht stimme; und da man
diesbezüglich meist „den Kürzeren“ ziehe
werde man so praktisch gezwungen „die Schuld in sich selbst zu suchen.
[…] Nicht wenige Eltern bringen es darin
[anzunehmen, daß ein sonniges Gemüt des Kindes der offensichtlichste Beweis
elterlichen Erfolges ist] zu
meisterhaften Weiterentwicklungen, indem sie dem Kinde zum Beispiel sagen: »Geh
auf dein Zimmer und komme mir nicht herunter bis du wieder guter Laune bist.« Damit ist in überaus eleganter, da indirekter Weise klar
ausgedrückt, daß das Kind [nicht etwa erst Erwachsene; O.G.J. durchaus mit G.P. und M.v.M. bis V.F.B. und nicht
etwa gegen ups ‚Stimmungsmanagement‘]
es mit etwas gutem Willen und einer kleinen
Anstrengung fertig bringen könnte, seine Gefühle [spontan]
von schlecht auf gut umzuprogrammieren und durch die Innervation der richtigen
Gesichtsmuskeln jenes Lächeln zu erzeugen, das ihm die Aufenthaltsbewilligung
als »guter« Mensch unter
»guten« Menschen wieder verleiht.“ Seinen
Umgang sorgfältig und überhaupt zu wählen, wird – zumal Kindern – sozial
nicht gerade erleichtert; und ausgerechnet diesbezüglich sind/werden ‚Bezugsgruppen‘ von zentraler Bedeutung – jedenfalls
bis wir verstehen/akzeptieren, ‚dass uns/mich
manche Menschen nie lieben / interssant-finden werden, ganz egal was und
wieviel ich/wir dafür auch immer zu tun/versuchen bereit sind/wären‘. –
Frustrierte ‚Konsequenz‘ also inklusive: 
![]() [Ups: Selbstwertschätzung/en als notwendige,
statt hinreichende, Voraussetzung der Nächstenliebe
enttarnt] Wer mich liebt, mit dem stimmt etwas nicht 97 „»Fs würde mir nicht im Traum
einfallen, einem Klub beizutreten, der bereit wäre, jemanden wie mich als
Mitglied aufzunehmen.« Wenn Sie sich die Mühe nehmen,
die Tiefe dieses Witzes {von Groucho Marx] zu ergründen, sind Sie bereits gut
auf das nun Folgende vorbereitet.“
[Ups: Selbstwertschätzung/en als notwendige,
statt hinreichende, Voraussetzung der Nächstenliebe
enttarnt] Wer mich liebt, mit dem stimmt etwas nicht 97 „»Fs würde mir nicht im Traum
einfallen, einem Klub beizutreten, der bereit wäre, jemanden wie mich als
Mitglied aufzunehmen.« Wenn Sie sich die Mühe nehmen,
die Tiefe dieses Witzes {von Groucho Marx] zu ergründen, sind Sie bereits gut
auf das nun Folgende vorbereitet.“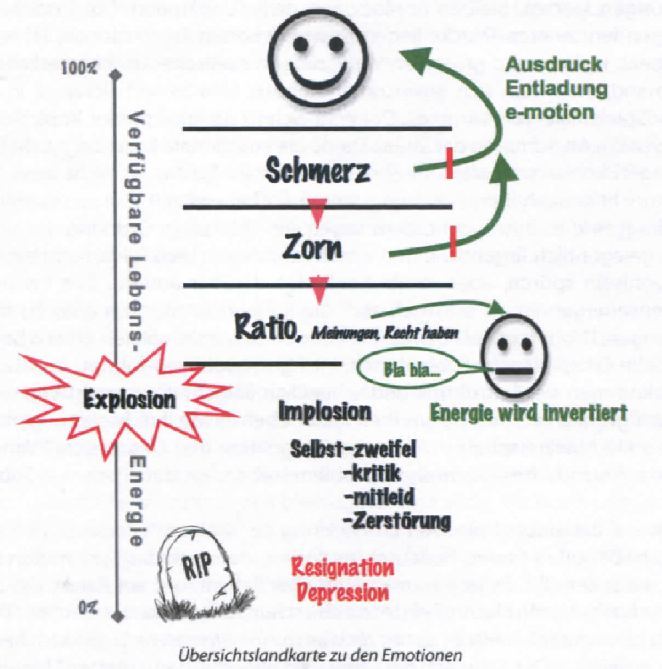 [Selbstverleugnung bis Selbsthass
gegen kaum weniger weit – ohne etwa das Selbe sein, oder werden, zu müssen]
[Selbstverleugnung bis Selbsthass
gegen kaum weniger weit – ohne etwa das Selbe sein, oder werden, zu müssen]
„Geliebt zu werden, ist auf jeden
Fall mysteriös.
Nachzufragen,
um Klarheit zu schaffen, empfiehlt sich nicht. Bestenfalls kann es der andere
Ihnen überhaupt nicht sagen; schlimmstenfalls stellt sich sein Grund als etwas
heraus, das Sie selbst bisher nicht für Ihre charmanteste Eigenschaft hielten: zum Beispiel das Muttermal auf Ihrer linken
Schulter. Schweigen ist wiedereinmal ganz eindeutig Gold.
Was wir
daraus für unser Thema lernen können, zeichnet sich nun schon klarer ab. Nehmen
Sie nicht einfach dankbar hin, was Ihnen das Leben durch Ihren (offensichtlich
selbst liebenswerten) Partner bietet. Grübeln Sie. Fragen Sie sich, aber nicht
ihn, warum. Denn er muß ja irgendeinen Hintergedanken haben. Und den enthüllt
er Ihnen bestimmt nicht.“
Von Rousseau(s Brief an
Madame d'Houdetot) bis mit Jan Paul Satre lasse sich das erste, jedem mögliche, Stadium
der Paradoxie heraus arbeiten: „»[…] Wem wäre es recht, wenn er hören müßte: »Ich liebe
dich, weil ich mich freiwillig verpflichtet habe, dich zu lieben, und weil ich
mein Wort nicht brechen [nicht auf unsere durch zuverlässigen gemeinsam
größeren Möglichkeitenspielräume, verzichten; N.N.] will; ich liebe dich aus Treue zu mir selbst.«? So
verlangt der Liebende den Schwur und ist über den Schwur unglücklich.
Er will von
einer Freiheit geliebt werden und
verlangt,
daß diese Freiheit als solche nicht mehr frei sei.«“
Die eigentlich fortgeschrittene
Kunst der Unglücksmaximierung vermittels Liebe beruht allerdings auf einer/der,
nicht mehr allen zugänglichen, genannten Prämisse: „daß man sich selbst für liebensunwürdig hält“
bis in all ihre, eben durchaus logischen Konsequenzen: „Damit ist jeder der einen liebt propt diskrediteiert.
[…] Und damit ist nicht nur
das geliebte Wesen. sondern auch der Liebende selbst und die Liebe als solche,
in ihrer Schäbigkeit enthüllt. […s] Nur auf den ersten Blick erscheint das
absurd, denn die Komplikationen, die mit dieser Auffassung einhergehen, liegen
doch so klar auf der Hand. […]
Praktisch verliebe man sich
also in hoffnungsloser Weise: In einen verheirateten Partner, einen Priester,
einen Filmstar […]
Auf diese
Weise reist man hoffnungsfroh, ohne anzukommen, und zweitens bleibt einem die
Ernüchterung erspart feststellen zu müssen, daß der andere gegebenfalls
durchaus bereit ist, in eine Beziehung einzutreten – womit er sofort
unattraktiv“ würde.
![]() [S/Eine Aufgabe, bis gar Berufung, zu haben/finden, respektive zu (er)füllen/verwirklichen, erleichtert undװaber
erschwert so manches, zumal im Umgang mit sich
selbst – ersetzt diesen Fragenturm
jedoch gerade keinesfalls] Edel sei
der Mensch, hilfreich
und gut
105
[S/Eine Aufgabe, bis gar Berufung, zu haben/finden, respektive zu (er)füllen/verwirklichen, erleichtert undװaber
erschwert so manches, zumal im Umgang mit sich
selbst – ersetzt diesen Fragenturm
jedoch gerade keinesfalls] Edel sei
der Mensch, hilfreich
und gut
105 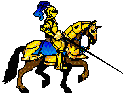 Selbst/Sogar selbstlose Hilfe, zumal Fremden gegenüber, könne – wie jede
gute Tat – von des Gedankens Blässe angekränkelt werden. Auch/Gerade rein
alturistisch/selbstlos motiviert erscheinende Handlungen sind beliebig in/unter
Verdacht bringbar, eben dies nicht, also auch Kalküle zu sein.
Selbst/Sogar selbstlose Hilfe, zumal Fremden gegenüber, könne – wie jede
gute Tat – von des Gedankens Blässe angekränkelt werden. Auch/Gerade rein
alturistisch/selbstlos motiviert erscheinende Handlungen sind beliebig in/unter
Verdacht bringbar, eben dies nicht, also auch Kalküle zu sein.  [Zur irrig( dichotom zweiwertig)en / ‚griechisch-hellenistischen‘ Reinheitsunterstellungen der Bedingungslosigkeiten: Vgl. bereits die apostolische Moralkitik, insbesondere des
Paulus/Saulus von Tarsus an jenen Ethisierern, die ja ansonsten auf die
verwegene, anti-mythische Idee kommen
könnten: der Mensch wäre gar nicht (allein) um des Sabbat/Sonntags äh Gottesdienstes willen … Sie/Euer Gnaden wissen
schon]
[Zur irrig( dichotom zweiwertig)en / ‚griechisch-hellenistischen‘ Reinheitsunterstellungen der Bedingungslosigkeiten: Vgl. bereits die apostolische Moralkitik, insbesondere des
Paulus/Saulus von Tarsus an jenen Ethisierern, die ja ansonsten auf die
verwegene, anti-mythische Idee kommen
könnten: der Mensch wäre gar nicht (allein) um des Sabbat/Sonntags äh Gottesdienstes willen … Sie/Euer Gnaden wissen
schon]
Eine Paradoxie des ‚Helfens‘ bleibt, dass es entweder erfolglos, sich also irgendwann abnutzend (Erschöüfung
bis Eretzung der Helferseite) – ![]() [Jede dritte Möglichkeit(en) vorstellbarkeitshorizontlich
/ definitiv ausgeschlossen]
oder aber erfolgreich diese nicht länger benötigend (Sinn und Zweck des Verhältnisses erschöpft), die Beziehungsrelation diesbezüglich / so auf Hilfe/עזר/Macht konzentriert-reduziert nicht länger/dauerhaft
aufrechterhalten werden kann:
[Jede dritte Möglichkeit(en) vorstellbarkeitshorizontlich
/ definitiv ausgeschlossen]
oder aber erfolgreich diese nicht länger benötigend (Sinn und Zweck des Verhältnisses erschöpft), die Beziehungsrelation diesbezüglich / so auf Hilfe/עזר/Macht konzentriert-reduziert nicht länger/dauerhaft
aufrechterhalten werden kann:
Fachsprachlich ![]() ‚Kollusipn‘
(stets
Werdens-gefärdete vorgebliche/scheinbare
‚Ideal-Beziehung‘ in der eine, bis jede, Seite genau so sein wollen muss, wie
die andere diese benötigt, um ihre »Wirklichkeit«, so wie sie sich sieht/will »real«
werden zu lassen – wechselseitige Sei-spontan-Paradixie) und/aber als gespielte/erkaufte: nie ‚so ganz wirklich
echt und wahrhaftig‘ / ‚nur
inszenierte Rollen (auch noch ‚für Geld‘ oder ‚Ansehen‘, ‚Macht‘, ‚Himmelslohn‘ pp. tauschend/)spielend‘ verlaufen können. „Praktische Beispiele liefern uns die fast immer inteüigenten,
verantwortungsvollen, aufopfernden
‚Kollusipn‘
(stets
Werdens-gefärdete vorgebliche/scheinbare
‚Ideal-Beziehung‘ in der eine, bis jede, Seite genau so sein wollen muss, wie
die andere diese benötigt, um ihre »Wirklichkeit«, so wie sie sich sieht/will »real«
werden zu lassen – wechselseitige Sei-spontan-Paradixie) und/aber als gespielte/erkaufte: nie ‚so ganz wirklich
echt und wahrhaftig‘ / ‚nur
inszenierte Rollen (auch noch ‚für Geld‘ oder ‚Ansehen‘, ‚Macht‘, ‚Himmelslohn‘ pp. tauschend/)spielend‘ verlaufen können. „Praktische Beispiele liefern uns die fast immer inteüigenten,
verantwortungsvollen, aufopfernden
Frauen, mit
ihrer fatalen Neigung, Trinker, Spieler oder Kriminelle durch die Macht
ihrer Liebe in Tugendbolde zu verwandeln, und die his zum bitteren Ende auf mehr des selben Verhaltens des Mannes mit mehr
der selben Liebe und Hilfsbereitschaft reagieren. […] eine Vereinbarung auf der Beziehungsebene (unter Umständen ganz unbewußt
[[sic!]), wodurch man sich vom
anderen als die Person bestätigen und ratifizieren läßt, als die man sich
selbst sieht. […] eine
Mutter ohne Kinder, , einen Arzt ohne Kranken, einen
Staatschef ohne Staat, einen Richter
ohne Angeklagte, ein Retter ohne Gefärdete, Belehrende ohne zu Belehrende […] wären nur Schemen, provisorische Menschen
sozusagen. Erst durch den Partner der die notwendige Rolle uns gegenüber spielt,
werden wir »wirklich«
[…]“ gespielt.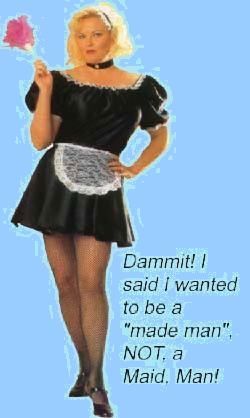 [Zumal Geschlechterrelationen, auch gleiche bis generative und ‚Kulturen
übergreifend‘, zahllose Belege/Varianten liefern]
[Zumal Geschlechterrelationen, auch gleiche bis generative und ‚Kulturen
übergreifend‘, zahllose Belege/Varianten liefern]
![]() [Na klar,
dass/falls Andere anders,
bis für Irritationen-ursächlich, erscheinen]
Diese
verrückten Ausländer [/‚Andersdenkenden
bis ‚Ungläubigen/Regelabweichler‘] 115
[Na klar,
dass/falls Andere anders,
bis für Irritationen-ursächlich, erscheinen]
Diese
verrückten Ausländer [/‚Andersdenkenden
bis ‚Ungläubigen/Regelabweichler‘] 115  [Pelegs-‚Eintopf pseudo-ethnologischer Raritäten‘: Nicht genug damit, dass sich
die Sitten und Gebräuche ändern, äh
von
Gegend zu Gegend unterscheiden, können
[Pelegs-‚Eintopf pseudo-ethnologischer Raritäten‘: Nicht genug damit, dass sich
die Sitten und Gebräuche ändern, äh
von
Gegend zu Gegend unterscheiden, können 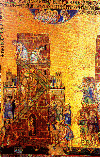 – die erwartungsgemäße Reaktion einer anderen
‚Kultur/Sprache‘ passt selten hinreichend, bis eher gegenteilig, insbesondere
zu den (gar nicht wortgetreu mit übersetzbaren, allenfalls zu dollmätschenden) ‚Höflichkeitsregeln‘, der anderen: Der ‚Latin lover‘ /
‚Minnesänger‘ bedürfe komplementär der ‚platonischen Erwiderung‘ / ‚mütterlich-gütig ablehnenden‘
(gleich gar ‚altersunabhängigen‘) Gegen-Mitspielerin – oder
spätestens das Geschlechterverhältnis eskaliert wechselseitig weiter (als bereits hyperreal ‚gemurmelt‘-wird). Die Reaktion auf zu langen Augenkontakt ist, östlich
des Nordatlantiks aufgewachsen, ein böse dreinschauendes unnahbar-Werden,
westlich dieses ‚großen Wassers‘ akkulturiert, allersing ein Lächeln, zumal bei/von zu
intensiv angesehenen
Frauen: „Sie bietet sie aber keineswegs: nur die Spielregeln sind anders.“]
– die erwartungsgemäße Reaktion einer anderen
‚Kultur/Sprache‘ passt selten hinreichend, bis eher gegenteilig, insbesondere
zu den (gar nicht wortgetreu mit übersetzbaren, allenfalls zu dollmätschenden) ‚Höflichkeitsregeln‘, der anderen: Der ‚Latin lover‘ /
‚Minnesänger‘ bedürfe komplementär der ‚platonischen Erwiderung‘ / ‚mütterlich-gütig ablehnenden‘
(gleich gar ‚altersunabhängigen‘) Gegen-Mitspielerin – oder
spätestens das Geschlechterverhältnis eskaliert wechselseitig weiter (als bereits hyperreal ‚gemurmelt‘-wird). Die Reaktion auf zu langen Augenkontakt ist, östlich
des Nordatlantiks aufgewachsen, ein böse dreinschauendes unnahbar-Werden,
westlich dieses ‚großen Wassers‘ akkulturiert, allersing ein Lächeln, zumal bei/von zu
intensiv angesehenen
Frauen: „Sie bietet sie aber keineswegs: nur die Spielregeln sind anders.“] 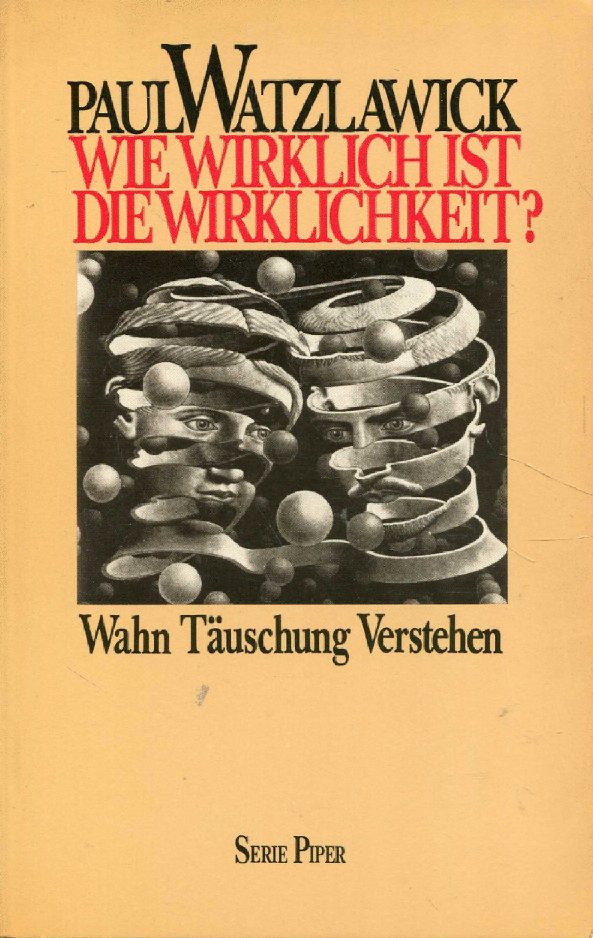
 [Fragt eine Dame in Bayern
ihre griechische Putzhilfe / Kellnerin / Anwältin / Freundig, ob deren Urlaub
auf Korfu ‚schön gewesen‘ sei; und diese antwortet ihr mit ‚Ne‘ – kommt es eben
darauf an: ob sie, immer noch begeistert, griechisch redete (es also
‚schön gewesen war‘),
oder ihre Enttäuschung dennoch artig/loyal auf
bayrisch zum Ausdruck brachte; vgl. A.K.]
[Fragt eine Dame in Bayern
ihre griechische Putzhilfe / Kellnerin / Anwältin / Freundig, ob deren Urlaub
auf Korfu ‚schön gewesen‘ sei; und diese antwortet ihr mit ‚Ne‘ – kommt es eben
darauf an: ob sie, immer noch begeistert, griechisch redete (es also
‚schön gewesen war‘),
oder ihre Enttäuschung dennoch artig/loyal auf
bayrisch zum Ausdruck brachte; vgl. A.K.]
„Wiederum ist das Prinzip denkbar simpel: Man
nehme, allen
Gegenbeweisen zum Trotz, schlicht an, das
eigene Benehmen [/Empfinden; O.G.J. ‚gedankenlesend‘] sei unter allen Umständen
selbstverständlich und normal. Damit »wird« alles andere Benehmen[/Denken
respektive Wollen; O.G.J.] in der selben Situation
verrückt oder zumindest dumm.“ 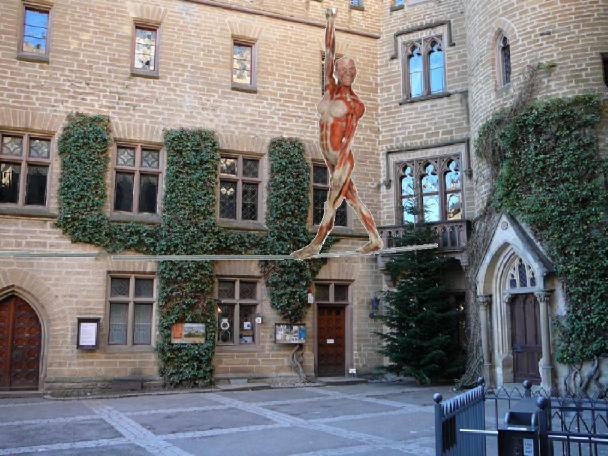 [Sogar
‚eine Künstlerin‘ – immerhin ein hoher Anspruch an Tätigkeiten ‚einen
Angang zu machen‘ – sogar
ohne komplementäres Publikum, balanciert stets, gar auch Eure/unsere, Mehrdeutigkeiten
(zumal
der/an Freiheitenspielröume/n; vgl. e.B. bis R.K.S.)]
[Sogar
‚eine Künstlerin‘ – immerhin ein hoher Anspruch an Tätigkeiten ‚einen
Angang zu machen‘ – sogar
ohne komplementäres Publikum, balanciert stets, gar auch Eure/unsere, Mehrdeutigkeiten
(zumal
der/an Freiheitenspielröume/n; vgl. e.B. bis R.K.S.)]
V
![]() [Längst nicht alle ‚Glückssuchenden‘
wollen, bis sollen, es auch …] Das Leben als Spiel
121
[Längst nicht alle ‚Glückssuchenden‘
wollen, bis sollen, es auch …] Das Leben als Spiel
121 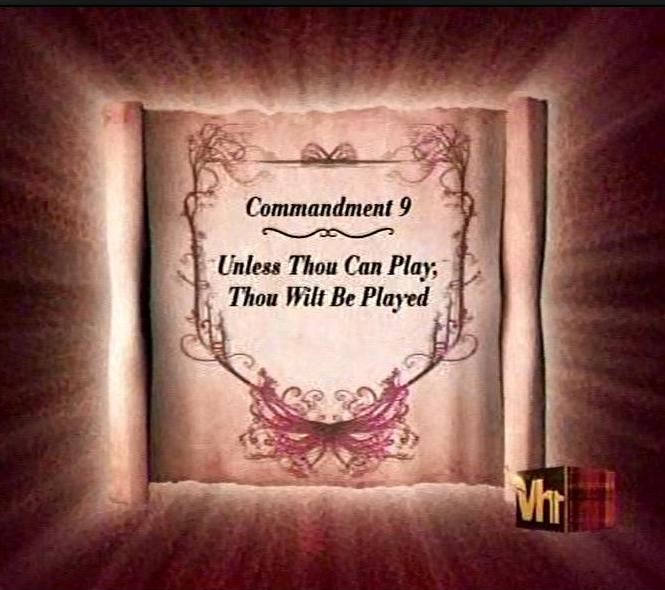
[Mit jenen, die die Regeln nicht erkennen, wird gespielt]
Wichtigste, also verratsgefärdete/blasphemisch
bedrohte, Spielregel bleibe
mit Alan Watts und Donald D. Laing: „Dies(es Leben) ist kein Spiel! Dies ist
tödlicher Ermst.“ Zu zeigen, dass/wie wir
spielen/ist folglich
ein derart heftiger Regelverstoß, dass diese
peinliche Bloßstellung sozialpsychologisch bestraft werde. Höhere
Mathematik, ohnehin ‚nur eine/die‘
Spiel-Theorie bewaht zwar nicht davor, erklärt aber einiges:  [Alle
sechs der bisherigen Modalitäten hier geben
die Spieltheorie(leugnung) darunter/dahunter offenlegend, gar
qualifiziert prophetisch, also letztlich nicht-recht behalten s/wollend, zu; vgl. zudem des Komilitonen Nietzsches Warnung in ‚Jenseits von Gut und Böse‘ unter welchen spzialen Figurationen der Wahnsinn (zumal ‚Zusammenhalts-fördernd‘-versprochen/vermeint;
O.G.J. Gemeinschafts-skeptisch bis gar
Gesellschafts-kritisch)
besonders verbreitet]
[Alle
sechs der bisherigen Modalitäten hier geben
die Spieltheorie(leugnung) darunter/dahunter offenlegend, gar
qualifiziert prophetisch, also letztlich nicht-recht behalten s/wollend, zu; vgl. zudem des Komilitonen Nietzsches Warnung in ‚Jenseits von Gut und Böse‘ unter welchen spzialen Figurationen der Wahnsinn (zumal ‚Zusammenhalts-fördernd‘-versprochen/vermeint;
O.G.J. Gemeinschafts-skeptisch bis gar
Gesellschafts-kritisch)
besonders verbreitet]
„Bringen wir nun diese Problematik von den abstrakten Gefilden der Mathematik oder den kollektiven“ tarivlichen
„Scharmützeln […] auf die Ebene menschlicher Beziehungen herunter. Ist eine Partnerbeziehung ein Nu summen- oder ein Nichtnullsummenspiel?“
Entscheidend „ob es zutrifft, daß da die
»Verluste« des einen Partners dem »Gewinn« des anderen entsprechen. ![]() [Nullsummenparadigmatisch entsprechen/ergänzen
einander entweder ‚richtig‘/weiss oder aber ‚falsch‘/schwarz farblos]
[Nullsummenparadigmatisch entsprechen/ergänzen
einander entweder ‚richtig‘/weiss oder aber ‚falsch‘/schwarz farblos]
Und hier
scheiden sich die Geister. Der Gevinn, zum
Beispiel, der im eigenen Rechthaben und dem Nachweis des Irrtums (dem
Verlust) d es Partners liegt, läßt sich d urchaus als Nullsummenspiel
auffassen. Und viele Beziehungen sind
es auch. Um
sie dazu zu machen. genügt es, wenn einer der beieden das
Leben als Nullsummenspiel sieht,
das nur die
Alternative
zwischen Gewinner und Verlierer offen läßt, Alles weitere
ergibt sich zwanglos[!], auch wenn die Philosophie[!] des anderen zunächst nicht
dahingehend ausgerichtet
war. Man
spiele also Nnllsnrpmp auf der Beziehungsebene - und man kann sich darauf
verlassen, daß die Dinge auf der Objektebene langsam aber sicher zum Teufel
gehen.“ 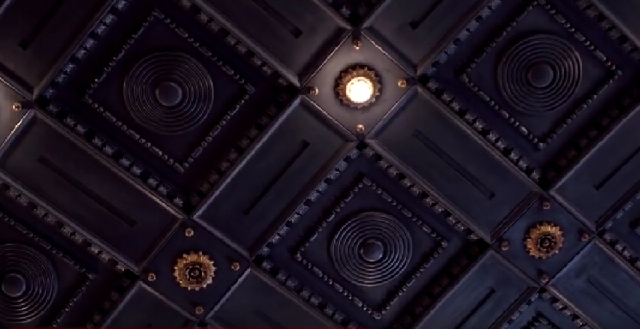 [Grunderfahrung/Erkenntniskern: Spielt (auch ‚nur‘) eine beteiligte Seite Nullsummenspiel –
zwingt deren Sichtweise die
Übrigen zu, (zumal
mit der Zeit) gar schmerzlich
heftigen, Entscheidungen] Übersehen werde so/dabei
insbesondere, dass auf diese
Weise alle Beteiligten
gegnüber den Leben (seinen kooperativen
Möglichkeitenspielräumen) verlieren. Dass/Wie so
sogar/gerade Liebe ver- und aufgebraucht wird, bemerken manche hinterher eher.
kalt erwischt, noch schmertzlicher, als die
paradigmatische Voraussetzung zwar ernsthaft überzeugten aber ernstlich
widerlegeungsgefärdeten Meines, als erste
der drei Einschänkungen qualifizierten Wissens, um engeren Sinne.
[Grunderfahrung/Erkenntniskern: Spielt (auch ‚nur‘) eine beteiligte Seite Nullsummenspiel –
zwingt deren Sichtweise die
Übrigen zu, (zumal
mit der Zeit) gar schmerzlich
heftigen, Entscheidungen] Übersehen werde so/dabei
insbesondere, dass auf diese
Weise alle Beteiligten
gegnüber den Leben (seinen kooperativen
Möglichkeitenspielräumen) verlieren. Dass/Wie so
sogar/gerade Liebe ver- und aufgebraucht wird, bemerken manche hinterher eher.
kalt erwischt, noch schmertzlicher, als die
paradigmatische Voraussetzung zwar ernsthaft überzeugten aber ernstlich
widerlegeungsgefärdeten Meines, als erste
der drei Einschänkungen qualifizierten Wissens, um engeren Sinne.
 [Kompensationen/‚Opfer‘ vermögen erstaunlich
vieles zu tragen – ihre überhaupt Bekanntmachung / überdeutlichen Ausdrücke
noch mehr ab- bis immerhin bloß-zustellen/überdenken]
[Kompensationen/‚Opfer‘ vermögen erstaunlich
vieles zu tragen – ihre überhaupt Bekanntmachung / überdeutlichen Ausdrücke
noch mehr ab- bis immerhin bloß-zustellen/überdenken]
Möglicher
Erkenntnisfortschritt: Falls/wie sich ihrerseits Nichtnullsummenspielende, die
darum/davon wissen, sich zwar, auf dem was
Beitz/Watzlawick ‚Objektebene‘-nennen, mit Verlusten/Subotimalem abfinden
müssen,
sich aber. auf der/für die
Beziehungsebene/‚Bauch zu Bauch‘ des Kommunikationsmodels (bis was diese
Interaktionsbezeihungsrelation betreffend angeht), zwischen Alternativen zu
wählen (ge)traut/wagt, dies
‚rationalisieren‘ / ‚vernünftig bis weiseחכםintelligent tun‘ kann & darf. – Selbst/Gerade wer sich für
Beziehungsende / ‚Scheidung‘ entscheidet, müsste (sich) damit/dazu nicht auf die
Null- bis Negativsummenvarianten einlassend, das bisher Gewesene, respektive
Erreichte, verderben/entwerten bis zerstören.
 [Und/Denn wem es (zu) geling(en scheine)t, sich selbst nicht
unglücklich machen/bleiben zu wollen, der oder die, läuft Gefahren, dass
ihr/ihm dies dadurch/deswegen (glückverteilungsparadigmatisch) bei und mit der/dem/den
Anderen misslingt. – (Spieltheoretisch
reflektierte, statt einfach hoch aufgeladene/kalte) ‚Entheiratungs- allerdings
-feier‘-Bereitschaft ist/wird Risiken-Anerkennung / Wandel-Handhabung
statt ‚sich (wie
von) selbst erfüllende Vorhersage/Befürchtung‘]
[Und/Denn wem es (zu) geling(en scheine)t, sich selbst nicht
unglücklich machen/bleiben zu wollen, der oder die, läuft Gefahren, dass
ihr/ihm dies dadurch/deswegen (glückverteilungsparadigmatisch) bei und mit der/dem/den
Anderen misslingt. – (Spieltheoretisch
reflektierte, statt einfach hoch aufgeladene/kalte) ‚Entheiratungs- allerdings
-feier‘-Bereitschaft ist/wird Risiken-Anerkennung / Wandel-Handhabung
statt ‚sich (wie
von) selbst erfüllende Vorhersage/Befürchtung‘]
 [Paradoxien
gar venexianische: ‚Die eine
Hand nicht wissen zu lassen, was die andere tut‘, also ‚mit sich selbst ernst(-Fall) zu spielen‘, lässt sich allenfalls scheinbar ‚biblisch‘ aus Apostolischen
Schriften, als Spenden-Empfehlung, herausdeuten]
[Paradoxien
gar venexianische: ‚Die eine
Hand nicht wissen zu lassen, was die andere tut‘, also ‚mit sich selbst ernst(-Fall) zu spielen‘, lässt sich allenfalls scheinbar ‚biblisch‘ aus Apostolischen
Schriften, als Spenden-Empfehlung, herausdeuten] 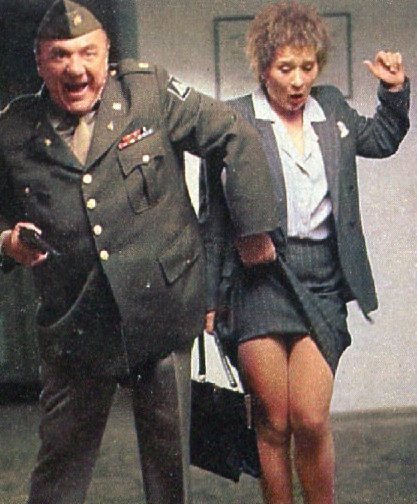
Der
Autor [P.W.] schließt seine Anleitung: „Die grundlegende
Regel [das
Wiss(barkeit)en-Prinzip;
O.G.J. mit Di.Ha.], wonach das Spiel kein Spiel, sondern todernst
ist, macht das I.ehen zu einem Spiel ohne Ende,
das eben nur der Tod beendet. Und – als wäre das
nicht schon paradox genug – hier liegt eine zweite Paradoxie: Die enzige Regel [/das Nicht(-voher)-Wissbarkeitenprinzip;
dieselbe], die dieses todernste
Spiel beenden könnte, ist nicht selbst eine
seiner Regeln. Für sie gibt es verschiedene Namen [gar farbig-empfundene, äh denkerische
‚Strumpfbänder‘; O.G.J. allerdings ausdrücklich wechselseitig/soziologisch (statt
doch/nur vorleistend) orientiert], die an sich
ein und das selbe bedeuten: Fairneß, Vertrauen, Toleranz.
[…]“ [Der eigene, gar ungerne allein erlittene, Tod
wäre/ist gar nicht die einzige Alternative zum Null- bis Negativsummen(spiel)szenario
(der Realitätenhandhabungsweise/n)]
[Der eigene, gar ungerne allein erlittene, Tod
wäre/ist gar nicht die einzige Alternative zum Null- bis Negativsummen(spiel)szenario
(der Realitätenhandhabungsweise/n)]
![]() [Das Übrige
allerdings, mögen Euer Gnaden
höchst selbst …;
verlinkende und andere Hervorhebungen O.G.J.]
[Das Übrige
allerdings, mögen Euer Gnaden
höchst selbst …;
verlinkende und andere Hervorhebungen O.G.J.]
 Außer durch beide modale
Nachbarräume (biotische
und analytische) ‚gefühlten Empfindens‘ und über eine teils verborgene Wendeltreppe direkt von/nach unten und oben ist (i/Ihnen) auch der Zugang von außen über die Tereasse (auf
der Portugiesischen
Galerie) vom Bömischen Treppenturm (‚der
Aufklärung‘) und damit nochmals aus dem Schlosshof,
wie direkter/unmittelbarer aus dem Westflügel (gar
von weit höher modal vorgegebenen
‚sozialen Unausweichlichkeiten‘) her,
möglich.
Außer durch beide modale
Nachbarräume (biotische
und analytische) ‚gefühlten Empfindens‘ und über eine teils verborgene Wendeltreppe direkt von/nach unten und oben ist (i/Ihnen) auch der Zugang von außen über die Tereasse (auf
der Portugiesischen
Galerie) vom Bömischen Treppenturm (‚der
Aufklärung‘) und damit nochmals aus dem Schlosshof,
wie direkter/unmittelbarer aus dem Westflügel (gar
von weit höher modal vorgegebenen
‚sozialen Unausweichlichkeiten‘) her,
möglich.
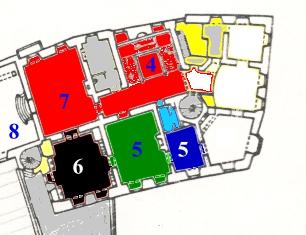
Die immerhin dunkle ‚Farbe‘ (wie weiß wären schwarz und grau ja keine im engeren, eigentlichens Sinne des Rauschesspektrums) teilt ihren Reiz durchaus auch mit jenen mancher Vornehm- und Gediegenheit der Faszinationen des gar erschrecklichen Schreckens.
Und auch, selbst bzw. gerade was ‚das‘ Böse angeht, gibt es mehr, oder noch bis gar etwas anderes, als biotisch / naturalistisch durchaus grausam vorfindliches Zerstörungs- respektive Aggressionsverhalten (oder -potenziale) und Zorn bzw. Wut, gar Stolz, sollte nicht länger nur (auch noch populär-freudianisch bis sexistisch/erotisiert) damit gleichgesetzt oder verwechselt werden.
Ybb. Fuchslochbastei [] Thymotisches basaler Antriebe des ud der Menschen ist gerade dahingehend keineswegs notwedigerweise von Übel – vielmehr lebenspendend und befruchtend – auch im, gar großzügig, über das bereits Biotische des immerhin Geschlechtstriebes (bekanntlich besonders deshalb so verdächtig weil er 'natürlicherweise' weit weniger mit restriktiven Zwangsmitteln zu motivieren trachtet) - hinausgehend.
 #hierfoto
File:///D:\Atlas der
#hierfoto
File:///D:\Atlas der
Erlebniswelten\sig210876650uYvlRk_fs.jpg
[Die bel étage mit dem Schwarzen Salon befindet sich hier von außen ‚gesehen‘ auf der Ebene des großen mit den Dachterrassen der Portugiesischen Galerie etc. verbundenen Balustrade. Zumal der Ostflügel des Wissensschlosses weißt durchaus noch ‚höhere‘ Stockwerke und eine ‚äußere‘ Wendeltreppenverbindung damit auf]
Nicht nur die ‚zunächst‘ griechischen Begrifflichkeiten der ‚Psyche‘ und es
‚Thymos‘ für so etwas wie ‚die gesamten Empfindungsfähigkeiten von Lebewesen‘,
sondern auch verbreitete ‚Seelen‘-Vorstellungen, namentlich jene
abendländisch-kartesische von Trennbarkeit bis Getrenntheiten (oft trinitarisch) von Körper respektive Materie und Geist (oder gar ‚fein[er]stofflichen Geistern‘),
bleibt durchaus erkenntnisleitend, bis irreführend.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 Die Empfindbarkeit, ihre Gründe und Folgen. – Ursprungsfragen sind basaler und eben auch, nicht
reduktionistisch nur Ontologisches / ‚Gegenstände‘ / Wahrheiten biotischer Modalität.
Die Empfindbarkeit, ihre Gründe und Folgen. – Ursprungsfragen sind basaler und eben auch, nicht
reduktionistisch nur Ontologisches / ‚Gegenstände‘ / Wahrheiten biotischer Modalität.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Genauer betrachtet, bzw. hinreichend be- bis erleuchtet, mag dieser Salon ja – ‚nur‘, wenn auch immerhin sehr dunkel – grau sein, eben die vielen (PC-edv-technisch zunächst immerhin 256) womöglich weisen Schattierungsstufen zwischen weiß und schwarz, meinen und betreffen.
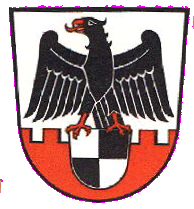 Doch so ganz ohne alle
Absolutheiten – also ohne selbst (bei Versuchen sich selbst und/oder gar das
Ganze zu verstehen) ins Truden geraten,
wenigstens zu können/riskieren – tut es nicht einmal und gerade der menschliche Verstand
(wohl auch psycho-logischerweise) nicht:
Doch so ganz ohne alle
Absolutheiten – also ohne selbst (bei Versuchen sich selbst und/oder gar das
Ganze zu verstehen) ins Truden geraten,
wenigstens zu können/riskieren – tut es nicht einmal und gerade der menschliche Verstand
(wohl auch psycho-logischerweise) nicht:
‚Der‘ ganz schwarze Raum (nicht
erst was #hier![]() Schrödingers
Quantenkatzenlebendigkeitsproblem angeht), – nur eine der untrennbaren Verbundenheiten
des Wahrnehmens überhaupt
Schrödingers
Quantenkatzenlebendigkeitsproblem angeht), – nur eine der untrennbaren Verbundenheiten
des Wahrnehmens überhaupt ![]() mit dem Roten Salon
Analytischer
mit dem Roten Salon
Analytischer ![]() Modalität.
Modalität.
Gleich gar in der alltäglich vereinfachenden Flapsigkeit, die dann
prompt als einzig wahre äh
relevante Realität verabsolutiert wird,
lautet die – wider bessere Wissbarkeiten, und gegen
viel Erfahrung – durchaus gänige Behauptung (im
und über das völlig dunkle Zimmer): ‚Da ist(gibt es (sonst) nichts.‘ Wobei ja bereits das
eingeklammerte ‚sonst‘, zumal seinerseits vorfindlicher Vacuii, recht viel mehr
als immerhin die Beobachtenden wegdefinieren ... Sie wissen schon. Mehr als
Aussagen nach dem Muster: ‚ich sehe/höre/rieche da nichts‘, werden sich, gerade
im Dunklen, kaum stichhaltig, verletzungsfrei etc. pp. behaupten lassen.![]()
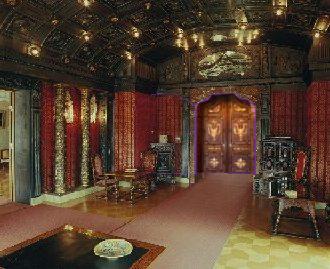
Mit der wehemennten Forderung nach (der/des anderen) bzw. Behauptungen von (eigener) ‚Objektivität‘ (des philosophischen Empirismus) iat eigentlich/bestenfalls eine Denk- und Ausdrucksform solchen Rückverweis auf die (intersubjektive Konsensbildung immerhin ermöglichende) auf solche (gar unter gängig omnipräsenten Egoismusverdikt stehende) antiabsolute, nicht allgemeingültige Subjektivitäts-Einsichten gemeint: Dass immer, und nur, ich es bin – der bzw. die da etwas als gegeben, bis als überhaupt nichts – in wessen/welchem zumal höheren Namen (etwa von: Vernunft, Gemeinwohl, Recht, Wissenschaft, Realität, Gott) auch immer – erkennt/offenbart, bis sich es (absolut) durchsetzen zu müssen überzeugt empfindet.
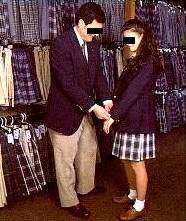 Und ja – diese, womöglich zornige, rote Bemerkung
ist durchaus komplementär zu transpersonalen, überindividualistischeen
Psychologien, jenseits vom Einzelnen (epistemologisch
‚Teil‘), und zumindest als artiges – eben ernsthaftes – Kompliment, allerdings
gegen (weitere) Belehrungen
mit/aus Hoheitsanspruch, formalisiert.
Und ja – diese, womöglich zornige, rote Bemerkung
ist durchaus komplementär zu transpersonalen, überindividualistischeen
Psychologien, jenseits vom Einzelnen (epistemologisch
‚Teil‘), und zumindest als artiges – eben ernsthaftes – Kompliment, allerdings
gegen (weitere) Belehrungen
mit/aus Hoheitsanspruch, formalisiert. 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[#Hilfsmittel Black Box] Die
Problemstellungen der Schwellen- oder
Übergangsphänomene dieser paradoxen, quasi einseitig verriegelbaren, doch damit
weitererseits doch unverriegelten, Wahrnehmungswand, lössen ‚sich‘/wir Menschen aber auch nicht
durch mehr (oder
überhaupt durchaus – wie auch immer verstandenes
und zustande gekommenes bzw, herstammendes) ‚Licht‘
(völlig) auf:
Die
Problemstellungen der Schwellen- oder
Übergangsphänomene dieser paradoxen, quasi einseitig verriegelbaren, doch damit
weitererseits doch unverriegelten, Wahrnehmungswand, lössen ‚sich‘/wir Menschen aber auch nicht
durch mehr (oder
überhaupt durchaus – wie auch immer verstandenes
und zustande gekommenes bzw, herstammendes) ‚Licht‘
(völlig) auf:
 [Gar zu häufig zusätzlich missverstandenen geht die,
im engeren Sinne, Frage mindestens so weit: Wer / Wann / Wo / Wie s/eine,
bis wessen, ups ‚Zofe‘ oder was/wer sonst … (Lücken durch)tanzt/‚knickst‘
äh kämpft]
[Gar zu häufig zusätzlich missverstandenen geht die,
im engeren Sinne, Frage mindestens so weit: Wer / Wann / Wo / Wie s/eine,
bis wessen, ups ‚Zofe‘ oder was/wer sonst … (Lücken durch)tanzt/‚knickst‘
äh kämpft] 
[Abbs. droben im Spiegelsaal; Gewarseinsabweichungen der selbigen Person, zur selben Zeit am selben Ort zwischen dem 'Spiegel der Selbst(en)wahrnehmung' einerseits und dem 'Spiegel des (gar und besonders intersubhektiv übereistimmenden) Wahrgenommren-Werdens' durch und von Anderen - am Beispiel der inzwischen immerhin als 'Bolemie' anerkennbaren, durchaus psycho-logischen Phänomene.- reichen sehr weit und sehr tief. Vorstellungs- und gar Erklärungskonzepte des Irrtums, der Illusion oder gleich gar des Betruges, der Täuschung reichen kaum hin um auch nur die Differenzen aufzuheben.]
[#Hilfsmittel Gartenbank]
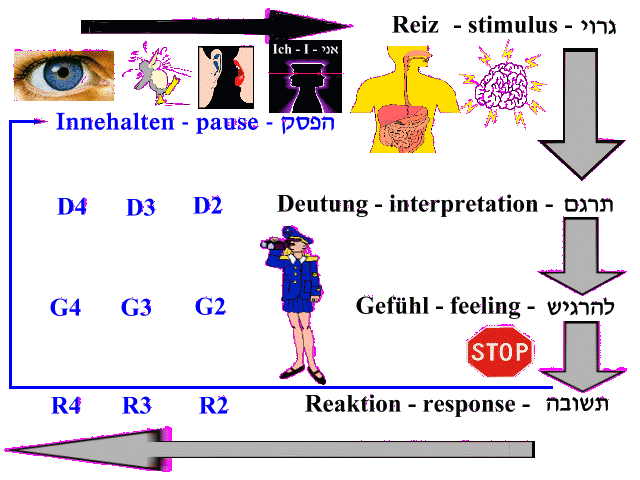
[Kognitionstheoretische bis
–terapeutische Kernthese – wider, zumindest den #hier![]() skinnerschen/populär
verberitet vorherrschenden, Behaviorismus]
skinnerschen/populär
verberitet vorherrschenden, Behaviorismus]
Ein sehr verbreiteter Irrtum ist – respektive am Anfang von / der Freiheit zur Psychologie überhaupt steht, die durchaus auch ungeheuerliche Ein- oder zumindest Ansicht –, dass Reize gar nicht unimittelbar und alternativlos zwingend eine bestimmte (zudem entweder ‚richtige‘ oder ‚falsche‘, bis ‚kranke‘) Gefühlslage hervorrufen. – Sondern, dass zwischen Stimulus ubd Wirkung (so ungeheuer schnell bis unmerklich diese Zusammenhänge auch ablaufen, oder wenigstens wirkmächtig erscheinen, mögen) ein, Reflektion/en durchaus zugänglicher, bis änderbarer, und zumindest Auswahlentscheidungen treffender, Deutungsprozess stattfindet, der menschlichen Selbstbewusstheiten nicht vollständig entzogen (oder ganz an ‚höhere Mächte‘, ‚niedere Instinkte‘ oder etwa für ‚natürlich‘ gehaltene ‚Spontanitäten/Erfahrungen‘ respektive ‚bisherige Gewohnheiten/Vorbilder‘ deligiert) bleiben/werden muss.
Vorzugsweise wohlwollend kritische Selbstbeobachtung – in der alltäglichen Praxis des unglücklich-Seins bzw. -Machens werden also prompt missgünstige, manipulative und/oder zumindest bevormundende/belehrende Selbst- bis Fremdbeobachtende erwartet bis wirksam – steht also voraussetzend im Hinter- bzw. Vordergrund (jedenfalls kongnitions-)psychologischen Vorgehens überhaupt.
Zu den besonders präsenten ‚Ängsten‘/Schrecken gehören hier häufig Befürchtungen nicht (mehr, nur all zu gerne mit ‚natürlich‘ oder ‚direkt‘ vermischt) spontan (oder wenigstens so empfunden/unreflektiert) willkürlich, bis beliebig äh ‚ehrlich‘/authentisch sein/reagieren zu können bis zu dürfen, und jene – gar noch größere, oder uneinsehbarere – durchschaubar, bis in seinem (zumal künftigen, aber auch bisherigen) Verhalten (etwas) kalkulierbar/zuverlässig äh (angeblich erst) manipulierbar zu werden.
#hierfotos File:///C:/www.jahreiss-og.de/ttemp/garter-garter%2520mauve%2520ADD.png --- nach garterband mnog


Besonders wesentlich sind/werden die Fortsetzungen der, hier also psycho-logischen (töricht wäre folglich wer sich bis anderen gleich etwas Arges bei der/jeder Theorie dächte), Anwendung des Grundgedankens die Rationalität auch/gerade in den ‚innermenschlichen‘ Relationen, als einen möglichen und zulässigen / mitspracheberechtigten ‚Partner‘ anzuerkennen, in und an der Dreieckspyramide eines wohl bzw. gut durchaus selbst mitverwalteten (anstatt heteronom – etwa schicksalhaft oder sozial-bestimmten) Lebens:
[#Hilfsmittel Verwaltungspyramide]
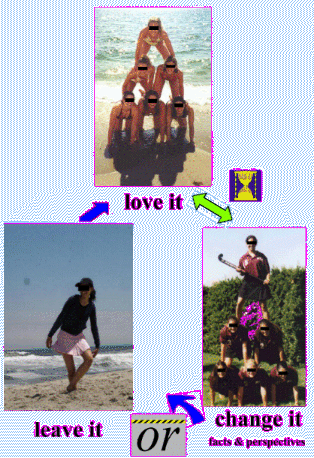
![]() Die ‚Sonnenseite‘
der Dreieckspyramide – immerhin wohl bis gut ausgerechnet verwalteten – biographischen Lebensverlaufs liegt –
respektive positioniert und bewegt Ihr Dasein zwischen dem 'love it' und den beiderlei
'change it' (der – zumindest basalen, reflektierten
bis aller –Umstände/Sachverhalte und/oder der verwendeten Sichtweisen/Selbst- bis Fremd-Verständnisse, ja
Handhabungsweisen, desselben).
Die ‚Sonnenseite‘
der Dreieckspyramide – immerhin wohl bis gut ausgerechnet verwalteten – biographischen Lebensverlaufs liegt –
respektive positioniert und bewegt Ihr Dasein zwischen dem 'love it' und den beiderlei
'change it' (der – zumindest basalen, reflektierten
bis aller –Umstände/Sachverhalte und/oder der verwendeten Sichtweisen/Selbst- bis Fremd-Verständnisse, ja
Handhabungsweisen, desselben).
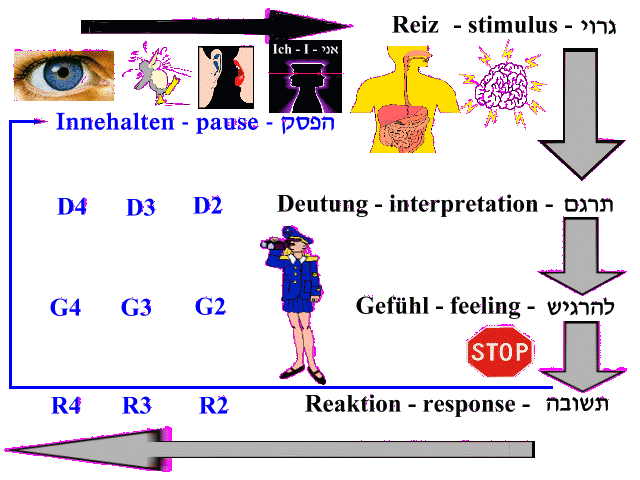 [Ups-Peinlichkeitsdrache:
Gleiche Umstände umd dieselbe(n) Person(en), beinahe gleichzeitig – doch,
jedenfalls derart, unterschiedlich empfindbar]
[Ups-Peinlichkeitsdrache:
Gleiche Umstände umd dieselbe(n) Person(en), beinahe gleichzeitig – doch,
jedenfalls derart, unterschiedlich empfindbar]  [Nicht
einmal Vergebung – auch keinerlei Rückzahlung oder Schuldenerlass/Entschädigung – ädert die bisherige Faktenlage] [??Exemplarisches
Zitat für Sichtweisenwandel Apothekengeschichte im Tiefschnee – 10
Fehler-Auszüge bis PW ‚Die Bohnen in der Hand‘
etc.] „Der rücksichtslose Autofahrer
[Nicht
einmal Vergebung – auch keinerlei Rückzahlung oder Schuldenerlass/Entschädigung – ädert die bisherige Faktenlage] [??Exemplarisches
Zitat für Sichtweisenwandel Apothekengeschichte im Tiefschnee – 10
Fehler-Auszüge bis PW ‚Die Bohnen in der Hand‘
etc.] „Der rücksichtslose Autofahrer
Nach heftigem Schneefall liegen fast zwanzig
Zentimeter Schnee auf der
Straße. Sie müssen mit einem Rezept zur Apotheke,
fahren also dorthin
und stellen fest, daß ein Auto die beiden
einzigen freigeschaufelten Park-
plätze davor blockiert. Das bedeutet, daß Sie
im Schnee parken müssen
und nur hoffen können, nicht stecken zu
bleiben. Es bedeutet außerdem,
daß Sie durch eine hohe Schneeverwehung waten
müssen, um zur Tür
zu gelangen. Was fühlen Sie? Frustration?
Vermutlich ein wenig. Ärger? Vermutlich eine ganze Menge.
Sie denken vielleicht: »Ich bin stinkwütend.
Ich kann es nicht fassen,
daß jemand einfach beide Parkplätze zuparkt.
Was für eine Rücksichtslosigkeit. So was Dreistes. Ich hoffe, der Blödmann hat
einen Platten auf dem Nachhauseweg.«
Als Sie die Apotheke betreten, rennt ein Mann
so schnell an Ihnen
vorbei zu dem Auto des Anstoßes, daß Sie ihm
nichts mehr zurufen
können. Sie wollen gerade eine Bemerkung zu der
Apothekerin machen,
als sie sagt: »Der arme Kerl. Sein Kind liegt
im Sterben. Der Arzt hat
ihm zwar etwas verschrieben, aber eigentlich
kann ihm nichts mehr helfen.«
Was passiert jetzt mit all dem Ärger? Selbst
wenn Sie immer noch ein
wenig aufgebracht sind, hoffen Sie weiterhin,
daß der Mann auf dem
Nachhauseweg einen Platten
hat? Wahrscheinlicher ist, daß Sie jetzt
ganz anders über ihn denken. Sie empfinden
jetzt Bedauern oder Mitleid
statt Ärger oder Wut. Das nächste Mal, wenn Sie
in die Apotheke kommen, werden Sie sich vermutlich nach dem Kind erkundigen.“
(S. 12 f.) ‚Der ‚rücksichtslose Autofahrer‘ bemerkte sein Verhalten wohl kaum,
und insbesondere änderte er / es sich nachträglich ja noch viel weniger – der
beobachtende, bis davon betroffene, Mensch jedoch bewertet/empfand sein
Erlebtes (gar eher unabhängigo vpn der überhaupt
Betiligung anderer Leute bis Fakten) recht unterschiedlich, bis geradezu
gegenteilig. ![]() [Das
Lesen/Hören desselben Textes oder Musikstücks, wie das Betrachten eines Bildes
oder gar einer Erinnerung – ‚niemand steige zweimal in genau denselben Fluss‘]
[Das
Lesen/Hören desselben Textes oder Musikstücks, wie das Betrachten eines Bildes
oder gar einer Erinnerung – ‚niemand steige zweimal in genau denselben Fluss‘]
 Wesentliche Ungeheuerlichkeiten sind zuoft/vielen die/der Möglichkeiten Mehrzahl: Sein (respektive das) aktuell, gegenwärtig so erfahrene Leben ‚entweder‘ zu lieben bis zu hassen;
und/oder es bzw. seine Wahrnehmung/en
ändern, respektive es – vorzugsweise auf einem Weg
zu / einer Suche nach neuem/anderem 'love it' verlassend, die vorfindlichen Welt-Wirklichkeit/en, dank der Lücke des He,
erneut, bis von Neuem / einem weiteren
Gestaltungs- und
Vervollständigungs-/Heilungsversuch, zu betreten/überwinden.
Wesentliche Ungeheuerlichkeiten sind zuoft/vielen die/der Möglichkeiten Mehrzahl: Sein (respektive das) aktuell, gegenwärtig so erfahrene Leben ‚entweder‘ zu lieben bis zu hassen;
und/oder es bzw. seine Wahrnehmung/en
ändern, respektive es – vorzugsweise auf einem Weg
zu / einer Suche nach neuem/anderem 'love it' verlassend, die vorfindlichen Welt-Wirklichkeit/en, dank der Lücke des He,
erneut, bis von Neuem / einem weiteren
Gestaltungs- und
Vervollständigungs-/Heilungsversuch, zu betreten/überwinden. 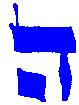 [Offenheitenzumutung/en erschrecken besonders
indoeuropäisches Singulardenkempfinden]
[Offenheitenzumutung/en erschrecken besonders
indoeuropäisches Singulardenkempfinden]
[The
Flying Lady Emily –
![]() Spirit
of Ecstasy – Glückseeligkeit]
Manche Menschen (nicht allein KünstlerInnen)
leben durchaus nach einer, kleinkindlichen bis vernünftigen, Variante der
Denkform: 'My frame of reverence is ecstasy', in der Nähe voller, ungetrübter
Lebensfreude. Und na klar konnt auch ihnen so manches Mal so manches quer, bis
dazwischen. – Ob kausaler- bis notwendiger- oder gar schuldhafter- respektive
kognitiverweise kommt es wesentlich(er)
auf den Umgang mit den Änderungsmöglichkeiten an (deren
Existenz oder Zugänglichkeit bzw. Nützlichkeiten zu bestreiten/negieren oder
verbieten zu s/wollen, gehört zu den
gängigsten und wichtigsten Fremdbestimmungsmitteln/der Heteronomie; vgl. ‚konservativ‘ gemsnnte
Argumentationsmuster).
Spirit
of Ecstasy – Glückseeligkeit]
Manche Menschen (nicht allein KünstlerInnen)
leben durchaus nach einer, kleinkindlichen bis vernünftigen, Variante der
Denkform: 'My frame of reverence is ecstasy', in der Nähe voller, ungetrübter
Lebensfreude. Und na klar konnt auch ihnen so manches Mal so manches quer, bis
dazwischen. – Ob kausaler- bis notwendiger- oder gar schuldhafter- respektive
kognitiverweise kommt es wesentlich(er)
auf den Umgang mit den Änderungsmöglichkeiten an (deren
Existenz oder Zugänglichkeit bzw. Nützlichkeiten zu bestreiten/negieren oder
verbieten zu s/wollen, gehört zu den
gängigsten und wichtigsten Fremdbestimmungsmitteln/der Heteronomie; vgl. ‚konservativ‘ gemsnnte
Argumentationsmuster).
 Ein weiterer sehr wesentlicher Gesichtspunkt bis
Einwand bleibt allerdings, dass des/der Menschen Erlehen
nicht allein, und nicht ausschließlich,
von einem/sich selbst beeinflusst wird – denkbare
und insbesondere erreichbare Optima, gar auch Minima, also eher begrenzt sein werden bzw. mit dem jeweiligen Umgang damit
zusammenhängen, respektive zeitlich und/oder eingeschränkt erscheinen können, bis dürfen.
Ein weiterer sehr wesentlicher Gesichtspunkt bis
Einwand bleibt allerdings, dass des/der Menschen Erlehen
nicht allein, und nicht ausschließlich,
von einem/sich selbst beeinflusst wird – denkbare
und insbesondere erreichbare Optima, gar auch Minima, also eher begrenzt sein werden bzw. mit dem jeweiligen Umgang damit
zusammenhängen, respektive zeitlich und/oder eingeschränkt erscheinen können, bis dürfen. ![]()
Rine der Hauptschwierigkeiten des geläufigen, dummen Umkehrschlusses ‚sich gut zu fühlen zu haben‘ ist übrigens nicht nur (gar ursächlich?) mit der Omnipräsenz der 'think positiv and feel good!'-Illusionen, sondern auch mit jener ‚Messlogik von Körperfunktionen‘ verbunden, die etwa ‚Zögern‘ oder gar ‚Nachdenken‘ für Indikatoren der leichtfertig mit ‚Aufrichtigkeiten‘ verwechselten Spontanität gleichsetzt.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dabei eröffnet die Beachtung
der gar analytisch rotabschreckenden
Rationalität in bzw. zu ‚innersten‘, eigenen Bewusstheiten Wahrnehmungen der
Nicht-Singularität jener Mittel / ‚Pferde‘ (R.O.-B.'s)
über die ein bzw. der Mensch (als ‚Kutscherin‘ bzw. ‚Kutscher‘ des jeweiligen Lebens gar namens ‚ich‘)
zu verfügen befähigt bis berechtigt ist/wird. So
vermögen manche Leute, hier, mit Georg Pennington, der tendenziellen Einsicht/Erfahrung jener bereits akrobatischen Analogie zu
folgen: ‚Dass je beweglicher jemand mental (mit/in
der Hand) ist oder wird, desto stabiler vermag dieser Mensch seine
Emotionen (des Kochlöffels Schwerpunkt droben)
balanciert zu halten‘.  [Sie kann wohl kutschieren – doch zu s/wollen reicht
ja selten, bis allein nicht, ganz hin]
– Leider eignet 'sich'
auch diese Analogie prompt wi(e)der zur Verwandlung in eines der omnipräsenten,
beleidigenden Vorwürfemuster, mittels Umkehrschlussfolgerung
der Belehrungspopularität: (Zudem bereitwillig für grundsätzlich/allgemein schlecht bis böse erklärte) emotionale
Instabilitäten seien der alternativerklärungslose
Beleg oder Preis respektive die folgerichtige Strafe
für unzureichende – sprich:
‚widernatürliche‘ bis ‚schuldhafte‘ – mentale Unbeweglichkeit,
Engstirnigkeiten pp. gar um uns brav von der komplimentären Alternativen-Mehrzahl
abzulenken/fernzuhakten?
[Sie kann wohl kutschieren – doch zu s/wollen reicht
ja selten, bis allein nicht, ganz hin]
– Leider eignet 'sich'
auch diese Analogie prompt wi(e)der zur Verwandlung in eines der omnipräsenten,
beleidigenden Vorwürfemuster, mittels Umkehrschlussfolgerung
der Belehrungspopularität: (Zudem bereitwillig für grundsätzlich/allgemein schlecht bis böse erklärte) emotionale
Instabilitäten seien der alternativerklärungslose
Beleg oder Preis respektive die folgerichtige Strafe
für unzureichende – sprich:
‚widernatürliche‘ bis ‚schuldhafte‘ – mentale Unbeweglichkeit,
Engstirnigkeiten pp. gar um uns brav von der komplimentären Alternativen-Mehrzahl
abzulenken/fernzuhakten?
|
Aus einem, von lateinischen /ex/ als 'heraus' und /motio/ als 'bewegen', 'erregen' bzw. /emovere/ 'sich herausbewegen' her kommenden, Verständnis von Emotionen als energetischen Phänomenen ergibt sich quasi bereits/noch vor-pdychologisch eine ganze Stufenreihe / Treppe von Hinderungs- bzw. Unterdrückungsfolgen derselben. |
|
|
Weitereseits bis psychologisch bleibt allerdings anzumerken bis einzuwenden oder aber komplimentär: |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() ‘Thomas
Theorem-door and -windows‘: «Things people think are real, are real – in their consequences.» Ihre/Diese Schlossbegleiterin übersetzt das
gesellschaftswisseschaftliche Grundtheorem emirischer Forschug/en präzisierend:
«Dinge und Erreignissem die Mensche für wirklich halten, haben Wirklichkeit/en
beeinflussende bis erschaffende verhaltensfaktische Auswirkungen.»
‘Thomas
Theorem-door and -windows‘: «Things people think are real, are real – in their consequences.» Ihre/Diese Schlossbegleiterin übersetzt das
gesellschaftswisseschaftliche Grundtheorem emirischer Forschug/en präzisierend:
«Dinge und Erreignissem die Mensche für wirklich halten, haben Wirklichkeit/en
beeinflussende bis erschaffende verhaltensfaktische Auswirkungen.»

Die Thomas-Theorem-Tür
verbindet mit und trennt vn ![]() dem Roten Salon des
Analysen, sowohl intersubjektiv für gegeben
gehaltener, als auch subjektiv gegebener Vorfindlichekeiten, ohne davon – oder
gar daziwichen – trenne zu können.
dem Roten Salon des
Analysen, sowohl intersubjektiv für gegeben
gehaltener, als auch subjektiv gegebener Vorfindlichekeiten, ohne davon – oder
gar daziwichen – trenne zu können.
Die Thomas-Theorem-Fester verbinden mit der/von der großen Terrasse menschlicher Nicht-Alleinheiten 'über', bis 'in' allen Räumen übergaut..Ob die Wahrehmungs-Vorhänge des/der Anderheite/n nun gerade geöffet oder geschlossen respektive wie (un)durchsichtig (etwa: belebte/unbelebte, physiologische/mentale) Objekte und/oder (beispielsweise: historische, kulturelle, personale, idividuelle) Subjekte etc. auch immer erscheien mögen.
[ganz schwarzer Raum]
Etwas an Regina Obermayr-Breutfuss angelehnt, steht uns Menschen ein ganzes Gespann (über Kategorien wie 'innere' und 'äußen' hinweg bzw. hinaus interverierter/'zusammenhängender' Möglichkeiten) an sehr unterschiedlichen 'Pferden' zur Seite/Verfügung unseres Verhaltens:
 Die/meine
Intuition/en (etwa vom Ästhetischen
bis - nicht unbedingt nur/rein 'spirituellen'
- Ganzen herab meine kreativen Phantasien und emphatischen Resonanzen
berührt);
Die/meine
Intuition/en (etwa vom Ästhetischen
bis - nicht unbedingt nur/rein 'spirituellen'
- Ganzen herab meine kreativen Phantasien und emphatischen Resonanzen
berührt);
mein Verstandesdenken (jenes anderer bis immerhin potenziell/intersubjektiv jenes aller Menschen nicht unbedingt völlig ausschließend, oder eines wegen seiner/der Abweichungen bis Unvereinbarkeiten diffamierend):
meine Gefühle (etwa instinktive Wohl- bzw. Unwohlheiten, Körpergefühle, Lusst- bzw. Unlusstempfinfungen pp. inklusive - auch solche von Ärger/Wut, Aggression, Schuld oder Zorn/Würde bzw. Sposiringbedürfnisse),
meinen (insbesondere durch es-immerhin-Lernen-Können qualifizierten) Willen;
meine (mehr oder minder reflektierten bzw. als alternativlos verselbstveratändlichten) Vorstellungen (namentlich Horizonte der Ängste, Erwarzuingen bis Erfahrungen, Sinnstifrungen und Hoffnungen);
meine physiologischen und sozio-kulturellen Ausstattungen (Ideocharismen und Trainings) bzw. Einflüsse;
meiner bis der
Bewusstheit/Bewusstwerdung ... ![]() .
.
Was aber/allerdings spätestens unterwegs mit nicht selten widerholten Zuständen/Prizessen der Ungewissheit/en verbunden bleibt (zumineest) bis das (fientische) Geschehen (in seinem historischen Detail pder sogar Insgesammt) gezeigt haben wird was/wer daran wie 'wahr'/'stimmig' wo 'angekommen'/begindlich sein wird. - Wer also verhaltensfaktisch (letztlich zwar unausweichlich doch durchaus verschieden gestaltbar) mehr oder minder für bzw. gegen den 'Ratschlag' einer oder meherer dieser 'inneren Beratungsinstanzen' handelt, muss bereits daher nicht allzu übberrascht von/über deren Einwendungen sein/werden - zumal falls/wo 'sich' auf dem Wege (erwartetete und/oder gleich gar unerwartete) Schwierigkeiten respektive Chancen einstellen/eröffnen.
Gar
verhaltensentscheidendend an den hier häufig vorherrschenden Irrtümmern ist
wohl insbesondere, dass reduziernde Konzentration
auf eines äh das (einzig/vorgeblich)
entscheidene der Elemente/Mittel nicht 'allein'
alle anderen entwürdigend auszublenden drohl bis /verstummen/rauschen läßt,
sondern insbesondere auch das ohnenln so, namantlich Egoismus, verdächtige '(gleich gar 'bewusst' genannte bis darauf begrenzte)
ich' außen vor zu lassen bzw. zu umgehen respektive von allen
Entscheidungsverabtwortungen zu entlasten -
allerdings nur (und folglich mit entsprechend großem Übberraschungs- und
Frustrationspotenziaö) - scheint.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
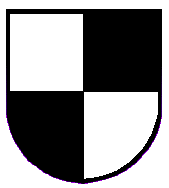 'Schlechtes',
gar soingularisiert bzw. personifiziert: 'das Böse', gehe - in Anlegnung an Formulierungen von Nnim Arichpel
Gulag - 'quer duch des/jedes Menschen Herz/Innerestes(Psyche' und
erscheint respektive ist paradoxerweise als 'Böses'
psychologisch (zumal mit und seit
popularisiertem Freudianismus) 'leichter'/eher erklärlich als 'Gutes', oder gleich gar 'das Gute'.überhaupt. - Nur
bleibt dies(e Validität / solchen metodischen
Vorgehens Gültigkeit) sowohl hinter dem Anspruch (eines absoluten Existenznachweises - immerhin der Ambivalenzthese
Gottes, wenigsrens aber alles oder des Menschen Wirklichen) als auch
hinter dem Irrtum, damit/so 'das Böse' zu verstehen bis zu beherrschen, zurück.
'Schlechtes',
gar soingularisiert bzw. personifiziert: 'das Böse', gehe - in Anlegnung an Formulierungen von Nnim Arichpel
Gulag - 'quer duch des/jedes Menschen Herz/Innerestes(Psyche' und
erscheint respektive ist paradoxerweise als 'Böses'
psychologisch (zumal mit und seit
popularisiertem Freudianismus) 'leichter'/eher erklärlich als 'Gutes', oder gleich gar 'das Gute'.überhaupt. - Nur
bleibt dies(e Validität / solchen metodischen
Vorgehens Gültigkeit) sowohl hinter dem Anspruch (eines absoluten Existenznachweises - immerhin der Ambivalenzthese
Gottes, wenigsrens aber alles oder des Menschen Wirklichen) als auch
hinter dem Irrtum, damit/so 'das Böse' zu verstehen bis zu beherrschen, zurück.
Zudem wurde und wird nicht
nur versucht Antriebe (die Reize
'beiderlei polarisierter'/aller Arten) reduktionistisch zu
Verabsolutieren, sondern auch ('die' einen wie
'die' anderen - wenn auch/prompt meist brav je wechselseitig bis exklusiv
zuweisend), empirisch erscheinend,
zu bestreiten, und (auf einem/als Höhepunkt
der Gehorsamsunterwerfungsfoderung) gar die Negation(sfreiheit,
das 'Nein' - vom verheisenden LO àì
über imperatives AL ìà bis mit
Alef orthographiertem AjiN ïéà 'Auge'
gar qualifizierten 'Nichts') 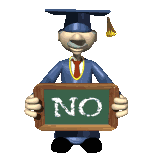 höchst
Selbst
für ursächlich / verantwortlich für alles Übel zu ... Sie wissen wohl schon.
höchst
Selbst
für ursächlich / verantwortlich für alles Übel zu ... Sie wissen wohl schon.
Jeder Antrieb, gar JeTZeR øöé
ist – bereits und signifikant im Vergleich und
heteronomisierten Unterschied mit antikem griechischen Philosophieren: über / von
Thymos – so gehorsam in die (ordnungs)bedrohlichen
Deutungsecken des Aggressionsfeldes und verschändlichter Gier abgedrängt, dass sogar Fachlexika, mit
einer Beobachtung P.S.s,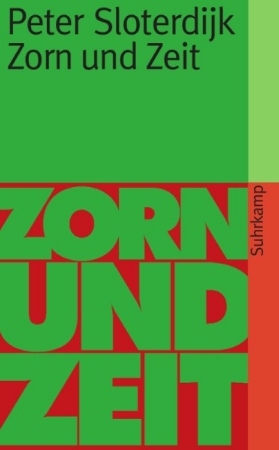 so sie das Schlagwort ‚Zorn‘ (zumal als eine der – ebenso verstellten/verbotenen
– vordergründigen Formen ausgerechnet
von Würde) überhaupt noch
enthalten, sofort auf diesen alphabetischen (angeblichen)
Anfang (des für schlecht zu
haltenden Individuums Mensch) verweisen – und manche wesentliche Verhaltensaspekte ‚unverständlich
machen‘, nein eher verfehlend umdeuten/vernutzen
(lassen oder wollen, bis tun).
so sie das Schlagwort ‚Zorn‘ (zumal als eine der – ebenso verstellten/verbotenen
– vordergründigen Formen ausgerechnet
von Würde) überhaupt noch
enthalten, sofort auf diesen alphabetischen (angeblichen)
Anfang (des für schlecht zu
haltenden Individuums Mensch) verweisen – und manche wesentliche Verhaltensaspekte ‚unverständlich
machen‘, nein eher verfehlend umdeuten/vernutzen
(lassen oder wollen, bis tun).
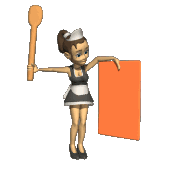 Wenn
wir uns andere Menschen – genauer
deren (als solche bei uns ankommende) Verhalten(sauswirkungen) -
überhaupt erklären, erklären wir sie uns (mit
P.S. 'seit Marx und Freud') entweder als gierige, sexistisch( genverbreitend)e Habenwoll-Moster
oder sonstwie (gleich gar großzügig,
verschwenderisch, allbeglückend) eben stehts unangemessen
stolz-arrogante uns Üebl wollende, bis es zumindest bereits/hinderlich (erst recht 'wohlmeinend') tuende, Wesen (die [daher, zudem im allgemeinen Intersse, des
Ganzen] endlich einmal etwas mehr zu demütigen/Unterwerfen wären) –
deren (zudem 'für [achtsame] Liebe gehaltene')
Aufmerksamkeit nicht endlich ungeteilt allein mir,
äh dem Absoluten,
(logischer und natürlicher) Notwendigen des
Reinen, Schönen und Wahren,
sonderen unverschämter- äh vermischterweise
(zumindest 'auch' wo nicht 'immer nur') sich selbst, gilt. - Kommen gleich gar noch (wahrgenommene – vozugsweise 'vermeintliche')
Besonderheiten (der Individualität/en bis
Identität, namentlich des Aussehens oder Erklingens respektive Tuns bzw.
Unterlassens – eben all des sich Empfangenden derart betreffend eindrückenden Ausdrzcks) hinzu oder (gar all dem zu)vor, bedarf jedenfalls der
omnipräsente Arroganzvorwurf ohnehin keiner(lei /
weiterer) Belege/Rechtfertigung.
Wenn
wir uns andere Menschen – genauer
deren (als solche bei uns ankommende) Verhalten(sauswirkungen) -
überhaupt erklären, erklären wir sie uns (mit
P.S. 'seit Marx und Freud') entweder als gierige, sexistisch( genverbreitend)e Habenwoll-Moster
oder sonstwie (gleich gar großzügig,
verschwenderisch, allbeglückend) eben stehts unangemessen
stolz-arrogante uns Üebl wollende, bis es zumindest bereits/hinderlich (erst recht 'wohlmeinend') tuende, Wesen (die [daher, zudem im allgemeinen Intersse, des
Ganzen] endlich einmal etwas mehr zu demütigen/Unterwerfen wären) –
deren (zudem 'für [achtsame] Liebe gehaltene')
Aufmerksamkeit nicht endlich ungeteilt allein mir,
äh dem Absoluten,
(logischer und natürlicher) Notwendigen des
Reinen, Schönen und Wahren,
sonderen unverschämter- äh vermischterweise
(zumindest 'auch' wo nicht 'immer nur') sich selbst, gilt. - Kommen gleich gar noch (wahrgenommene – vozugsweise 'vermeintliche')
Besonderheiten (der Individualität/en bis
Identität, namentlich des Aussehens oder Erklingens respektive Tuns bzw.
Unterlassens – eben all des sich Empfangenden derart betreffend eindrückenden Ausdrzcks) hinzu oder (gar all dem zu)vor, bedarf jedenfalls der
omnipräsente Arroganzvorwurf ohnehin keiner(lei /
weiterer) Belege/Rechtfertigung.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Na klar wurde und wird (hier
oben brav auch äh allein) die Psychologie zur/als höchste/n Königin
der Wissenschaften ausgerufen. Alles Empfinden bis Verhalten habe ihr bekanntlich diese, bis unsere, Reverenz,
berrits (gar eher unartige) selbstreferenziell (soziopatologisiert) und/oder als Bezogenheit auf Anderes bis
Referenz an Andere oder von i/Ihnen, auszudrücken. 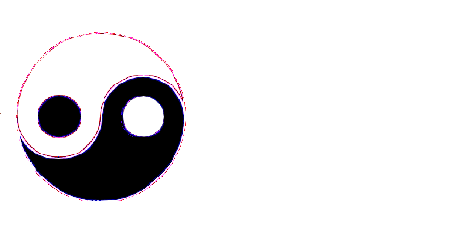
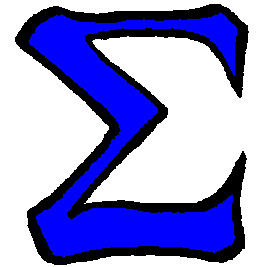 Was
und wie Gewahrsein respektive Aufmerksamwerden, oder gar Bewusstheiten
überhaupt sind, wissen wir Menschen definitiv/überhaupt nicht - noch
nicht einmal welche Wissenschaft dafür zuständig sei (also wären es bestebfalls alle und keine davon alleine).
wir Menschen sind/werden immerhin anscheinend (und zumindest exemplarisch, bis sogar individuell singulär)
durchaus daran (nicht unbedingt nur 'passiv',
'empfangend' verstanden) beteiligt.
Was
und wie Gewahrsein respektive Aufmerksamwerden, oder gar Bewusstheiten
überhaupt sind, wissen wir Menschen definitiv/überhaupt nicht - noch
nicht einmal welche Wissenschaft dafür zuständig sei (also wären es bestebfalls alle und keine davon alleine).
wir Menschen sind/werden immerhin anscheinend (und zumindest exemplarisch, bis sogar individuell singulär)
durchaus daran (nicht unbedingt nur 'passiv',
'empfangend' verstanden) beteiligt.
Auch was Persöblichkeit ist/ausmacht,
wissen wir nicht. - Allenfalls, dass Psychologie nicht all(ein)zuständig ist (Wahrheits-, äh Wirklichkeits-)Aussagen
darüber zu machen/finden.![]()
 'Posotiv, optimistisch versus äh anstatt
pessimistisch, negativ' - gleich gar un der
omnipräsenten sei-spontan- oder als Schuldtreue-Variante:
'Gut oder Böse/Schlecht' - sind/werden trügerische bis falsche
Denkformen des und zum (motivationalen Antreibens, bis gleich gar überwindenden)
Duchhalten/s.
'Posotiv, optimistisch versus äh anstatt
pessimistisch, negativ' - gleich gar un der
omnipräsenten sei-spontan- oder als Schuldtreue-Variante:
'Gut oder Böse/Schlecht' - sind/werden trügerische bis falsche
Denkformen des und zum (motivationalen Antreibens, bis gleich gar überwindenden)
Duchhalten/s.
Das Thomas-Theorem, eine wuchtuge Grundeinsicht jendenfalls sozialwissenschaftlicher Forschung, ist/wird spätdestens ab (dieser Modalität) hier, wo nicht bereits soziobiologisch, relevant für überhaupt kognitionsfähige Wesen(heiten).
Die therapeutischen Changcen und zuminfdest Ansprüche welt(en)- selbst- und andere-handhabender Theologie bzw. Philosophie, bis des und gerade/sogar Ihres Denkens (auch im engeren, längst nicht etwa allein 'noetischen', Sinne) überhaupt, konfligieren, bis kooperieren, spätestens mit/auf dieser modalen 'Ebene' des/der Möglichen.
Richtig (bis - zumal doch nicht allein entwicklungs-
und sozialpsycho-logisch wichtig) ist
auch, dass sich das Psychische (allerdings auch das Analytische und die historisch-gegebene
Erfahrung überhaupt) in dieser Modalitätenreihenfolge ![]() zwar - insofern sogar 'baulich'/architektonisch zutreffend/begründbar - im 'vorsprachlich'
nennbaren Bereich des
Wissbaren, dieseits des Ahnenssaals der Semiotiken
befindet, doch gerade - wie die Zofe zeitgenösischer Philosophie,
der Ausdrücke Bedeutungen analysierend, zeigen könnte bis kann
- daher, insbesonder pre-, post- und metaverbaler, Ausdrucks- ja (Selbst-)Verständigungsmittel und Syymboliken
benötikt (die nicht irgendwie völlig und ganz
jenseiuts vom konzeptionellen Denken/Empfinden
'verbleiben' bzw. nicht irgendwie kommunikationsfrei und interaktionslos
'bewusst' dasein/werden
können).
zwar - insofern sogar 'baulich'/architektonisch zutreffend/begründbar - im 'vorsprachlich'
nennbaren Bereich des
Wissbaren, dieseits des Ahnenssaals der Semiotiken
befindet, doch gerade - wie die Zofe zeitgenösischer Philosophie,
der Ausdrücke Bedeutungen analysierend, zeigen könnte bis kann
- daher, insbesonder pre-, post- und metaverbaler, Ausdrucks- ja (Selbst-)Verständigungsmittel und Syymboliken
benötikt (die nicht irgendwie völlig und ganz
jenseiuts vom konzeptionellen Denken/Empfinden
'verbleiben' bzw. nicht irgendwie kommunikationsfrei und interaktionslos
'bewusst' dasein/werden
können).
Was Träume sind, auch das wissen wir nicht - und deren (wenigstens und immerhin parzielle – teils auch etwas über Freud, Jung & Co. oder archetypische Topoi hinausgewacjsene) Deutungen, nis Beeinflussbarkeiten, ändern daran nichts Wesentliches.
Bemerkenswert unabhängig davon, was (allerdings konsequent – anstatt etwa 'beliebig') jeweils so, und wie es gerade, genannt wird:
[Abb. Empirische Entblösung (selbst/gerde der Wikipedia; comp. 'How to curtsy') ... ]
 «Ob (bis
gegebenfalls wie) Bewusstheit(en)
respektive Bewusstwerden aus Nichtbewusstsein, respektive gar aus bis
trotz Nichtbewusstwerden, entstehen - wissen
wir (ausgerechnet empirisch – bereits deshalb 'noch immer') nicht '('weil'/denn deren Existenz geht allem – dennoch - unserem Beobachten auch
dann voraus, wenn wir es wenigstens scheinbar
zunächst an technische Geräte, bis Systeme,
deligieren und/oder, immerhin für
'allgemein' halten, intersubjektivieren).»
«Ob (bis
gegebenfalls wie) Bewusstheit(en)
respektive Bewusstwerden aus Nichtbewusstsein, respektive gar aus bis
trotz Nichtbewusstwerden, entstehen - wissen
wir (ausgerechnet empirisch – bereits deshalb 'noch immer') nicht '('weil'/denn deren Existenz geht allem – dennoch - unserem Beobachten auch
dann voraus, wenn wir es wenigstens scheinbar
zunächst an technische Geräte, bis Systeme,
deligieren und/oder, immerhin für
'allgemein' halten, intersubjektivieren).»
[Abb.... bringt gar unterm Rock zum Vorschein: Ein rotes
Strumpfband analytischer Modalität (gar
alternierende Peinlichkeit aller Theorien) ist und
war droben ontologisch bereits 'vorher', wenigstens aber notwendigerweise zu
der Beobachtung, da.]
Some images by a
courtesy of webshots.com and some ©
copyright by hohenzollern.com
|
Sie haben die Wahl: |
||||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
Goto project: Terra (sorry still
in German) |
|
|||
|
Comments and
suggestions are always welcome (at webmaster@jahreiss-og.de) Kommentare und Anregungen sind jederzeit willkommen (unter: webmaster@jahreiss-og.de) |
|
||||
|
|
|||||
|
|
|
||||
|
|
|
|
|||
|
|||||
|
by |