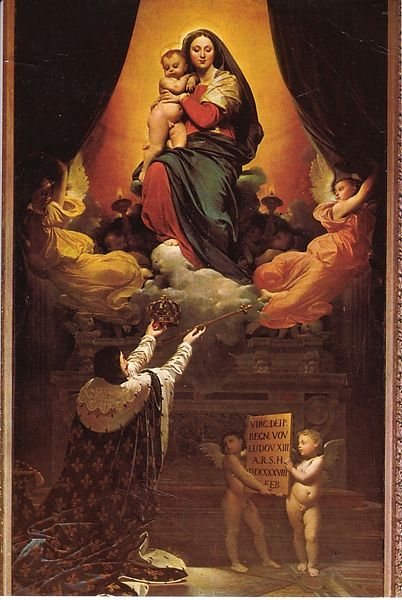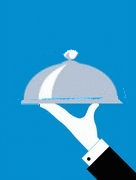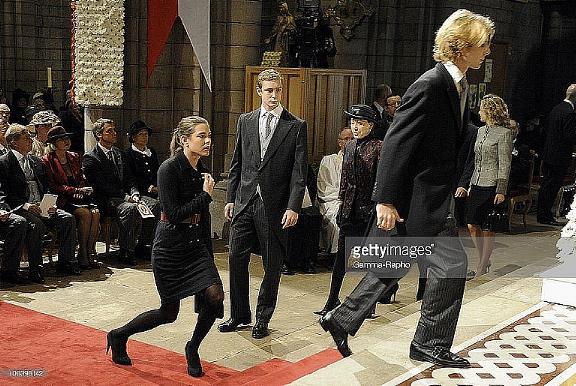|
|
Zumal (oh Schreck) zivilisatorische
|
Gegen/Von ‚Osten‘ an der 25 Meter breiten Hauptein- /
Ausgangswand und (s)einer Stirnseite, über dem (1797 ‚entfernten‘) Thronegestühl auf dem
Podest / Tribuna des 54 Meter langen, großen Ratssaales / Sala
del Maggior Consiglio der Seeneis(s)ima Venezia, befindet sich eines der wohl
grossflächigsten Ölgemälde überhaupt: ![]() Tintorettos (Werkstatt um 1588 entstammende: ‚Himmlische Heerscharen im) Paradies‘ (7 x 24 m), ‚eigentlich‘ und
hauptsächlich ‚die Krönung der (also welcher?) Jungfrau‘ zeigend/meinend, wo – auch schon vor dem Brand von 1577 – der/dieser entscheidenden ‚irdischen
(Rats-)Versammlung‘
der
Tintorettos (Werkstatt um 1588 entstammende: ‚Himmlische Heerscharen im) Paradies‘ (7 x 24 m), ‚eigentlich‘ und
hauptsächlich ‚die Krönung der (also welcher?) Jungfrau‘ zeigend/meinend, wo – auch schon vor dem Brand von 1577 – der/dieser entscheidenden ‚irdischen
(Rats-)Versammlung‘
der  ‚Adelsrepublik‘/Nobilòminioligarchie, semiotisch/abgebildet, wesentlich(st)e Themen[vorstellungsspektren]
‚Adelsrepublik‘/Nobilòminioligarchie, semiotisch/abgebildet, wesentlich(st)e Themen[vorstellungsspektren]  erinnernd gegenüber, und –
bis an die, sowie von der, ‚überhimmlischen Decke‘ – höher darüber, gestellt sind, äh waren und zumindest jenen, die davon bemerken, bis ‚betroffen essen‘ wollen, erhalten blieben.
erinnernd gegenüber, und –
bis an die, sowie von der, ‚überhimmlischen Decke‘ – höher darüber, gestellt sind, äh waren und zumindest jenen, die davon bemerken, bis ‚betroffen essen‘ wollen, erhalten blieben.
‚Ein‘, bis das, ‚Motiv‘ (gar
Beweggrund / Movens) / Topos/ / Vorstellungskonzept 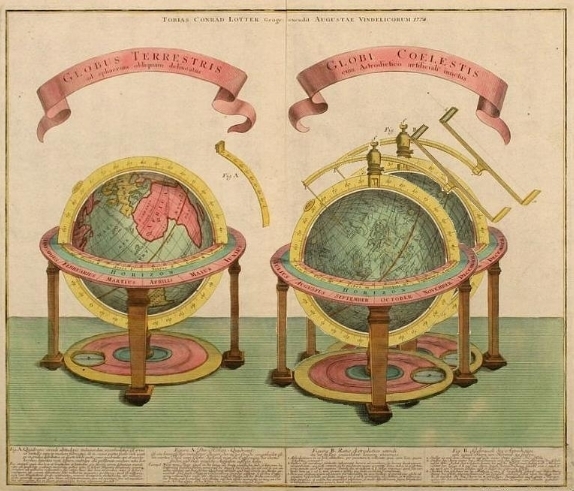 dessen –
nein ‚deren‘ (zu oft Miss-)Verständnisse,
Verwendungen und Beanspruchungen weiter von wesentlichen
Bedeutungen/Auswirkungen sind, waren und (gewesen sein) werden – also gerade nichts
singuläres/einziges ('wären'/bleiben):
dessen –
nein ‚deren‘ (zu oft Miss-)Verständnisse,
Verwendungen und Beanspruchungen weiter von wesentlichen
Bedeutungen/Auswirkungen sind, waren und (gewesen sein) werden – also gerade nichts
singuläres/einziges ('wären'/bleiben):
 So
versteift ‚sich‘/anderen mache (im
weitesten, nicht allein individuelle oder ‚natürlich‘
genanngten Wortsinne) Person/en auf
Verloren-Sein/Gehen, bis Wieder-zurück-Suchen/Holen (vgl.
latinisiert ‚re-ligion‘– oder sogar/immerhin neu, dawider, oder überhaupt, vgl.
‚legion‘, Finden)-S/Wollen:
So
versteift ‚sich‘/anderen mache (im
weitesten, nicht allein individuelle oder ‚natürlich‘
genanngten Wortsinne) Person/en auf
Verloren-Sein/Gehen, bis Wieder-zurück-Suchen/Holen (vgl.
latinisiert ‚re-ligion‘– oder sogar/immerhin neu, dawider, oder überhaupt, vgl.
‚legion‘, Finden)-S/Wollen:
 und zwar nicht etwa allein, oder eindeutig, des
Gartens (in/aus [Richtung]) Eden /gan beden/ oder eines פרד״ס PaRDeS , äh Paradieses (selbst
falls, und gerade wo. damit nicht ausschließlich beeindruckend, betörend-[ver]führende,
bis magische, ‚Wundergartentierparkanlagen‘ – zumal
vorgeblicher ‚Naturbelassenheiten‘ anstelle/als assyrische/nimrodischer Herrschaftskulturalismen,
dieser [Namens- bis Denk-]Herkunft
– sondern auch, bis überhaupt, ‚Vorstellungenkonzeptevielfalten‘.
und zwar nicht etwa allein, oder eindeutig, des
Gartens (in/aus [Richtung]) Eden /gan beden/ oder eines פרד״ס PaRDeS , äh Paradieses (selbst
falls, und gerade wo. damit nicht ausschließlich beeindruckend, betörend-[ver]führende,
bis magische, ‚Wundergartentierparkanlagen‘ – zumal
vorgeblicher ‚Naturbelassenheiten‘ anstelle/als assyrische/nimrodischer Herrschaftskulturalismen,
dieser [Namens- bis Denk-]Herkunft
– sondern auch, bis überhaupt, ‚Vorstellungenkonzeptevielfalten‘.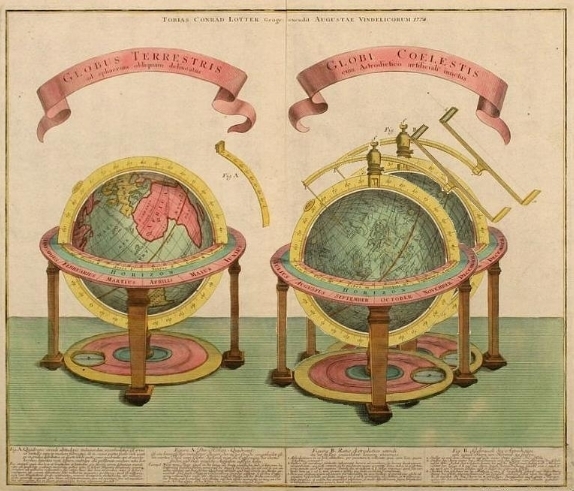 bezeichnet/gemeint, bis betreffend gefunden ...).
bezeichnet/gemeint, bis betreffend gefunden ...).
 Was nicht selten, bis sogar kaum verhinderlich, vor
zumal erwünschten und möglichen (gleich
gar zivilisatorischen/überformbaren – nicht allein
Was nicht selten, bis sogar kaum verhinderlich, vor
zumal erwünschten und möglichen (gleich
gar zivilisatorischen/überformbaren – nicht allein ![]() ‚schlaraffenlämdischen‘
oder immerhin ‚von Milch und Honig
überfließenden‘) Füllen steht/kommt, wie sie
immerhin seitens ‚der Tora[h]/Bibel, mit ‚G-ttesreich‘ und als ‚himmlischem Jerusalem‘, uudװaber
zwar ‚auf Erden‘/‚im Lande‘ הארץ /ha'eretz/ mit kostenlos unbegrenzter
Trinkwasserversorgung für alle (nicht etwa nur/immerhin ‚herab gekommen‘, auch ‚über die Sonne hinaus‘, ohne auf diesen/einen
Stern angewiesen/beschränkt zu sein/werden;
sowie keineswegs ohne Beiträge des
und der Menschen – eben in Unterschieden,
bis Widersprüchen,
zu/mit Maria/Venezia/Ekklesia im «Hortus
[conclusus] / ‚Paradisgerten‘ [umzäunten; ‚vergleiche‘/beachte den jüdischen ‚Zaun‘ der ‚Halacha/s(ordnung/en)
und [H/]Aggadot/[H]Aggadim(geschichtenberichte)
um‘ die Tora]» befindlich[e]/bewahrt[e
‚Urs turmia‘]) erahnbar,
bis ermöglichend versprochen ...
‚schlaraffenlämdischen‘
oder immerhin ‚von Milch und Honig
überfließenden‘) Füllen steht/kommt, wie sie
immerhin seitens ‚der Tora[h]/Bibel, mit ‚G-ttesreich‘ und als ‚himmlischem Jerusalem‘, uudװaber
zwar ‚auf Erden‘/‚im Lande‘ הארץ /ha'eretz/ mit kostenlos unbegrenzter
Trinkwasserversorgung für alle (nicht etwa nur/immerhin ‚herab gekommen‘, auch ‚über die Sonne hinaus‘, ohne auf diesen/einen
Stern angewiesen/beschränkt zu sein/werden;
sowie keineswegs ohne Beiträge des
und der Menschen – eben in Unterschieden,
bis Widersprüchen,
zu/mit Maria/Venezia/Ekklesia im «Hortus
[conclusus] / ‚Paradisgerten‘ [umzäunten; ‚vergleiche‘/beachte den jüdischen ‚Zaun‘ der ‚Halacha/s(ordnung/en)
und [H/]Aggadot/[H]Aggadim(geschichtenberichte)
um‘ die Tora]» befindlich[e]/bewahrt[e
‚Urs turmia‘]) erahnbar,
bis ermöglichend versprochen ... (noch weitgehend unbekanntes, und vor allem unaussprechliches, Laut[zahl]zeichen
/otijot/ - hier stellvertretend geschriebene
/taw/-Variable für ‚unsichtbar-sichtbare‘, bis ‘unknown unknowns‘, Weltwirklichkeiten. noch ausstehender Begrifflichkeiten-Konzepte und – gar
auch ‚neue Schöpfung‘ pp. genannte – Vorfindlichkeiten damit/daraus/dafür).
(noch weitgehend unbekanntes, und vor allem unaussprechliches, Laut[zahl]zeichen
/otijot/ - hier stellvertretend geschriebene
/taw/-Variable für ‚unsichtbar-sichtbare‘, bis ‘unknown unknowns‘, Weltwirklichkeiten. noch ausstehender Begrifflichkeiten-Konzepte und – gar
auch ‚neue Schöpfung‘ pp. genannte – Vorfindlichkeiten damit/daraus/dafür). 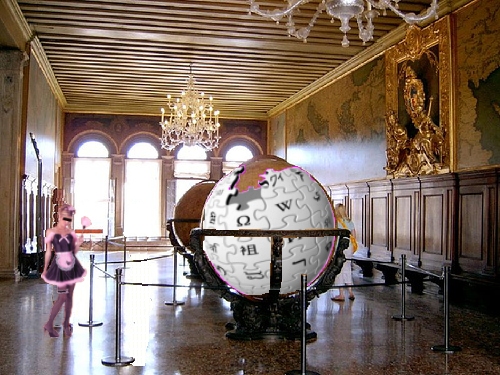 – Sofern/Jedenfalls wo nicht (mehr – philosophisch/theologisch gar
substanzbegrifflich verwendet) unterstellend, äh treu/authentisch
festhaltend überzeugt, angenommen/gewollt/gesollt wird, «selbst (schon/endlich)
jenes ‚wahre, eigentliche, einzige, himmlische, verheißene pp. ewig-goldene‘ Jerusalem zu sein / ererbt, bis ersetzt, und es inne, zu
haben», wie (schon,
äh zumindest – nein, ja: nur) das ehemalige Staatswesen Venedig dies, sein/ein
Jahrtausend lang – (emblematisch) wohl am Deutlichsten bereits in/mit den Mosaiken der
‚Dogenbasilika‘ von San Marco – verhaltensfaktisch dabei allerdings und übrigens
zeitweise etwas weniger judenfeindlich,
bis gar muslimefreundlicher, als die meisten übrigen Christen(heiten) – tat. Gerade derartiger
(kulturalistischer,
bis durchaus zivilisatorischer, namentlich wi[e]dergeborener
Neuschöpfungs-, äh Neuordnungs-)Anspruch, als mindestens/immerhin virtualita (‚im/als
Glauben[süberzeugtheiten / Hoffnungsgewissheit] vorwegnehmend‘) machtgestützt erfüllt – steht so
mancher Vollendung eben logisch
notwendigerweise – sowohl seiner/ihrer (da
ja bereits für eingetreten gehaltenen) Erfüllung, als auch mancher Erkennbarkeit seiner/ihrer (noch
immer / längst noch, bis auf diese Weisen überhaupt) nicht Erfülltheit – im Wege (
– Sofern/Jedenfalls wo nicht (mehr – philosophisch/theologisch gar
substanzbegrifflich verwendet) unterstellend, äh treu/authentisch
festhaltend überzeugt, angenommen/gewollt/gesollt wird, «selbst (schon/endlich)
jenes ‚wahre, eigentliche, einzige, himmlische, verheißene pp. ewig-goldene‘ Jerusalem zu sein / ererbt, bis ersetzt, und es inne, zu
haben», wie (schon,
äh zumindest – nein, ja: nur) das ehemalige Staatswesen Venedig dies, sein/ein
Jahrtausend lang – (emblematisch) wohl am Deutlichsten bereits in/mit den Mosaiken der
‚Dogenbasilika‘ von San Marco – verhaltensfaktisch dabei allerdings und übrigens
zeitweise etwas weniger judenfeindlich,
bis gar muslimefreundlicher, als die meisten übrigen Christen(heiten) – tat. Gerade derartiger
(kulturalistischer,
bis durchaus zivilisatorischer, namentlich wi[e]dergeborener
Neuschöpfungs-, äh Neuordnungs-)Anspruch, als mindestens/immerhin virtualita (‚im/als
Glauben[süberzeugtheiten / Hoffnungsgewissheit] vorwegnehmend‘) machtgestützt erfüllt – steht so
mancher Vollendung eben logisch
notwendigerweise – sowohl seiner/ihrer (da
ja bereits für eingetreten gehaltenen) Erfüllung, als auch mancher Erkennbarkeit seiner/ihrer (noch
immer / längst noch, bis auf diese Weisen überhaupt) nicht Erfülltheit – im Wege (![]() was zu bemerken lebensgefährlich bleibt).
was zu bemerken lebensgefährlich bleibt). 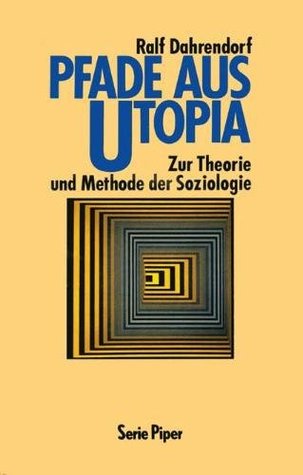
So ist/war es auch der Serenisima (zumal / ‚zumindest‘
zu Zeiten ihrer Existenzform[en] als ‚sich selbstständig verwaltendes Gemeinwesen‘, bis als ‚souveräner Staat‘) nicht gelungen, jenen
dichotomen Entweder-Oder-Entscheidungen-Gegensatz (vermeintlich sicher geborgener Gewissheit[sverteilung]):
(menschliche/s) Individualwesen
versus (überindividuelles,
bis übermenschliches) Sozialgebilde, qualifiziert aufhebend zu
überwinden / überformen,
dem auch Lord Ralf Gustavs
‚Hono Soziologicus‘ zeitweilig, in der Verzweckungs-Varainate: Institutionenfeindschaft, unterlag.  Institutioneller Verfahrensregelungs-
und Kontrollbedarf auch und sogar der / von Volkssouveränität wider beliebige Willkür (der/dieser Autorität)! [Erläuterung ‚eingestanden( protokolliert)en‘ Dazu- bzw. Umlernens seitens forschender
Menschen (selbst – nicht erst, bis/versus immerhin, Eurer Schülerinnen und
Schüler, zumal dererseits bigraphisch ebenfalls mit Institutionen konfrontiert) bzw. Textauszug #hier]
Institutioneller Verfahrensregelungs-
und Kontrollbedarf auch und sogar der / von Volkssouveränität wider beliebige Willkür (der/dieser Autorität)! [Erläuterung ‚eingestanden( protokolliert)en‘ Dazu- bzw. Umlernens seitens forschender
Menschen (selbst – nicht erst, bis/versus immerhin, Eurer Schülerinnen und
Schüler, zumal dererseits bigraphisch ebenfalls mit Institutionen konfrontiert) bzw. Textauszug #hier] ![]()
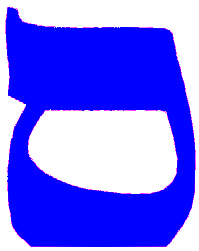
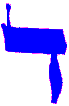
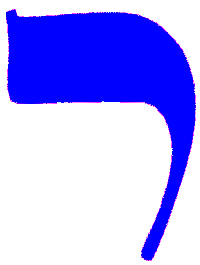
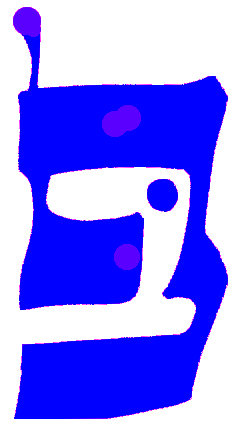
So bleiben aber auch die mindestens – immerhin allgemeiner bekannten (als etwa die sieben bis
mindestens 32 des ‚Nussgartens‘) – wenigstens vier (pe-resch-daled/t-ssamech) Verständnishüllen
und Verwendungsebenen (PaRDeS
– ‚bewahrter [Zitrus-Obst-]Garten‘, gar umzäunte [‚salomonisch‘] bis Lesartoption: ‚Festung‘ [bei Nehemia]) dessen, was immerhin
/taw/ geschreiben steht, weder verzichtbar(e) noch hinreichend(e Voraussetzungen
besserer Zukunft/en, bis gar Gegenwart/en). 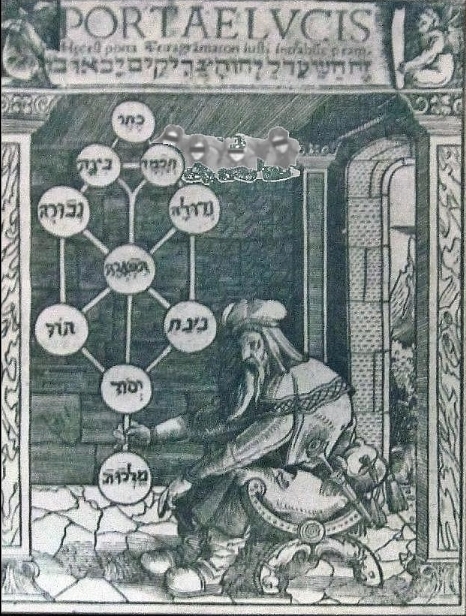 [Weder zureichende, noch irgendwie
‚paradiesische‘, Erläuterung/en bzw. Nennung dieser vier Christen und Juden,
jedenfalls bis zum Beginn der ‚Neuzeit‘, durchaus geläufigen ‚Goldäpfel‘, unerschöpflicher
Reichweitenblasenfirmamente hermeneutischer Mischungseinsichten.]
[Weder zureichende, noch irgendwie
‚paradiesische‘, Erläuterung/en bzw. Nennung dieser vier Christen und Juden,
jedenfalls bis zum Beginn der ‚Neuzeit‘, durchaus geläufigen ‚Goldäpfel‘, unerschöpflicher
Reichweitenblasenfirmamente hermeneutischer Mischungseinsichten.] 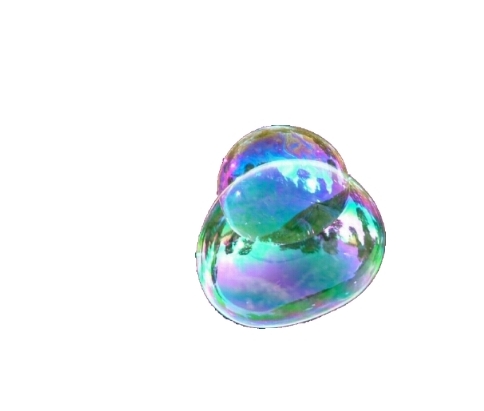 Im /
Beim «Garten köstlicher Worte», gehe es – mit Rabbi Lawrence
Kushner – sogar
darum, ‚wie‘ überhaupt alles, was Menschen
mindestens ‚wissen‘ sollten, bis ‚müssen‘, in
nur ‚wenigen‘ Büchern, jenen der Tora,
zu ‚stehen‘ vermag: Mehr als zu sehen, und
nicht einmal eines davon fällt / leuchtet immer allen überall gleichermaßen,
und/oder in miteinander verträglichen
Arten und Weisen, auf / ein.
Im /
Beim «Garten köstlicher Worte», gehe es – mit Rabbi Lawrence
Kushner – sogar
darum, ‚wie‘ überhaupt alles, was Menschen
mindestens ‚wissen‘ sollten, bis ‚müssen‘, in
nur ‚wenigen‘ Büchern, jenen der Tora,
zu ‚stehen‘ vermag: Mehr als zu sehen, und
nicht einmal eines davon fällt / leuchtet immer allen überall gleichermaßen,
und/oder in miteinander verträglichen
Arten und Weisen, auf / ein.
«Vor langer Zeit
erkannten unsere Lehrer, dass die Tora wie ein wunderschöner Obstgarten ist.
Aus der Entfernung sieht man nur ein Stück Land mit Bäumen. Wenn man näher
kommt, sieht man, dass jeder Baum Blätter, Blüten und Früchte trägt. Wenn man
noch näher kommt, stellt man fest, dass jede Frucht mit einer Haut bedeckt ist.
Und, wenn man nicht locker lässt und die Haut abstreift, ist ein köstlicher
Geschmack unser Lohn. Jetzt erkennst du, dass etwas, was zunächst nur ein Stück
Land voll mit Bäumen zu sein schien, tatsächlich Schicht für Schicht köstliche
Dinge birgt.» (La.Ku.) ![]()
‚Vorne‘ mit dem Pe/Fe-Laut- / -Ziffern-Zeichen 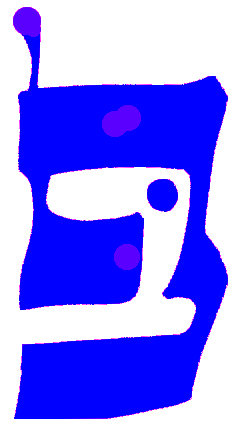 den otijot der Öffnung/en (jedenfalls des Alefbets), ‚äußerlich‘, ‚zuerst‘ an der ‚Oberfläche‘
dessen was (wo – insbesondere als
Differenz-Muster) erkennbar,
bis klar, und
vielleicht sogar
eindeutig, maximal kontrastklar (schwarz auf Rückseite weiß) erscheinend,
den otijot der Öffnung/en (jedenfalls des Alefbets), ‚äußerlich‘, ‚zuerst‘ an der ‚Oberfläche‘
dessen was (wo – insbesondere als
Differenz-Muster) erkennbar,
bis klar, und
vielleicht sogar
eindeutig, maximal kontrastklar (schwarz auf Rückseite weiß) erscheinend, 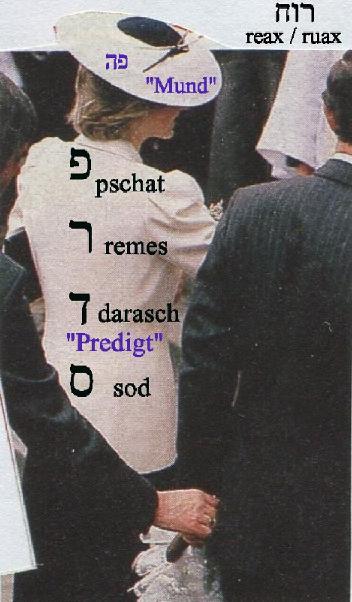 [Fürstin-פרד״ס hermeneutischer Vier-weg-Schichten]
[Fürstin-פרד״ס hermeneutischer Vier-weg-Schichten]
doch
einen zumindest ‚verschlungen‘ Deutungs- und Verstehensweg, eher beginnend, anstatt damit bereits für
beendet halten( müssend / wollen)d.  /peschut/-Merkwort(wurzeln פ־ש־ט) dessen, was da steht oder erklingt, eben ‚wahrnehmend geschieht‘,
ist – semitischem Denken verdächtig
– ‚einfach‘ (seiner diesmal gemeinten Bedeutung ‚entkleidet
/ nackt‘), etwa
‚wort-wörtlich‘, Ausgedrücktes / Gezeigtes P/F-SCH-T/A פ־ש־ט׀ע – eben mit so weitreichenden, bis widersprüchlichen,
und vielfältigen Bedeutungshöfen respektive
Verwendungsmöglichkeiten, wie (es erst)
manch fortgeschrittene Übersetzungsschwierigkeiten – gerade/‚bereits‘ der (für verstanden/erkannt
gehaltenen, bis beurteilten) ‚ganzen‘ (Kugrl/Blase einer/der unausweichlich
mjndestens) grammatikalisch repräsentierten Gesichte an sich – in/aus andere/n Sprachen immerhin erahnen
lassen könn(t)en.
/peschut/-Merkwort(wurzeln פ־ש־ט) dessen, was da steht oder erklingt, eben ‚wahrnehmend geschieht‘,
ist – semitischem Denken verdächtig
– ‚einfach‘ (seiner diesmal gemeinten Bedeutung ‚entkleidet
/ nackt‘), etwa
‚wort-wörtlich‘, Ausgedrücktes / Gezeigtes P/F-SCH-T/A פ־ש־ט׀ע – eben mit so weitreichenden, bis widersprüchlichen,
und vielfältigen Bedeutungshöfen respektive
Verwendungsmöglichkeiten, wie (es erst)
manch fortgeschrittene Übersetzungsschwierigkeiten – gerade/‚bereits‘ der (für verstanden/erkannt
gehaltenen, bis beurteilten) ‚ganzen‘ (Kugrl/Blase einer/der unausweichlich
mjndestens) grammatikalisch repräsentierten Gesichte an sich – in/aus andere/n Sprachen immerhin erahnen
lassen könn(t)en. 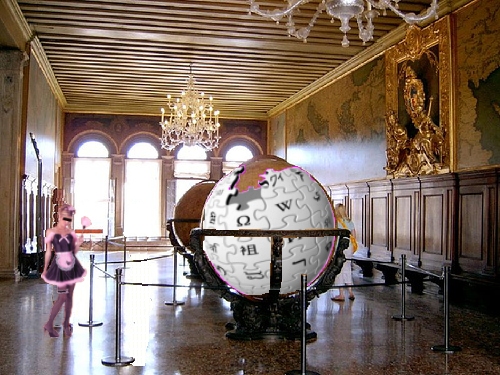 [Das
mechanische Weltbild überwältigt
viele Menschen, und überzeugt sich
selbst: so gut wie vollständig
allumfassend fortgeschritten
zwingend zu sein – zumal da ‚der‘ / sein
Überblick wachsend
erscheint]
[Das
mechanische Weltbild überwältigt
viele Menschen, und überzeugt sich
selbst: so gut wie vollständig
allumfassend fortgeschritten
zwingend zu sein – zumal da ‚der‘ / sein
Überblick wachsend
erscheint]
«Der
Buchstabe [sic! /otijot/
sind zwar mehr als auch das;
O.G.J. doch ‚vor
Rauch‘ warnend] פה pe ist der erste Buchstabe von
pschat. Das bedeutet die „Geschichte an sich", die man erfährt, wenn
man nur oberflächlich in der Tora liest, ohne tiefer nachzudenken.
Zum Beispiel: Als Adam Gott ungehorsam war und vom Baum der Erkenntnis [sic!
allerdings eben nicht etwa (wie nur allzu häufig vermeint/versucht wird)
jeglicher überhaupt, sondern ausdrücklich spezifiziert jener dichotomen von
‚gut und\aber böse/schlecht‘; O.G.J.] aß, schämte er sich [‚ward
jedenftalls ‚nackt‘ und bemerkte dies;
O.G.J.] und deshalb[sic!] versteckte er
sich (Tora: Genesis[/bereschit] 3,8-10).
Das ist die Geschichte an sich [und zwar bereits, teils vielleicht kaum
vermeidlich, interpretierend (für eine ‚predigende Absicht‘ / ‚erkennende Zielsetzung‘ passend
aus Alternativenfüllen ihrer Darstellungsmöglichkeiten) gewählt und aspektisch reduzierend
zusammengefasst, in einer, von der Grammatik des hebräischen Textes
verschieden, Zielsprache widergebend gewählt; O.G.J.]. » (La.Ku. 2001;
verlinkende Hervorhebungen und Überheblichkeiten O.G.J.)  Entscheidbarkeiten zwischen (in immerhin Immanuel
Kant’s ‚Welt‘ der
Objekte von) ‚Ja und (oh Schreck, gar vorzugsweise /LO/) Nein‘ setzen loglich eine Beziehungsrelation voraus:
Mindestens eine semiotische Verständigungssphäre, in der und für die, es
überhaupt ‚Richtiges und Falsches oder/aber diesbezüglich aktuell, bis
dauerhaft, Unentscheidbares‘ gibt. In deutschen Dialekten bedeutet /ne/ ‚nein‘ in griechischen Idiomen hingenen ‚ja‘. Mehr noch, kann
sogar der intersubjektiv konsensfähig, als ‚falsch gebraucht‘-erkannte
Ausdruck/Satz (irrtümlich, bis absichtlich
– ‚uneigentlich‘) zutreffend verstanden/beantwortet werden. Weder können, noch
müssen, (die
‚Sphärenblasen‘)‚Gesagtes‘/‚Gezeigtes‘
und ‚Gemeintes‘ deckungsgleich (selbig
gar auch noch mit dem [jeweils] ‚Verstandenen‘,
bis ‚Gemachten‘)
sein/werden (‚beiderlei‘
Wortfelderreichweiten haben begriffliche
Erfordernisse/Bere[/i]chtigung) – zumal da (gar – manchmal
überraschenderweise – immer) paradigmatisch mehrere (zumindest mehr oder minder höfliche/wirksame – anstatt nur:
‚schlechte[re[‘)
verbale und nonverbale Formen und Medien verfügbar …
Entscheidbarkeiten zwischen (in immerhin Immanuel
Kant’s ‚Welt‘ der
Objekte von) ‚Ja und (oh Schreck, gar vorzugsweise /LO/) Nein‘ setzen loglich eine Beziehungsrelation voraus:
Mindestens eine semiotische Verständigungssphäre, in der und für die, es
überhaupt ‚Richtiges und Falsches oder/aber diesbezüglich aktuell, bis
dauerhaft, Unentscheidbares‘ gibt. In deutschen Dialekten bedeutet /ne/ ‚nein‘ in griechischen Idiomen hingenen ‚ja‘. Mehr noch, kann
sogar der intersubjektiv konsensfähig, als ‚falsch gebraucht‘-erkannte
Ausdruck/Satz (irrtümlich, bis absichtlich
– ‚uneigentlich‘) zutreffend verstanden/beantwortet werden. Weder können, noch
müssen, (die
‚Sphärenblasen‘)‚Gesagtes‘/‚Gezeigtes‘
und ‚Gemeintes‘ deckungsgleich (selbig
gar auch noch mit dem [jeweils] ‚Verstandenen‘,
bis ‚Gemachten‘)
sein/werden (‚beiderlei‘
Wortfelderreichweiten haben begriffliche
Erfordernisse/Bere[/i]chtigung) – zumal da (gar – manchmal
überraschenderweise – immer) paradigmatisch mehrere (zumindest mehr oder minder höfliche/wirksame – anstatt nur:
‚schlechte[re[‘)
verbale und nonverbale Formen und Medien verfügbar … 
Zumal/Da
viele ‚Unannehmlichkeiten‘ des zweiten erheblichen (bereschit,
äh ‚groß [gar aufgeblasen]en‘), eben ReSCH 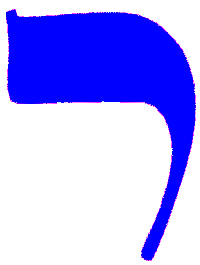 ‚Zeichens‘ (bis Verhaltens – in paRdes
und/oder zumal Paradies/en) eher selten (respektive
von/bei anderen und kaum [metakognitiv, kritisch] bei/an sich selbst) bemerkt werden (müssen, sowie ignoriert werden können). – רמז /remez/-Merkwort(wurzel
– ach ja mit/in s-endend) ‚der Hebräer‘ dafür/dagegen ‚Hinweisen‘ und ‚Anhaltspunkten‘
der/in/an/von Referenzen verwendeten/vermiedenen Ausdrucksweisen (jeglicher Interaktionen), nach zu gehen – zumal persönlich (individuell und/oder kollektiv) assoziativen, bis allegorischen, historischen, soziokulturellen,
lesartlichen pp.
‚Zeichens‘ (bis Verhaltens – in paRdes
und/oder zumal Paradies/en) eher selten (respektive
von/bei anderen und kaum [metakognitiv, kritisch] bei/an sich selbst) bemerkt werden (müssen, sowie ignoriert werden können). – רמז /remez/-Merkwort(wurzel
– ach ja mit/in s-endend) ‚der Hebräer‘ dafür/dagegen ‚Hinweisen‘ und ‚Anhaltspunkten‘
der/in/an/von Referenzen verwendeten/vermiedenen Ausdrucksweisen (jeglicher Interaktionen), nach zu gehen – zumal persönlich (individuell und/oder kollektiv) assoziativen, bis allegorischen, historischen, soziokulturellen,
lesartlichen pp. 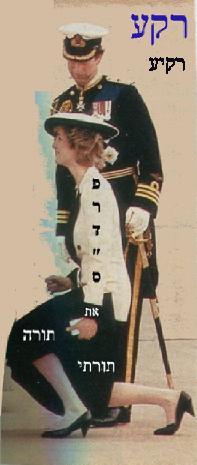 [Reverenzhinweis der Deutung auf innerraumzeitliche Umgebungenbezogenheiten] Die
grundlegendste, vorentscheidend ermöglichenden Indizien/Mittel und Wege liefern sowie verbergen
einem übrigens, gerade jene
grammatikalischen Strukturen einer Sprache, die jene Leute die diese zu
beherrschen haben/meinen, kaum bemerken kännen, da/soweit diese Ihr/das
vorstellungshorizontliches Denkfirmament form(ul)ieren.
[Reverenzhinweis der Deutung auf innerraumzeitliche Umgebungenbezogenheiten] Die
grundlegendste, vorentscheidend ermöglichenden Indizien/Mittel und Wege liefern sowie verbergen
einem übrigens, gerade jene
grammatikalischen Strukturen einer Sprache, die jene Leute die diese zu
beherrschen haben/meinen, kaum bemerken kännen, da/soweit diese Ihr/das
vorstellungshorizontliches Denkfirmament form(ul)ieren. «Der Buchstabe resch ist der erste Buchstabe des Wortes remes, das bedeutet „Hinweis". Wenn du über eine Geschichte
oder ein Wort in der Tora nachdenkst, führt dies in der Regel dazu, dass du
über andere, weitere Dinge nachdenkst. Wenn du fragst, was ein Wort bedeutet,
wirst du feststellen, dass es dich an etwas erinnert, worüber du heute oder
früher nachgedacht hast oder was du schon einmal getan hast oder gerade tust.
Vielleicht hast du wie Adam [אדם dieses Wort enthält, im Hebräischen. unter anderen, die Bedeutung/Lesee- und
Verstehensmöglichkeit: ‚Menschen(heit)‘;
O.G.J.] selbst schon einmal etwas getan, wofür du dich geschämt hast und
weshalb [sic! negative Sanktionsaussichten sind zumindest nicht weniger
motivierend; O.G.J.] du versucht hast, dich zu verstecken [bis es zu
leugnen/verbergen]. Adams Geschichte enthält also Hinweise auf Dinge in deinem
eigenen Leben.» (La.Ku.)
«Der Buchstabe resch ist der erste Buchstabe des Wortes remes, das bedeutet „Hinweis". Wenn du über eine Geschichte
oder ein Wort in der Tora nachdenkst, führt dies in der Regel dazu, dass du
über andere, weitere Dinge nachdenkst. Wenn du fragst, was ein Wort bedeutet,
wirst du feststellen, dass es dich an etwas erinnert, worüber du heute oder
früher nachgedacht hast oder was du schon einmal getan hast oder gerade tust.
Vielleicht hast du wie Adam [אדם dieses Wort enthält, im Hebräischen. unter anderen, die Bedeutung/Lesee- und
Verstehensmöglichkeit: ‚Menschen(heit)‘;
O.G.J.] selbst schon einmal etwas getan, wofür du dich geschämt hast und
weshalb [sic! negative Sanktionsaussichten sind zumindest nicht weniger
motivierend; O.G.J.] du versucht hast, dich zu verstecken [bis es zu
leugnen/verbergen]. Adams Geschichte enthält also Hinweise auf Dinge in deinem
eigenen Leben.» (La.Ku.) ![]() Der erste hinweisende #hier
Der erste hinweisende #hier![]() Midrasch findet sich zudem bekanntlich bereits innerhalb der Tanach / hebräischen Bibel selbst; wo
(Prophet) Micha interpretiert / offenbart, dass es sich bei dem ‚Mann‘,
der am Fluss mit (Erz-)Vater Jakow rang, als, bis damit, dieser
‚G-tt(es)treiter(/t)‘ /jisrael/ wurde / wird, eben (doch ‚nur-? / immerhin-?‘) ein ‚Engel‘ gewesen sei. Ja, selbst die
Auslegungsverfahren der
‚Gematria‘ (‚Buchstabenrechnunmg,
bis ‚Geonetrie‘ –
beide Fachbezeichnungen sprachliche (Re-)Importe aus dem Griechischen ins
Iwrit) ist
eher eine Frage des richtigen Erfahrungsalters, als eine des Verbietens (der
‚Kab[b]ala[h]‘, was eigentlich ‚Überlieferung‘/‚Tradition‘ benennt, eben
ohne gleich näher zu spezifizieren welche davon).
Midrasch findet sich zudem bekanntlich bereits innerhalb der Tanach / hebräischen Bibel selbst; wo
(Prophet) Micha interpretiert / offenbart, dass es sich bei dem ‚Mann‘,
der am Fluss mit (Erz-)Vater Jakow rang, als, bis damit, dieser
‚G-tt(es)treiter(/t)‘ /jisrael/ wurde / wird, eben (doch ‚nur-? / immerhin-?‘) ein ‚Engel‘ gewesen sei. Ja, selbst die
Auslegungsverfahren der
‚Gematria‘ (‚Buchstabenrechnunmg,
bis ‚Geonetrie‘ –
beide Fachbezeichnungen sprachliche (Re-)Importe aus dem Griechischen ins
Iwrit) ist
eher eine Frage des richtigen Erfahrungsalters, als eine des Verbietens (der
‚Kab[b]ala[h]‘, was eigentlich ‚Überlieferung‘/‚Tradition‘ benennt, eben
ohne gleich näher zu spezifizieren welche davon).
Das
dalet gilt insbesondere als ‚Türe/Pforte‘,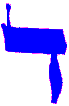 namentlich der Auslegung/en, durch und in die zwar alles Verstehen (von /dawar/ דבר) des ‚Wortes‘, der ‚Aussage‘ wie des ‚Zustandes‘ der
‚Sache‘/‚Angelegenheit‘ (hebräisches
Denken vermag ‚all dies‘ mit dem gleichen dalet-b/wet-resch ‚Ausdruck‘, plus -
wie ja meistens- auch noch mit einigen
weiteren, zu repräsentieren/fassen) doch gerade hinsichtlich der großen/wesentlichen
Entscheidungsfragen erfolgt: Falls es
mich/uns betrifft, ist es überhaupt (jedenfalls vorläufig, ‚hallachisch‘ – zumal durch
Mehrheitsbeschluss rechtsverbindlich) entscheidungsbedürftig, oder kann/muss es (‚h/aggadisch‘ – narrativ/diskursiv) ‚offen‘ bleiben?
namentlich der Auslegung/en, durch und in die zwar alles Verstehen (von /dawar/ דבר) des ‚Wortes‘, der ‚Aussage‘ wie des ‚Zustandes‘ der
‚Sache‘/‚Angelegenheit‘ (hebräisches
Denken vermag ‚all dies‘ mit dem gleichen dalet-b/wet-resch ‚Ausdruck‘, plus -
wie ja meistens- auch noch mit einigen
weiteren, zu repräsentieren/fassen) doch gerade hinsichtlich der großen/wesentlichen
Entscheidungsfragen erfolgt: Falls es
mich/uns betrifft, ist es überhaupt (jedenfalls vorläufig, ‚hallachisch‘ – zumal durch
Mehrheitsbeschluss rechtsverbindlich) entscheidungsbedürftig, oder kann/muss es (‚h/aggadisch‘ – narrativ/diskursiv) ‚offen‘ bleiben? 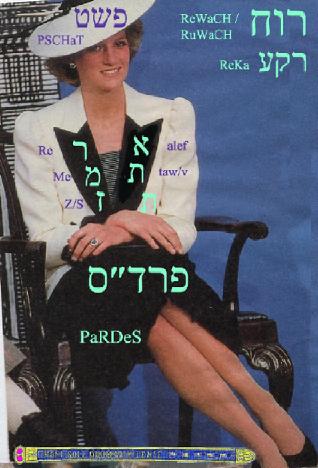 [Spätestens mit der ‚gezeigten‘ bis
‚gepredigten‘ Absicht/der Forderung sind/werden Empfänger
adressiert] Und/Aber welches Verhalten
erfolgt(e/unterbleibt) weitererseits handlungsfakisch, eben (nicht etwa allein damit beabsichtigter, oder
erklärter, massen) ‚Soll‘ mit ‚Ist‘ vergleichend? – /darasch/-Merkwort(wurzel)-דרש ‚sich
erkundigen, suchen‘, auch nach und in
jenem, (einen/andere, bis alle, eben
meist unterschiedlich)
betreffenden Kontext, der über den bereits erheblichen situativen Zusammenhang,
hinausgeht, in dem das (klanglich,
schriftlich, rechnerisch, gestisch etc. dargestellte) ‚Bild‘– auf/aus dem Papier / Monitor / Neuronennetzwerk respektive Geschehensrauschen, vom
Vorstellungsvermögen / Erinnerungssinn/en deutend erlebt/ursächlich verstanden
gemeint – im
‚Raum(zeitlichen)‘ /rewach/ רוח resch-waw-chet und\aber somit dem
‚Gemeinten/Beabsichtigten‘, bis ‚Getanen/Erreichten‘ רוח /ruach/ (bekanntlich mit/als ‚Geist‘ – gar verus
‚Materie‘– bestenfalls einseitig verstanden, ebenen nicht etwa alleine oder
zwingend physiologischen, ‚Windesbrausens‘;
vgl. Buber & Rosenzweig) steht.
[Spätestens mit der ‚gezeigten‘ bis
‚gepredigten‘ Absicht/der Forderung sind/werden Empfänger
adressiert] Und/Aber welches Verhalten
erfolgt(e/unterbleibt) weitererseits handlungsfakisch, eben (nicht etwa allein damit beabsichtigter, oder
erklärter, massen) ‚Soll‘ mit ‚Ist‘ vergleichend? – /darasch/-Merkwort(wurzel)-דרש ‚sich
erkundigen, suchen‘, auch nach und in
jenem, (einen/andere, bis alle, eben
meist unterschiedlich)
betreffenden Kontext, der über den bereits erheblichen situativen Zusammenhang,
hinausgeht, in dem das (klanglich,
schriftlich, rechnerisch, gestisch etc. dargestellte) ‚Bild‘– auf/aus dem Papier / Monitor / Neuronennetzwerk respektive Geschehensrauschen, vom
Vorstellungsvermögen / Erinnerungssinn/en deutend erlebt/ursächlich verstanden
gemeint – im
‚Raum(zeitlichen)‘ /rewach/ רוח resch-waw-chet und\aber somit dem
‚Gemeinten/Beabsichtigten‘, bis ‚Getanen/Erreichten‘ רוח /ruach/ (bekanntlich mit/als ‚Geist‘ – gar verus
‚Materie‘– bestenfalls einseitig verstanden, ebenen nicht etwa alleine oder
zwingend physiologischen, ‚Windesbrausens‘;
vgl. Buber & Rosenzweig) steht.  «Der
Buchstabe dalet ist der erste Buchstabe des Wortes drasch, das bedeutet [oft auch] „Predigt". Einige der Lehren
in den Geschichten erinnern dich vielleicht an andere Geschichten in der Tora,
diese wiederum können dich etwas über dein Leben lehren. Wenn Gott weiß, wo
Adam sich versteckt hat, warum fragt er ihn dann: „Wo bist du?" Vielleicht
möchte Gott, dass Adam erkennt, dass er sich in Wirklichkeit nur [bis nicht
einmal dauerhaft erfolgreich; O.G.J.] vor sich selbst versteckt, wenn er
versucht, sich vor Gott zu verbergen.» (La.Ku.)
«Der
Buchstabe dalet ist der erste Buchstabe des Wortes drasch, das bedeutet [oft auch] „Predigt". Einige der Lehren
in den Geschichten erinnern dich vielleicht an andere Geschichten in der Tora,
diese wiederum können dich etwas über dein Leben lehren. Wenn Gott weiß, wo
Adam sich versteckt hat, warum fragt er ihn dann: „Wo bist du?" Vielleicht
möchte Gott, dass Adam erkennt, dass er sich in Wirklichkeit nur [bis nicht
einmal dauerhaft erfolgreich; O.G.J.] vor sich selbst versteckt, wenn er
versucht, sich vor Gott zu verbergen.» (La.Ku.) 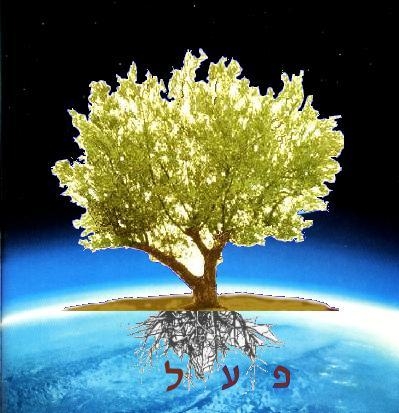 Was wir/Menschen verständlich
machen, bis bewirken s/wollen, bedarf
also (eines der gefärlichen
Geheimnisse)
zumindest differenzierender, bis differenzierter, (namentlich Führungs-)Voraussetzungen;
Was wir/Menschen verständlich
machen, bis bewirken s/wollen, bedarf
also (eines der gefärlichen
Geheimnisse)
zumindest differenzierender, bis differenzierter, (namentlich Führungs-)Voraussetzungen;  [Gerade
die herrschaftsgewaltlich soziokulturelle
bis politische Macht des/der überindividuellen Gemeinwesen/s, die PaRDeS
‚begleitend beobachtet‘, bis ‚vorführt‘,
befremdet/überrascht
viele] die uns/Ihnen gar nicht notwendigerweise immer alle vollständig
verborgen sein/bleiben/werden müssen.
[Gerade
die herrschaftsgewaltlich soziokulturelle
bis politische Macht des/der überindividuellen Gemeinwesen/s, die PaRDeS
‚begleitend beobachtet‘, bis ‚vorführt‘,
befremdet/überrascht
viele] die uns/Ihnen gar nicht notwendigerweise immer alle vollständig
verborgen sein/bleiben/werden müssen.
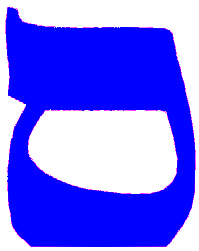 /sod/-Merkwort(wuezel)-סוד
/sod/-Merkwort(wuezel)-סוד  «Der vierte Buchstabe in dem Wort pardes, der Buchstabe samech, ist der erste Buchstabe
des Wortes sod, das bedeutet [ebenfalls nicht als einziges,
dafür gebräuchliches/verwendetes, hebräisches Wortfeld; O.G.J.] „Geheimnis".
Diese Schicht [sic! Schalenmodelle wurden und werden bereits der Analogie vom
‚Obstgarten‘ noch weniger ‚gerecht‘, als mathematische Mengenblasenkonzepte
immerhin die wechselseitigen Durchdringungen der (vier) idealtypisch vereinzeln
analysierten Aspekte ausdrücken könnten; O.G.J.] der Tora ist
„geheim", nicht weil sie nicht erzählt werden darf, sondern weil ihr Sinn
[und/oder zumal
gnädiges/ungnädiges Geschehen, jedenfalls aber G-tt; O.G.J.], selbst
wenn er entdeckt wird, geheimnisvoll [sowie ‚randlos‘; Albert Keller] bleibt.
Nur ein fortgeschrittener Schüler [jede als ‚männlich‘ erkennbare Pluralform, hier etwa תלמודים /talmudim/, semitischen Denkens schließt
weibliche Wesen bekanntlich mit ein, die weibliche Mehrzahlform תלמודות /talmudot/ Männer hingegen aus; O.G.J.] der
Tora vermag die [sic! eben ebenfalls alles andere als je so singuläre, wie meist
vereinzelt erkennbare; O.G.J.] geheime Bedeutung zu verstehen
[sic! jedenfalls
‚davon verstanden/betroffen/ergriffen zu sein/werden‘; O.G.J. eben gerade
dessen innerraumzeitlich Deutungsbedarf, mittels PaRDeS-Unterscheidungen
verwendend], wenn Gott sagt: „Gestern, Adam, warst du so groß,
dass du von einem Ende der
Welt bis zum anderen reichtest, aber jetzt, nachdem [bis solange? O.G.J.] du
[das Ziel verfehlt] hast, kannst du dich zwischen den
Bäumen des Gartens verstecken" (Midrasch
Genesis Rabba 19,9).»
«Der vierte Buchstabe in dem Wort pardes, der Buchstabe samech, ist der erste Buchstabe
des Wortes sod, das bedeutet [ebenfalls nicht als einziges,
dafür gebräuchliches/verwendetes, hebräisches Wortfeld; O.G.J.] „Geheimnis".
Diese Schicht [sic! Schalenmodelle wurden und werden bereits der Analogie vom
‚Obstgarten‘ noch weniger ‚gerecht‘, als mathematische Mengenblasenkonzepte
immerhin die wechselseitigen Durchdringungen der (vier) idealtypisch vereinzeln
analysierten Aspekte ausdrücken könnten; O.G.J.] der Tora ist
„geheim", nicht weil sie nicht erzählt werden darf, sondern weil ihr Sinn
[und/oder zumal
gnädiges/ungnädiges Geschehen, jedenfalls aber G-tt; O.G.J.], selbst
wenn er entdeckt wird, geheimnisvoll [sowie ‚randlos‘; Albert Keller] bleibt.
Nur ein fortgeschrittener Schüler [jede als ‚männlich‘ erkennbare Pluralform, hier etwa תלמודים /talmudim/, semitischen Denkens schließt
weibliche Wesen bekanntlich mit ein, die weibliche Mehrzahlform תלמודות /talmudot/ Männer hingegen aus; O.G.J.] der
Tora vermag die [sic! eben ebenfalls alles andere als je so singuläre, wie meist
vereinzelt erkennbare; O.G.J.] geheime Bedeutung zu verstehen
[sic! jedenfalls
‚davon verstanden/betroffen/ergriffen zu sein/werden‘; O.G.J. eben gerade
dessen innerraumzeitlich Deutungsbedarf, mittels PaRDeS-Unterscheidungen
verwendend], wenn Gott sagt: „Gestern, Adam, warst du so groß,
dass du von einem Ende der
Welt bis zum anderen reichtest, aber jetzt, nachdem [bis solange? O.G.J.] du
[das Ziel verfehlt] hast, kannst du dich zwischen den
Bäumen des Gartens verstecken" (Midrasch
Genesis Rabba 19,9).»
 Werden den Worten/ Isch/ für ‚Mann‘ das jud und
/ischah/ für ‚Frau‘ das he entzogen, also G-ttes ‚Flagge‘/‚Kürzel‘ angezogen
ergen sich eben zweimal/zweilei alef-schin /esch/ ‚Feuer‘ – gar ‚Mächt‘ /ezer/
einader (anstatt gemeinsam jud-he-‚Auslassungszeichen‘-he) ‚gegenüber‘
/kenegdo/. – Kommt mit aus dem ‚reinen‘ anstatt ‚einfachen‘ Wortlautbestand der
Torasprache(n), erklärlich und doch nicht beherrschvar begriffen, zustande.
Werden den Worten/ Isch/ für ‚Mann‘ das jud und
/ischah/ für ‚Frau‘ das he entzogen, also G-ttes ‚Flagge‘/‚Kürzel‘ angezogen
ergen sich eben zweimal/zweilei alef-schin /esch/ ‚Feuer‘ – gar ‚Mächt‘ /ezer/
einader (anstatt gemeinsam jud-he-‚Auslassungszeichen‘-he) ‚gegenüber‘
/kenegdo/. – Kommt mit aus dem ‚reinen‘ anstatt ‚einfachen‘ Wortlautbestand der
Torasprache(n), erklärlich und doch nicht beherrschvar begriffen, zustande.
Was jedoch/hingegen das Verstehen (zumal
all) der
Ereignisse, äh (nur
– allerdings teils sogar geradezu ‚genetusch‘ antrainierbar)
‚erinnerter Geschichten‘
(‚davon‘ und ‚darüber‘), angeht sind/werden
also/zwar mehrere,
bis viele, Ebenen und Kanale, doch nicht immer gleich wesentlicher Arten, und aktuell schon gar nicht
vollständig umfassend bemerkt,
vorfindlich; Kathegoriesierungen
wie/nach ‚rischting
und/oder falsch‘ müssen, bis können, zudem nicht immer die einzigen, und
auch nicht die immerhin besten / nützlichsten, dafür/darunter
.... Doch, bringen nicht alle Erzählweisen
der Vielfalten Vielzahlen (gleich) deutlich zum Ausdruck,
zumal und wo ‚Erzählende‘, und/oder ‚empfängerseitig‘, die Meinung (bis Gesinnung) von der / den Eindeutigkeit/en überzeugen solle, bis (durchsetzen)
will.

![]()
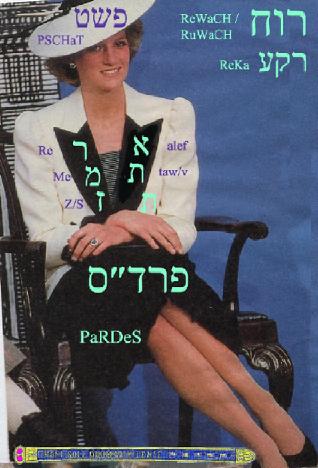 Curtsying
means / sows that you
are not queen of / over the person you bow / curtsy to, Milady.
Curtsying
means / sows that you
are not queen of / over the person you bow / curtsy to, Milady. 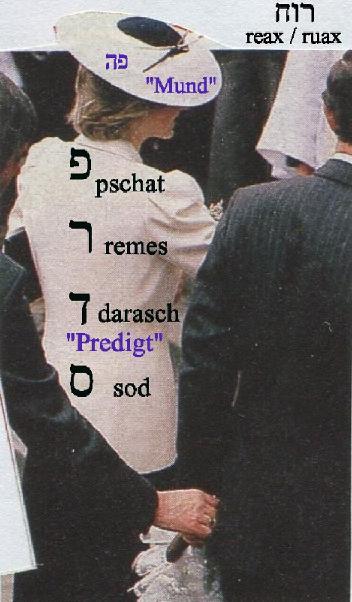 [Wenigstens
Emblematiken schrecken in ‚venexianischen Zusammenhängen nicht
notwendigerweisen alle (nur ab)] Anglo-amerikanische
Wissenschaftsverfahren gehen äußerst ernsthaft durch ein leicht
selbstironisches Schmunzeln persönlich ‚entgottet‘ voran.
[Wenigstens
Emblematiken schrecken in ‚venexianischen Zusammenhängen nicht
notwendigerweisen alle (nur ab)] Anglo-amerikanische
Wissenschaftsverfahren gehen äußerst ernsthaft durch ein leicht
selbstironisches Schmunzeln persönlich ‚entgottet‘ voran. 
Venezia und zumal ihre ‚allerduchlauchtigsten‘ Verfahren der
Herrschaftsausübungen, eben nicht allein über andere Menschen, Lebewesen
und sonstige Gegebenheiten und / also Möglichkeiten
überhaupt, sondern sogar / gerade auch über sich – namentlich die mächtig
einflussreichen Personen und Institutionen – selbst, sind vielfach Gegenstände zahlreicher akademischer
Untersuchungen – aber auch ‚der schwarzen
Legende‘.  [Oxbridge student more generally
interested] Wenige wichtige
dieser vielen wissenschaftlichen
Arbeiten sind inzwischen auch ‚online‘ zugänglich. Noch weniger –
auch, doch längst nicht allein. ‚kunsthistorisch‘ und ‚bildanalytisch‘ ansetzende – davon werden hier etwas ausführlicher
herangezogen.
[Oxbridge student more generally
interested] Wenige wichtige
dieser vielen wissenschaftlichen
Arbeiten sind inzwischen auch ‚online‘ zugänglich. Noch weniger –
auch, doch längst nicht allein. ‚kunsthistorisch‘ und ‚bildanalytisch‘ ansetzende – davon werden hier etwas ausführlicher
herangezogen. 
[In seiner ebenfalls recht fein gelungenen 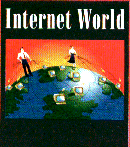 Online-Abhandlung: ‚Wie die Jungfrau zum Staat[e] kam‘ weist auch der Historiker Thomas Maissen – gar immerhin bereits irgendwo auf einem Weg vom (ja gar
nicht weniger deutungsbedürftigen) verbalsprachlichen ‘liguistic‘ zum (etwas
umfassenderen, gar komplexeren,
anstatt etwa alleine optischen, oder etwa realitätslos beliebigen) ‘semiotic
turn‘ philosophischen
Verstehens (der vorfindlichen Repräsentationen, ‚Abbildern‘ gegenüber /
von ontologisch allenfalls epistemologisch begrenzt fassbaren Repräsentierten)
– darauf hin: dass eben bereits der /
jeder Staatsbegriff selbst,
jedenfalls sprachlich-denkerisch, eine wesentlich jüngere (Vorstellungs- und
Verwendungs-)Konzeption birgt, als so manche politische Figuration der / von Menschen, für die ‚wir‘ (von) heute
(aus) kaum eine / ‚selbstverständlich‘
keine andere/n – von derartig prägenden Vorerfahrungskuppeln
unabhängige
– Bezeichnung/en verwenden /
erwarten / kennen, als eben diese ‚stato‘-Wort-‚Erfindungen‘ des 15./16.
Jahrhunderts (wobei das – nunmehrig ‚Status‘ bis
‚Stsst‘ bedeuten könnende – Wortfeld, gerade zu Venedig, so ‚neu‘ nicht war, wo
Online-Abhandlung: ‚Wie die Jungfrau zum Staat[e] kam‘ weist auch der Historiker Thomas Maissen – gar immerhin bereits irgendwo auf einem Weg vom (ja gar
nicht weniger deutungsbedürftigen) verbalsprachlichen ‘liguistic‘ zum (etwas
umfassenderen, gar komplexeren,
anstatt etwa alleine optischen, oder etwa realitätslos beliebigen) ‘semiotic
turn‘ philosophischen
Verstehens (der vorfindlichen Repräsentationen, ‚Abbildern‘ gegenüber /
von ontologisch allenfalls epistemologisch begrenzt fassbaren Repräsentierten)
– darauf hin: dass eben bereits der /
jeder Staatsbegriff selbst,
jedenfalls sprachlich-denkerisch, eine wesentlich jüngere (Vorstellungs- und
Verwendungs-)Konzeption birgt, als so manche politische Figuration der / von Menschen, für die ‚wir‘ (von) heute
(aus) kaum eine / ‚selbstverständlich‘
keine andere/n – von derartig prägenden Vorerfahrungskuppeln
unabhängige
– Bezeichnung/en verwenden /
erwarten / kennen, als eben diese ‚stato‘-Wort-‚Erfindungen‘ des 15./16.
Jahrhunderts (wobei das – nunmehrig ‚Status‘ bis
‚Stsst‘ bedeuten könnende – Wortfeld, gerade zu Venedig, so ‚neu‘ nicht war, wo
![]() ‚Stato da
Mar‘ territorial wesentliche Teile des Einflussbereichs der Serenissima bezeichnet/e, die so gern bis
fragwürdig vereinfachend als
/ zum
‚Stato da
Mar‘ territorial wesentliche Teile des Einflussbereichs der Serenissima bezeichnet/e, die so gern bis
fragwürdig vereinfachend als
/ zum ![]() ‚Kolonialreich‘
gedeutet /
übersetzet werden, respektive durchaus
herrschaftlich verwendet / beherrscht wurden), und/oder ‚uns‘
gegenwärtig damit / ‚darin‘ (re)präsent(iert)e Erscheinungsformen,
respektive Erlebnisse.
‚Kolonialreich‘
gedeutet /
übersetzet werden, respektive durchaus
herrschaftlich verwendet / beherrscht wurden), und/oder ‚uns‘
gegenwärtig damit / ‚darin‘ (re)präsent(iert)e Erscheinungsformen,
respektive Erlebnisse.  [‚Philosophia‘, oder ist es ‚Theologia‘ zoft
im besser als ‚Dogenpalast‘ bekannten Palazzo Comunal Venedigs. Äh in der
Gallerie Foscaries zwischen einst dogalen Wohnräumen]
[‚Philosophia‘, oder ist es ‚Theologia‘ zoft
im besser als ‚Dogenpalast‘ bekannten Palazzo Comunal Venedigs. Äh in der
Gallerie Foscaries zwischen einst dogalen Wohnräumen]
«Ganz unbesehen von Moden[sic! bis durchaus ‚weltanschaulichen‘ /
realitätenhandhaberischen Überzeugtheiten; O.G.J.] ist[sic!]
es hilfreich,
systematisch [auch diese Abbildungen sind nicht etwa vollständiger als
Textbestände erhalten oder erfasst; O.G.J.] Bilder als Quellen zu berücksichtigen, um soziale Lernprozesse
historisch zu verstehen.
Individuen und Gruppen sind beim Lernen keine
unbeschriebenen Blätter; sie erwerben [ihnen] neue Kenntnisse, indem sie diese mit
bestehendem Wissen[sic!]
verknüpfen oder assoziieren. Das gilt auch
für Konzepte, die uns selbstverständlich
und zeitlos erscheinen mochten,
obwohl sie es nicht sind – etwa der Staat. Die Tatsache[sic! immerhin eine mögliche,
bis gar konsensfähig, ‚gedeutete
Beobachtung‘; O.G.J.], dass der moderne
Nationalstaat gegenüber supranationalen Instanzen wie privaten[sic! auch
zivielgesellschaftliche Nichtregierungsorganistaionen / NGOs, Bewegungen,
Parteien, ‚Religionen‘, Wissenschaft[en] und etwa öffentliche Medien oder sonstige
‚überregionale‘ Konzerne, könnten, bis sollen, in dem, zumal ökonomisiert, ‚(vor)belegten Vorhalt der ‚Privatsache‘
aufgehen‘? O.G.J.] Unternehmen
schleichend[sic! schon länger, dennoch sind Staaten und Staatenverbände heute
international wesentlich mitentscheidende politische Akteure; O.G.J.] an Bedeutung verliert, führt
die Historizität dieser Organisationsform des Politischen vor Augen. Wie das Phänomen selbst, so ist
das Wort "Staat" ein Produkt der Frühen Neuzeit. Seit der
italienischen Renaissance taucht [das gar bereits venexianisch gebräuchliche;
O.G.J.] "stato" etwa bei ![]() Machiavelli
auf, und in Auseinandersetzung mit ihm und der "ragione di stato",
der [moralisch/ethisch; O.G.J. zumal unter dem Ver4dacht der
Menschenfeindlichkeit respektive emergent höherrangi empfundener / gesehener
Gemeinwesentlichkeit – gleich gar venezianisch] umstrittenen Staatsraison,
breitet sich das Wort im Deutschen – erst – in der zweiten Hälfte des 17.
Jahrhunderts aus.
Machiavelli
auf, und in Auseinandersetzung mit ihm und der "ragione di stato",
der [moralisch/ethisch; O.G.J. zumal unter dem Ver4dacht der
Menschenfeindlichkeit respektive emergent höherrangi empfundener / gesehener
Gemeinwesentlichkeit – gleich gar venezianisch] umstrittenen Staatsraison,
breitet sich das Wort im Deutschen – erst – in der zweiten Hälfte des 17.
Jahrhunderts aus.
Der[sic!] Kern d[ies]es modernen Staatsverständnisses
ist die[sic!] Souveränität, die "Kompetenzkompetenz" des Herrschers. Definiert wird dieses
fundamentale staatsrechtliche Konzept erstmals 1578 vom
Franzosen ![]() Jean Bodin:
"La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une
République" – die Souveränität ist die uneingeschränkte und zeitlich
unbegrenzte Gewalt in einem Staat[sic! gar eher auf einem / seinem / dem eher
staatsformunabhängigen Territorium meinend;
O.G.J. sowhl mit / gegen supranationale bzw. vertragliche alös auch mit
+berraumzeitlich-prinzipiellen Aspektem konfrontieremde Grenzenregieme
erkennend / behauptend]. Uneingeschränkt bedeutet, dass diese Gewalt
unmittelbar zu Gott [also nicht von / dirch andere/n,
zumal höhere/n. Mächte/n verhindert, ausgeübt; O.G.J. willkürliche
Beliebigkeitsirrtümer enstehender moderner Freiheitsvorstellungen ‚witternd‘]
ist, dass kein irdischer Herrscher einem Souverän etwas dreinzureden hat und
dass keine untergeordnete Institution von seiner [nämlich ‚dieses jeweiligen
irdischen Herrschers‘, in wessen / welchen ‚Namen‘ auch immer (Vernunft/en,
Gemeinwohl, Interessen, Kulturalismen, Verantwortung, Notwendigkeit/en und
Inspirationen / Offenbarungen sind hier ja längst nicht die einzigen)
erfolgter; O.G.J.] Gesetzgebung ausgespart ist. Das lässt sich
leicht postulieren. Doch [nicht etwa nur; O.G.J.] im 16. Jahrhundert ist es alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Gibt es nicht
Kaiser und Papst, die sich als Stellvertreter Gottes in die weltliche und geistliche Universalherrschaft
teilen? Gibt es nicht Adlige, Städte, Klöster oder Universitäten, die alle dank
wohlgehüteter Privilegien einen besonderen Rechtsstatus
beanspruchen können?
Jean Bodin:
"La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une
République" – die Souveränität ist die uneingeschränkte und zeitlich
unbegrenzte Gewalt in einem Staat[sic! gar eher auf einem / seinem / dem eher
staatsformunabhängigen Territorium meinend;
O.G.J. sowhl mit / gegen supranationale bzw. vertragliche alös auch mit
+berraumzeitlich-prinzipiellen Aspektem konfrontieremde Grenzenregieme
erkennend / behauptend]. Uneingeschränkt bedeutet, dass diese Gewalt
unmittelbar zu Gott [also nicht von / dirch andere/n,
zumal höhere/n. Mächte/n verhindert, ausgeübt; O.G.J. willkürliche
Beliebigkeitsirrtümer enstehender moderner Freiheitsvorstellungen ‚witternd‘]
ist, dass kein irdischer Herrscher einem Souverän etwas dreinzureden hat und
dass keine untergeordnete Institution von seiner [nämlich ‚dieses jeweiligen
irdischen Herrschers‘, in wessen / welchen ‚Namen‘ auch immer (Vernunft/en,
Gemeinwohl, Interessen, Kulturalismen, Verantwortung, Notwendigkeit/en und
Inspirationen / Offenbarungen sind hier ja längst nicht die einzigen)
erfolgter; O.G.J.] Gesetzgebung ausgespart ist. Das lässt sich
leicht postulieren. Doch [nicht etwa nur; O.G.J.] im 16. Jahrhundert ist es alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Gibt es nicht
Kaiser und Papst, die sich als Stellvertreter Gottes in die weltliche und geistliche Universalherrschaft
teilen? Gibt es nicht Adlige, Städte, Klöster oder Universitäten, die alle dank
wohlgehüteter Privilegien einen besonderen Rechtsstatus
beanspruchen können?
Die[se]
Souveränität ist [bis ‚bleibt‘ und zwar keineswegs mit ‚Selbstbewusstsein‘, oder ‚Schlimmerem‘,
identisch; O.G.J.] also umstritten, als das Konzept auftaucht, denn es widerspricht – zumal im ![]() Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation [dem Venezia ja gegenübersteht, und bis nach 1797 (beinahe –1804
aufgelöst) nicht (mehr) angehört / kniete; O.G.J.] – den
herkömmlichen, gültigen Ordnungsvorstellungen und der Verfassungsrealität. Die [wie eben, oben reduktionistisch singularisiert
verabsolutierend definierte] Souveränität wird [gar ‚auch heute noch‘ respektive ‚inzwischen wieder‘?
O.G.J. Naivitäten bis Populismen / Rebellion entblößend – welche ihrerseits ‚an
der Macht befindlich‘ nichts mehr hassen als deren Begrenzungen und Kontrollen
ihres Tuns durch Institutionen] von vielen Menschen als fremdartig und
bedrohlich empfunden, während ihre Anhänger betonen, dass die souveräne
Obrigkeit mit ihrem Gewaltmonopol die
Erlösung[sic!] von ([nicht etwa
allein, wie auch damals, insbesondere Jahrzehntelang im 16. u. 17. Jahrhundert,
nie nur; O.G.J.] religiösen) Bürgerkriegen und äußeren Invasionen darstellt.
» Jedenfalls in
Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation [dem Venezia ja gegenübersteht, und bis nach 1797 (beinahe –1804
aufgelöst) nicht (mehr) angehört / kniete; O.G.J.] – den
herkömmlichen, gültigen Ordnungsvorstellungen und der Verfassungsrealität. Die [wie eben, oben reduktionistisch singularisiert
verabsolutierend definierte] Souveränität wird [gar ‚auch heute noch‘ respektive ‚inzwischen wieder‘?
O.G.J. Naivitäten bis Populismen / Rebellion entblößend – welche ihrerseits ‚an
der Macht befindlich‘ nichts mehr hassen als deren Begrenzungen und Kontrollen
ihres Tuns durch Institutionen] von vielen Menschen als fremdartig und
bedrohlich empfunden, während ihre Anhänger betonen, dass die souveräne
Obrigkeit mit ihrem Gewaltmonopol die
Erlösung[sic!] von ([nicht etwa
allein, wie auch damals, insbesondere Jahrzehntelang im 16. u. 17. Jahrhundert,
nie nur; O.G.J.] religiösen) Bürgerkriegen und äußeren Invasionen darstellt.
» Jedenfalls in ![]() monokratischen,
so die, diesbezüglich vielleicht doch etwas zu eifrig überzogene. These
Th.Ma.s, «Monarchien» lasse «sich diese[sic! gar eher
jedwede von Menschen über Menschen, tauschändlerisch / nimrodisch (Duldung, bis Schutz, gegen
Unterwerfung und Gefolgschaft), ausgeübte? O.G.J. Variante der Universalie] Macht problemlos[sic! zwar vielleicht (sender- wie
empfängerseitig komplementär und/oder
gegensätzlich) besonders überraschenderweise, doch gerade eher
uneindeutig; O.G.J.] darstellen: Dies geschieht durch den Fürsten in Rüstung,» den
Feldherrn, «der siegreich über die [auch emblematisch dazu, bereits im Altertum, nicht immer nur, gar
nicht alle; O.G.J.] erschlagenen Feinde einherreitet, oder der thronende König, zu
dessen Füßen eine[sic! es sind
potenziell durchaus gleichzeitig alle Bevölkerungsteile, bis sämtliche
unterstellete Ethnien, ‚im Angebot‘; O.G.J.] demütige[sic! jenes Wortfeld an dem der
‚heute‘ / neuzeitlich wohl wesentlichste, bis absichtliche, begrifflich-konzeptionelle Kollektivtrug
besonders zum Ausdruck kommen mag, respektive in dessen Verständnissen /
Wortgebrauch besonders eindrücklich sind/werden; O.G.J.]
Landespersonifikation kniet, die seinen Schutz genießt[sic! jedenfalls ‚benötigt‘ und für sein, bis des
Gemeinwesens, Wohlwollen sorgend,
durchaus Opfer – oder wenigstens Landeskinder – hervorbringen,
muss; O.G.J.] – wie Francia [und Navarre] bei Simon
Vouët vor Ludwig XIII. » (Th.Ma.; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.)
monokratischen,
so die, diesbezüglich vielleicht doch etwas zu eifrig überzogene. These
Th.Ma.s, «Monarchien» lasse «sich diese[sic! gar eher
jedwede von Menschen über Menschen, tauschändlerisch / nimrodisch (Duldung, bis Schutz, gegen
Unterwerfung und Gefolgschaft), ausgeübte? O.G.J. Variante der Universalie] Macht problemlos[sic! zwar vielleicht (sender- wie
empfängerseitig komplementär und/oder
gegensätzlich) besonders überraschenderweise, doch gerade eher
uneindeutig; O.G.J.] darstellen: Dies geschieht durch den Fürsten in Rüstung,» den
Feldherrn, «der siegreich über die [auch emblematisch dazu, bereits im Altertum, nicht immer nur, gar
nicht alle; O.G.J.] erschlagenen Feinde einherreitet, oder der thronende König, zu
dessen Füßen eine[sic! es sind
potenziell durchaus gleichzeitig alle Bevölkerungsteile, bis sämtliche
unterstellete Ethnien, ‚im Angebot‘; O.G.J.] demütige[sic! jenes Wortfeld an dem der
‚heute‘ / neuzeitlich wohl wesentlichste, bis absichtliche, begrifflich-konzeptionelle Kollektivtrug
besonders zum Ausdruck kommen mag, respektive in dessen Verständnissen /
Wortgebrauch besonders eindrücklich sind/werden; O.G.J.]
Landespersonifikation kniet, die seinen Schutz genießt[sic! jedenfalls ‚benötigt‘ und für sein, bis des
Gemeinwesens, Wohlwollen sorgend,
durchaus Opfer – oder wenigstens Landeskinder – hervorbringen,
muss; O.G.J.] – wie Francia [und Navarre] bei Simon
Vouët vor Ludwig XIII. » (Th.Ma.; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.)
|
Gemälde Ludwigs XIII. von
Simon Vouët (1590 -
1649). - So mancher Mensch hielt sich bekanntlich/ausdrücklich, bis
hält sich verhaltensfaktisch, für ‚den Staat‘ (vgl. also nicht etwa allein
explizit Louis XIV.). |
Zudem
kniet allerdings gerade Ludwig XIII. – wie
auch Vorgänger und Nachfolger auf dem französischen Königsthron, äh
‚auf‘ überlieferten Gemälden –, eben
anders als etwa damals Serenisima Venetia (die vielmehr selbst mit / zu [einer] Madonna vermengt), vor der
römisch-katholischen Himmelskönigin, ‚seiner‘ (einen,
westlichen) Kirche,
um ihr / von ihr her, seine heilige Herrschaft zu weihen. |
Weiteres Gemälde mit Louis
XIII. vor der überirdischen Maria kniend.
- Sich als (etwa preußisch, gar ‚erster‘) Diener seines/des ‚Staates‘
auszugeben, bis zu verstehen, oder gar zu verhalten, werden ja noch mehr
Leute versucht haben. |
|
|
Weder
schließen einander ‚Demut‘, äh
‚Arroganz‘, und – zumal souveräne oder individuelle, bis kollektive – ‚Selbstbewusstheit/en‘
gegenseitig notwendigerweise aus oder ein, gleich gar nicht qualifizierte / ‚eigentliche‘, anstatt manch
popularisiert üblich
(empfunden)
vorherrschender, Formen des jeweils mit / unter / in diesen
begrifflichen Wortglockenkonzepten Gemeinten
/ Repräsentierten / Unterstellten; noch ist / wäre / war (semiotisches / denkerisches, bis physiologisches /
kätperliches) Knien,
oder sonst ein Beugen überhaupt, ein zusammenhanglos eindeutiges, oder gar zwingend
erforderliches, Ausdrucksmittel, schon gar nicht von einem davon / für nur
etwas wovon … |
|
 [Venezianische,
zumeist siebenfache, bis gar dreizehnfältige, Thronereihe hinter / mit – gar durchaus qualifizierten Respekt habendem, jedenfalls immerhin
Reverenz/en erweisend und Belege vorweisend
– diesem Ratsgremium vortragendem, Edelmann]
[Venezianische,
zumeist siebenfache, bis gar dreizehnfältige, Thronereihe hinter / mit – gar durchaus qualifizierten Respekt habendem, jedenfalls immerhin
Reverenz/en erweisend und Belege vorweisend
– diesem Ratsgremium vortragendem, Edelmann]
Für ein ‚Ratsregiment‘[sic!] 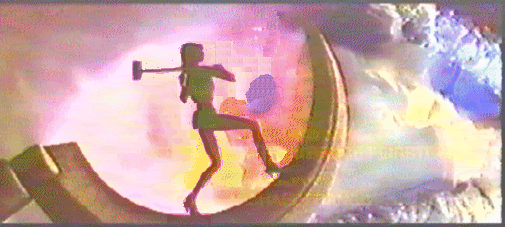 von gleichgestellten Männern sei diese
von gleichgestellten Männern sei diese ![]() ‚monokratische‘ Form der Selbstdarstellung hingegen und «allerdings
nicht brauchbar. Aber auch hier liegt die ikonographische beim[sic!] Motiv der
schützenswerten[sic!] Landespersonifikation. Was, wenn diese Allegorie nicht unterwürfig[sic!] kniet,
sondern gleichwertig[sic!]
neben dem Mann[sic!] thront oder steht, wie auf zahlreichen niederländischen
Bildern, die, etwa 1623 bei Jan Tengnagel, den Statthalter aus dem Haus Oranien
– den militärischen Führer des Landes – neben eine selbstbewusste[sic! nicht
notwendigerweise das Gegenteil von ‚demütig‘, nicht einmal von
‚gedemütigt‘, was sie ja gar (wie ‚keusch‘ dabei, trotzdem auch immer
durchaus / gerade) wurde/war – und / so weniger eng zusammenhängt, als /
wie dies sprachlich / denkerisch erscheinen mag, oder vielleicht soll;
O.G.J.] Hollandia [dem zumal
‚religiös-kulturell‘ auch noch ‚protestantisch‘ gewordenen Bevölkerungsteil der
damals spanischen Niederlande, deren ökonomische Handelsorientierung etwa der
venezianischen und hanseatischer oder inzwischen ‚belgisch‘ gelebter /
genannter, weitgehend ähnelt; O.G.J.] hinstellen?
‚monokratische‘ Form der Selbstdarstellung hingegen und «allerdings
nicht brauchbar. Aber auch hier liegt die ikonographische beim[sic!] Motiv der
schützenswerten[sic!] Landespersonifikation. Was, wenn diese Allegorie nicht unterwürfig[sic!] kniet,
sondern gleichwertig[sic!]
neben dem Mann[sic!] thront oder steht, wie auf zahlreichen niederländischen
Bildern, die, etwa 1623 bei Jan Tengnagel, den Statthalter aus dem Haus Oranien
– den militärischen Führer des Landes – neben eine selbstbewusste[sic! nicht
notwendigerweise das Gegenteil von ‚demütig‘, nicht einmal von
‚gedemütigt‘, was sie ja gar (wie ‚keusch‘ dabei, trotzdem auch immer
durchaus / gerade) wurde/war – und / so weniger eng zusammenhängt, als /
wie dies sprachlich / denkerisch erscheinen mag, oder vielleicht soll;
O.G.J.] Hollandia [dem zumal
‚religiös-kulturell‘ auch noch ‚protestantisch‘ gewordenen Bevölkerungsteil der
damals spanischen Niederlande, deren ökonomische Handelsorientierung etwa der
venezianischen und hanseatischer oder inzwischen ‚belgisch‘ gelebter /
genannter, weitgehend ähnelt; O.G.J.] hinstellen? 
[[Vielleicht, bis wahrscheinlich, steht die sogenannte ‚Landespersonifikation‘
(wie etwa Britannia. California, Francia. Germania, Helvetia, Hollandia, Matilda, Navarre, Nippon, Uncle Sam und Venezia
pp.) weniger für ‚die Bevölkerung‘ (zumal nicht aus Individuen oder als Familiensippen – denn wer  beugte hier denn sonst,
mittels und in allerlei Formen von Gefolgschaft, bis Flehen, gar – wie die Frau
mit ihrer Tochter (gemalt von Carl Becker) um 1600 im Palazzo Comunale – nicht
allein nur / immerhin allegorisch, ‚seine Knie‘ bei den, oder für die,
Hoheiten?), sondern eher
deren / die jeweiligen (auch und gerade nicht mit einer Ethnie / ‚dem Volk‘ identische)
Gemeinwesenheiten, etwa von Gruppierungen und Gemeinschaften bis zur ‚ganzen
Gesellschaft‘, nach / in der Art und
eise des Landes, gar jene Machterscheinungen von Menschen über / an ‚ihresgleichen‘
repräsentierend / symbolisierend, die soziologisch und politologisch, bis immerhin sprachkulturell und
denkgrammatikalisch, damit zusammenhängen, dass / wenn Mensch(en)
nicht ganz alleine, irgendwo nur für / von sich selbst lebend – zumindest
auf Duldungen durch andere ange- und verrwiesen – lebt.]
beugte hier denn sonst,
mittels und in allerlei Formen von Gefolgschaft, bis Flehen, gar – wie die Frau
mit ihrer Tochter (gemalt von Carl Becker) um 1600 im Palazzo Comunale – nicht
allein nur / immerhin allegorisch, ‚seine Knie‘ bei den, oder für die,
Hoheiten?), sondern eher
deren / die jeweiligen (auch und gerade nicht mit einer Ethnie / ‚dem Volk‘ identische)
Gemeinwesenheiten, etwa von Gruppierungen und Gemeinschaften bis zur ‚ganzen
Gesellschaft‘, nach / in der Art und
eise des Landes, gar jene Machterscheinungen von Menschen über / an ‚ihresgleichen‘
repräsentierend / symbolisierend, die soziologisch und politologisch, bis immerhin sprachkulturell und
denkgrammatikalisch, damit zusammenhängen, dass / wenn Mensch(en)
nicht ganz alleine, irgendwo nur für / von sich selbst lebend – zumindest
auf Duldungen durch andere ange- und verrwiesen – lebt.]
Noch klarer[sic! eher ‚deutlich anders
konzipiert‘, wo/indem weder die Bevölkerung noch die ‚Landespersonifikation‘
Venexia, sondern deren Führungselite für diese, bis vor ihnen dienend, kniet;
O.G.J. an sonstige Fürstlichkeiten erinnert] ist Tintorettos Hierarchie [als(o) ‚heilige
Rangordnung‘] in der Sala
del Maggior Consiglio des Dogenpalastes[sic!]:
[#Abb. Tintoretto.]  ???
???
Venetia, mit dem Zepter in der Hand auf einer
Wolke thronend, reicht dem knienden Dogen Nicolò
del Ponte einen Lorbeerkranz [respektive viele weitere Darstellungen des knienden,
so auch die ‚Fischerkrone‘ Corono empfangenden,
Dogen auch auf Votivbildern und Münzen; O.G.J.]. Die Staatspersonifikation [und ihr
jeweiliges Symbol, wie etwa der Markuslöwe; O.G.J.] ist dem höchsten Repräsentanten der Lagunenrepublik übergeordnet. Sie steht [oder thront] da als die entscheidende Mittlerin zwischen den
Venezianern und dem Allmächtigen[sic!],
dessen göttliches Licht in der Aureole
direkt über ihr durchbricht – Venetia ist unmittelbar bei Gott, während der Doge wie auf einem[sic! annähernd jedem
venezianischen; O.G.J.] Votivbild zu ihr [oder einem ihrer
ihrer Symbole; O.G.J. Hyperrealitäten bis Gätzendienste nicht ausschließend an
‚Gesslers Hut‘ & Co. erinnert] emporblickt. Ikonographisch handelt es sich [nicht etwa
allein; O.G.J.] bei Tintorettos Venetia tatsächlich[sic! Jedenfalls ‚absichtlich‘; O.G.J.] um einen Marientypus, um die "Regina coeli", die Himmelsherrscherin. Die Nähe von Venetia und
Doge zu mariologischen Votivbildern macht die[se, eben gemäß m.v., den Brauch von Venedig, eben nicht
unbedingt beabsichtigte / akzeptierte; O.G.J.] Differenzierung bereits für Zeitgenossen schwierig. So
identifiziert der durchreisende Engländer Thomas Coryate 1608 Tintorettos
Venetia als "the Virgin Mary". Derselbe Coryate nennt die
Lagunenstadt in mariologischer Metaphorik "a pure Virgin and incontamined
mayde", eine Jungfrau[sic! allerdings wurde bis wird, gerade Venedig zumal
von aussen (doch kaum von römischen Vatikan) her, höchst ambivalent, namentlich
kaufhändlerisch, bis räuberisch, reicher
und/oder diplomatischer, bis listiger, gar grausamer, 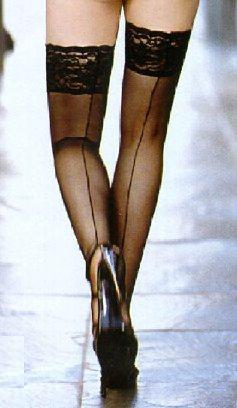 Unkeuschheiten verdächtigt und beschuldigt;
zumal Venetia weder xenophobische Berührungsängste, etwa mit dem Osten, sogar
dem Orient und Afrika oder Muslimen, ja nicht einmal Juden gegenüber, zeigte, noch vorbehaltlos
hingegeben seinen eigenen Herrschenden vertraute (zumal es diese,
doch eher überschaubar grosse Gruppierung mehrerer hundert, auch wechsekseitig
aufmerksam skeptischer, Familien, vielmehr institutionalisiert streng kontrolliert überwachte), und sich weder
der Comoedia, dem Maskentragen, noch – mehr oder minder platonisch-keuschen –
Liebeskünsten (etwa von ‚Cortigiani‘ und männlichen
‚Höflingen‘ – oder 1797 den Überlegenen) verschloss;
O.G.J.], die ihre Schönheit [und ihre, eben nicht allein monetären, Vermögen;
O.G.J.] unbefleckt [unbraubt] über mehr als tausend
Jahre bewahrt habe, obwohl viele fremde Potentaten versucht hätten, sie zu
entjungfern [unterwerfen].
Unkeuschheiten verdächtigt und beschuldigt;
zumal Venetia weder xenophobische Berührungsängste, etwa mit dem Osten, sogar
dem Orient und Afrika oder Muslimen, ja nicht einmal Juden gegenüber, zeigte, noch vorbehaltlos
hingegeben seinen eigenen Herrschenden vertraute (zumal es diese,
doch eher überschaubar grosse Gruppierung mehrerer hundert, auch wechsekseitig
aufmerksam skeptischer, Familien, vielmehr institutionalisiert streng kontrolliert überwachte), und sich weder
der Comoedia, dem Maskentragen, noch – mehr oder minder platonisch-keuschen –
Liebeskünsten (etwa von ‚Cortigiani‘ und männlichen
‚Höflingen‘ – oder 1797 den Überlegenen) verschloss;
O.G.J.], die ihre Schönheit [und ihre, eben nicht allein monetären, Vermögen;
O.G.J.] unbefleckt [unbraubt] über mehr als tausend
Jahre bewahrt habe, obwohl viele fremde Potentaten versucht hätten, sie zu
entjungfern [unterwerfen].
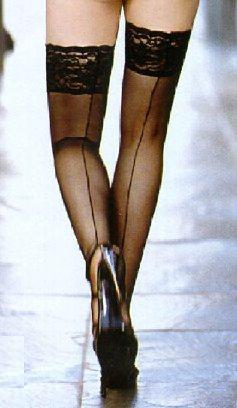 Die
Jungfräulichkeit», eben einer der (zumal
daher – weit mehr als immerhin hypersexuell potent) besonders hoch aufgeladenen
Topoi, sei «die entscheidende
Analogie zwischen Marienbild
und staatlicher Souveränität. Nur wer seinen politischen Körper [bis gar ‚Leib‘, im ehemals
qualifizierten Sinne, oder noch kulturalistischer,
bis geradezu/erkennbar paradoxerweise züchterisch, ‚Angehauchtes‘; zumal
nicht jede Sprache in/mit allen ihren Wärtern/Denkformen gleichartig zwischen
‚junger Frau‘ und ‚Jungfrau‘ trennt, gar biologisiert und kulturalisiert, – wie
etwa ‚bürgerliche‘ Gesellschaftsideale, über ‚Mütter‘, äh ‚Heilige‘, und
‚Mägde‘, äh ‚Huren‘, verfügen (wollen); O.G.J.] unversehrt behalten kann», sei «souverän. Nicht nur Maria, auch Athene / Minerva werden damit zur
ikonographischen Vorlage von ([eben nicht etwa ‚allein‘; O.G.J.] republikanischen [sondern ‚sämtlichen‘;
O.G.J. von emblematischenFortschritten derart emt-täuscht, veränderte Namen bis
Symbole nicht notwendigerweise für Verbesserungen zu halten – nicht einmal
falls, wem oder wo diese ‚neu‘])
Staatspersonifikationen. Im geschilderten Sinn handelt es sich dabei anfangs[sic!] aber nicht um eine einsame Jungfrau [gar allein im
Garten / Turm / Tschador / Öikos / Haushalt / Frauentrakt /
Denkempfindenabgesondert / eingeschlossen; O.G.J. auch Personal bis
Gespielinnen zumal ‚der Psyche refernziell‘], sondern um eine Paarbeziehung: Doge und Venetia, Statthalter [respektive (eben
allerlei – männlich emnlematisierte / personifizierte) Fürstlichkeiten bis
König/e und Kaiser] und Hollandia [auch/gerade
Ekklesia/Gemeinwesen, bis Organisation, und Priester/Pastor, bis Präsident,
sind omnipräsent geworden; O.G.J.]. Das Muster dieser keuschen[sic! zwar ‚gnostisch‘-Materie-wider-Geist-verachtend
so empfubnden / genannten doch was ‚tsrnen‘ müssen, sollen wollend? O,.G,J. sowohl.ups ‚Askese‘ als auch ‚Libertinismus‘ verdächtigend Beziehungsrelation des
Unterwerfens unter Verteilungsverhältnisse zu sichern – was Dyaden
(‚emblematische‘ / emergente, zumal soziale, , hyperreale nicht etwa
ausgenommen) häufig oder immer auch, anstatt notwendigerweise nur oder unfair,
enthalten] Ehe entstammt ebenfalls
der Marienikonographie: Es ist der seit dem Hochmittelalter [zumal im
ritterlichen Minne-Konzept; O.G.J.] verbreitete hortus conclusus Maria [respektive die ‚reine Lehre‘, äh
‚Jungfrau‘; O.G.J.] sitzt oder steht in
einem (Paradies[sic!]-)Garten (hortus), der von
einem Zaun [bis zu einer unüberwindlichen Mauer; O.G.J. ‚altlastig‘, äh ‚von Dornenkecken des CHeT חית geprägt‘] umschlossen (conclusus) ist. Das Motiv geht auf die[sic! jedenfalls
‚eine‘ geläufige/dominante; O.G.J. auch christlicherseits mehr als eine
kritisch wertschätzend] Auslegung des
Hohenlieds zurück, und entsprechend[sic!] der dortigen Liebesmetaphorik kann Maria auch
als Kirche (Ecclesia) verstanden werden, die als keusche Braut (so genannte
Maria sponsa) dem Bräutigam Christus[sic!] in symbolischer Ehe verbunden» sei.
Die
Jungfräulichkeit», eben einer der (zumal
daher – weit mehr als immerhin hypersexuell potent) besonders hoch aufgeladenen
Topoi, sei «die entscheidende
Analogie zwischen Marienbild
und staatlicher Souveränität. Nur wer seinen politischen Körper [bis gar ‚Leib‘, im ehemals
qualifizierten Sinne, oder noch kulturalistischer,
bis geradezu/erkennbar paradoxerweise züchterisch, ‚Angehauchtes‘; zumal
nicht jede Sprache in/mit allen ihren Wärtern/Denkformen gleichartig zwischen
‚junger Frau‘ und ‚Jungfrau‘ trennt, gar biologisiert und kulturalisiert, – wie
etwa ‚bürgerliche‘ Gesellschaftsideale, über ‚Mütter‘, äh ‚Heilige‘, und
‚Mägde‘, äh ‚Huren‘, verfügen (wollen); O.G.J.] unversehrt behalten kann», sei «souverän. Nicht nur Maria, auch Athene / Minerva werden damit zur
ikonographischen Vorlage von ([eben nicht etwa ‚allein‘; O.G.J.] republikanischen [sondern ‚sämtlichen‘;
O.G.J. von emblematischenFortschritten derart emt-täuscht, veränderte Namen bis
Symbole nicht notwendigerweise für Verbesserungen zu halten – nicht einmal
falls, wem oder wo diese ‚neu‘])
Staatspersonifikationen. Im geschilderten Sinn handelt es sich dabei anfangs[sic!] aber nicht um eine einsame Jungfrau [gar allein im
Garten / Turm / Tschador / Öikos / Haushalt / Frauentrakt /
Denkempfindenabgesondert / eingeschlossen; O.G.J. auch Personal bis
Gespielinnen zumal ‚der Psyche refernziell‘], sondern um eine Paarbeziehung: Doge und Venetia, Statthalter [respektive (eben
allerlei – männlich emnlematisierte / personifizierte) Fürstlichkeiten bis
König/e und Kaiser] und Hollandia [auch/gerade
Ekklesia/Gemeinwesen, bis Organisation, und Priester/Pastor, bis Präsident,
sind omnipräsent geworden; O.G.J.]. Das Muster dieser keuschen[sic! zwar ‚gnostisch‘-Materie-wider-Geist-verachtend
so empfubnden / genannten doch was ‚tsrnen‘ müssen, sollen wollend? O,.G,J. sowohl.ups ‚Askese‘ als auch ‚Libertinismus‘ verdächtigend Beziehungsrelation des
Unterwerfens unter Verteilungsverhältnisse zu sichern – was Dyaden
(‚emblematische‘ / emergente, zumal soziale, , hyperreale nicht etwa
ausgenommen) häufig oder immer auch, anstatt notwendigerweise nur oder unfair,
enthalten] Ehe entstammt ebenfalls
der Marienikonographie: Es ist der seit dem Hochmittelalter [zumal im
ritterlichen Minne-Konzept; O.G.J.] verbreitete hortus conclusus Maria [respektive die ‚reine Lehre‘, äh
‚Jungfrau‘; O.G.J.] sitzt oder steht in
einem (Paradies[sic!]-)Garten (hortus), der von
einem Zaun [bis zu einer unüberwindlichen Mauer; O.G.J. ‚altlastig‘, äh ‚von Dornenkecken des CHeT חית geprägt‘] umschlossen (conclusus) ist. Das Motiv geht auf die[sic! jedenfalls
‚eine‘ geläufige/dominante; O.G.J. auch christlicherseits mehr als eine
kritisch wertschätzend] Auslegung des
Hohenlieds zurück, und entsprechend[sic!] der dortigen Liebesmetaphorik kann Maria auch
als Kirche (Ecclesia) verstanden werden, die als keusche Braut (so genannte
Maria sponsa) dem Bräutigam Christus[sic!] in symbolischer Ehe verbunden» sei.
«Sehr
populär[sic!] ist der hortus conclusus in den Niederlanden; und dort wird er
während des jahrzehntelangen Unabhängigkeitskriegs gegen Spanien in ein
politisches Umfeld verlegt. Nun ist es nicht mehr die (katholische) Maria,
sondern in den [die] (reformierten) Generalstaaten Hollandia, die in einem
Garten sitzt. Und bei den Bildern handelt es sich, anders als bei Tintoretto,
um Flugblätter, Massenprodukte patriotischer Propaganda ohne höhere
künstlerische Ambitionen und ohne[sic?] Anspruch auf Dauerhaftigkeit [während
bisher wohl kaum ein Staatswesen ohne überindividuelle
Unsterblichkeitshoffnungen oder kontrafaktische Ewigkeitsansprüche seines
Fortbestehens aus kam; O.G.J. ].
 Das hier
gezeigte Beispiel, das Testament des Friedens [oder des Anstands] von 1615 [im
Vorfeld des 30-jährigen europäischen auch ‚Überzeugtheitenkrieges‘; O.G.J.],
zeigt die so genannte niederländische Magd[sic!], die von einem Engel mit
Lorbeer gekrönt wird. An ihrer Seite hat sie das niederländische Wappentier,
den Löwen, der sie und den Freiheitshut auf der Lanze mit dem Schwert gegen
ihre Peiniger verteidigt. Der Führer des Widerstands ist im Orangenbaum
symbolisiert, der Statthalter aus dem Haus Oranien. Ihnen gegenüber, außerhalb
des Zaunes, sieht man die Angreifer, welche die – körperliche, territoriale –
Integrität der holländischen Jungfrau beeinträchtigen wollen: eine Gruppe
katholischer Prälaten, ganz links spanische Soldaten. Unzweideutig[sic!] ist
die erotische Metaphorik beim Soldaten, der seine Kanone zwischen den
gespreizten Beinen auf das Zauntor und durch dieses auf die
Landespersonifikation richtet, die aber in Zaun und Löwe gleichsam einen
schutzbereitenden Keuschheitsgürtel um sich hat. » (Th.Ma.; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.) [Abbs. Hortus cobclusus PARDES Zaun um Tora
#hier]
Das hier
gezeigte Beispiel, das Testament des Friedens [oder des Anstands] von 1615 [im
Vorfeld des 30-jährigen europäischen auch ‚Überzeugtheitenkrieges‘; O.G.J.],
zeigt die so genannte niederländische Magd[sic!], die von einem Engel mit
Lorbeer gekrönt wird. An ihrer Seite hat sie das niederländische Wappentier,
den Löwen, der sie und den Freiheitshut auf der Lanze mit dem Schwert gegen
ihre Peiniger verteidigt. Der Führer des Widerstands ist im Orangenbaum
symbolisiert, der Statthalter aus dem Haus Oranien. Ihnen gegenüber, außerhalb
des Zaunes, sieht man die Angreifer, welche die – körperliche, territoriale –
Integrität der holländischen Jungfrau beeinträchtigen wollen: eine Gruppe
katholischer Prälaten, ganz links spanische Soldaten. Unzweideutig[sic!] ist
die erotische Metaphorik beim Soldaten, der seine Kanone zwischen den
gespreizten Beinen auf das Zauntor und durch dieses auf die
Landespersonifikation richtet, die aber in Zaun und Löwe gleichsam einen
schutzbereitenden Keuschheitsgürtel um sich hat. » (Th.Ma.; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.) [Abbs. Hortus cobclusus PARDES Zaun um Tora
#hier]
[Ab. niederländische Städtepersonifikationen mit Ketten vor Spaniens Stadthalter/Eroberer
kniend] Jedenfalls «Hollandia»
sei
«frei [‚geworden‘ oder ‚eigentlich - trotz/auch in
Zwangsketten (‚innerlich‘ / ihrem Wesen bzw. gottesgeschöpflichen Status nach) schon/immer ‚gewesen‘? O.G.J.],
jungfräulich[sic!] und keusch[sic!] und will das bleiben. Dafür braucht sie
[zumal; O.G.J.] nach den Vorstellungen der Zeit einen Partner, einen Bräutigam,
der diesen Wunsch in einer symbolischen[sic!] und damit[sic!] rein
platonischen, nicht vollzogenen[sic!] Ehe liebevoll[sic! gleichwohl wäre ‚weise
Regierung‘ deutlichst mehr, als immerhin, oder gar nur, dieses Affektive; O.G.J.]
respektiert[sic! Respektskonzeptionen,
die darunter brav (bis [wider]willig, jedenfalls Opfer
bringend) verstehen, und darauf hinauslaufen: Sich, diese gar vorbehaltlos
unterstützend, den Wünschen der Gegenüberseite zu fügen, – laufen zumindest reduktionistische Gefahren,
summenverteilierisch, bestenfalls wechselseitig abwechselnd, mächtig
(dichotom entweder-oder-paradigmatisch) so manches (gemeinsam möglich, bis
nötig, gewesne/gewordene) Ziel, mindestens aber gerade/ausgerechnet
(dialogisch, bis von Loyalität trotz/im Nein-Voten, qualifizierten) Respekt, zu verfehlen;
O.G.J.] – so wie[sic! eben in den omnipräsent verselbstverständlichten
heteronomistischen Interaktonsformen (der
Tyranie, äh zumal ‚von
[überirdisch] besseren [All-]Wissenden aus/her‘) basal strittig; O.G.J.] Christus[sic!] das mit Maria/Ecclesia»
tue. «Die spanischen Herrscher haben, [zumindest; O.G.J.] nach Ansicht der
Niederländer, genau das nicht gemacht, und deshalb ist der niederländische
Unabhängigkeitskampf entbrannt, zur Verteidigung von missachteten
Freiheitsrechten, nicht aber zur Abschaffung der Monarchie [oder gar
hoheitlicher Herrschaftsformen überhaupt; O.G.J.].  Eine Medaille von 1583 erfasst diese wenig
harmonische[sic! eher mindestens einseitig ‚illoyal‘, bis tyrannisch‘ und
‚repressiv‘,empfundene/beabsichtigte, als eine Frage
ästhetischer Resonanzkategorien der Beziehungsrelation; O.G.J.] Paarbeziehung
ebenfalls mit der Ehemetaphorik [vgl. auch venexianische Vermählung ‚des Dogen‘
mit dem Meer, bis zum (gleich gar priesterlichen) Fischerring;
O.G.J.]. Auf der Vorderseite legt ein Spanier unter den Augen seines Königs
Philipp II. die [artig oder gezwungenermassen kniende]
weibliche Landespersonifikation in Ketten.» Ein ähnliches Motiv findet sich
auch in der Darstellung der in Ketten vor Spaniens Eroberer und Stadthalter
knienden flanderischen Städtepersonifikationen. - Doch, so auch von/inn den
Textumschriften der Medalie angedeutet: «(w)o der König gegenüber dem
Volk[sic!] zum Tyrannen wird, dort steht dem Volk[sic!] nach göttlichem und
menschlichem Recht [aber in mancherlei Konflikten mit einigen ‚kirchlichen
Lehren‘ / ‚obrigkeitlicher Theologien‘; O.G.J.] die Scheidung zu. Die Rückseite
der Medaille zeigt entsprechend Hollandia, […] mit dem [eben ‚auch sie‘: O.G.J.] beschützenden Löwen,
wie sie dem König den Ehering[sic!] zurück gibt,
während die abgenommenen Fußfesseln[/Ketten] am Boden liegen. Wie
Maria/Ecclesia in eine mystische[sic? so vielleicht aber eben auch, bis eher
gerade irrig, ‚nur eine mythisch-mythologische‘; O.G.J.] Ehe mit Christus[sic!] eintritt, so hat sich
Hollandia dem Spanier verbunden, doch dann ihre mystische[sic!
‚ideologisch-sakrale‘? O.G.J.] Ehe aufgelöst, als sich dieser als tyrannischer Landesherr[sic!] entpuppte. An seine Stelle
tritt nun der fürsorgliche Beschützer aus dem Volk[sic!] Oranien, denn die
Niederländer gehen noch lange[sic! wo nicht (etwa als einzige der Menschenheit)
‚bis heute‘? O.G.J.] davon aus, dass ein Land oder Volk[sic!] einen [wie auch
immer titulierten/ausgewöhlten; O.G.J.] Fürsten braucht, oder dann zumindest
dessen Stellvertreter […] In dieser Funktion steht[/thront …] auf vielen
Bildern […] der Oranier neben einer gleichwertigen[sic! ihm gar ‚gleichgestellten‘,
bis ‚ebenbürtig standesgemäß-ehefähigen‘; O.G.J.] Hollandia.» (Th.Ma.; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.)
Eine Medaille von 1583 erfasst diese wenig
harmonische[sic! eher mindestens einseitig ‚illoyal‘, bis tyrannisch‘ und
‚repressiv‘,empfundene/beabsichtigte, als eine Frage
ästhetischer Resonanzkategorien der Beziehungsrelation; O.G.J.] Paarbeziehung
ebenfalls mit der Ehemetaphorik [vgl. auch venexianische Vermählung ‚des Dogen‘
mit dem Meer, bis zum (gleich gar priesterlichen) Fischerring;
O.G.J.]. Auf der Vorderseite legt ein Spanier unter den Augen seines Königs
Philipp II. die [artig oder gezwungenermassen kniende]
weibliche Landespersonifikation in Ketten.» Ein ähnliches Motiv findet sich
auch in der Darstellung der in Ketten vor Spaniens Eroberer und Stadthalter
knienden flanderischen Städtepersonifikationen. - Doch, so auch von/inn den
Textumschriften der Medalie angedeutet: «(w)o der König gegenüber dem
Volk[sic!] zum Tyrannen wird, dort steht dem Volk[sic!] nach göttlichem und
menschlichem Recht [aber in mancherlei Konflikten mit einigen ‚kirchlichen
Lehren‘ / ‚obrigkeitlicher Theologien‘; O.G.J.] die Scheidung zu. Die Rückseite
der Medaille zeigt entsprechend Hollandia, […] mit dem [eben ‚auch sie‘: O.G.J.] beschützenden Löwen,
wie sie dem König den Ehering[sic!] zurück gibt,
während die abgenommenen Fußfesseln[/Ketten] am Boden liegen. Wie
Maria/Ecclesia in eine mystische[sic? so vielleicht aber eben auch, bis eher
gerade irrig, ‚nur eine mythisch-mythologische‘; O.G.J.] Ehe mit Christus[sic!] eintritt, so hat sich
Hollandia dem Spanier verbunden, doch dann ihre mystische[sic!
‚ideologisch-sakrale‘? O.G.J.] Ehe aufgelöst, als sich dieser als tyrannischer Landesherr[sic!] entpuppte. An seine Stelle
tritt nun der fürsorgliche Beschützer aus dem Volk[sic!] Oranien, denn die
Niederländer gehen noch lange[sic! wo nicht (etwa als einzige der Menschenheit)
‚bis heute‘? O.G.J.] davon aus, dass ein Land oder Volk[sic!] einen [wie auch
immer titulierten/ausgewöhlten; O.G.J.] Fürsten braucht, oder dann zumindest
dessen Stellvertreter […] In dieser Funktion steht[/thront …] auf vielen
Bildern […] der Oranier neben einer gleichwertigen[sic! ihm gar ‚gleichgestellten‘,
bis ‚ebenbürtig standesgemäß-ehefähigen‘; O.G.J.] Hollandia.» (Th.Ma.; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.)  [Jan Tengnagel aus dem Jahr 1623 –
während des 30-jährigen Krieges]
[Jan Tengnagel aus dem Jahr 1623 –
während des 30-jährigen Krieges]
«Interessanterweise
werden solch neue[sic!] Bildtraditionen nun auch anderswo
übernommen[/verwerndet], und zwar dort, wo […] das neue[sic! jedenfalls ‚erneuerte‘,
bis gar fürstenlose/präsidiale; O.G.J.] Konzept einer souveränen
Republik ausgedrückt werden muss[sic!]. Wie die
niederländischen Generalstaaten, so wird im Westfälischen Frieden von 1648 [als
die letztverbindlichen Berufungen auf die Geistes- bis abgebkuche Gottesautorität der einen (im
Wortsinne ‚katholischen‘) Kirche, durch die konfessionellen, ernsthaft (gemäß
dem ![]() ‚Augsburger Religionsfrieden‘, bereits von 1555 schließlich) akzeptierten –
bis (irgendwann) sogar respektierten - Pluralisierungen, staatsrechtlich relativiert/‚entgottet‘
und streng landesherrlich regionalisiert wurden; O.G.J.] auch die schweizerische
Eidgenossenschaft aus dem Reichsverband [des HRR‘s]
herausgelöst, was allmählich im Sinn Bodins als Souveränität
interpretiert wird.
‚Augsburger Religionsfrieden‘, bereits von 1555 schließlich) akzeptierten –
bis (irgendwann) sogar respektierten - Pluralisierungen, staatsrechtlich relativiert/‚entgottet‘
und streng landesherrlich regionalisiert wurden; O.G.J.] auch die schweizerische
Eidgenossenschaft aus dem Reichsverband [des HRR‘s]
herausgelöst, was allmählich im Sinn Bodins als Souveränität
interpretiert wird.  Wenig später taucht Helvetia als
Landespersonifikation auf, die wohl früheste Darstellung dürfte etwa auf 1665
zu datieren sein. Der Text auf ihrer Schürze weist sie aus als "wunder
Schweizerland, werthster Freyheit höchste Zier" in "alter
Keüschheitstracht", die "Königreichern gleich" […] Als frisch
gebackenes[sic!] Völkerrechtssubjekt steht Helvetia damit inmitten von
männlichen Werbern, zumeist Fürstenvertretern, die um ihre Hand anhalten,
[betrachtungsseitig] von links nach rechts Spanien, die Niederlande[sic!],
Savoyen, der Kaiser, Frankreich und Venedig [womit also auch Republiken/Oligarchien nicht, etwa per Definition,
weniger begehrlich, und erst recht nicht weniger hoheitlich (vgl. zumal
durchaus huldigend, vor den ‚thronenden‘
zumindest knicksenden Mädchen- bis Jan Tengnagel‘s Frauengestalt), erscheinen,
als Monarchien; O.G.J. …] Es ist kein Zufall, dass dieses [schweizerische
‚Staats‘-]Gemälde in dieselbe Zeit fällt wie die erste offizielle
Neutralitätserklärung der Eidgenossenschaft, die 1674 verkündet, "dass wir
uns als ein Neutral Standt halten wollen". Helvetia will sich für keinen
der fremden Freier entscheiden, sie ist, wie andere Gebrauchsprodukte der politischen
Propaganda zeigen, eine resolute[sic!] Dame, die dazu auch selbst zu den Waffen
zu greifen bereit ist. […]» (Th.Ma.; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.)
Wenig später taucht Helvetia als
Landespersonifikation auf, die wohl früheste Darstellung dürfte etwa auf 1665
zu datieren sein. Der Text auf ihrer Schürze weist sie aus als "wunder
Schweizerland, werthster Freyheit höchste Zier" in "alter
Keüschheitstracht", die "Königreichern gleich" […] Als frisch
gebackenes[sic!] Völkerrechtssubjekt steht Helvetia damit inmitten von
männlichen Werbern, zumeist Fürstenvertretern, die um ihre Hand anhalten,
[betrachtungsseitig] von links nach rechts Spanien, die Niederlande[sic!],
Savoyen, der Kaiser, Frankreich und Venedig [womit also auch Republiken/Oligarchien nicht, etwa per Definition,
weniger begehrlich, und erst recht nicht weniger hoheitlich (vgl. zumal
durchaus huldigend, vor den ‚thronenden‘
zumindest knicksenden Mädchen- bis Jan Tengnagel‘s Frauengestalt), erscheinen,
als Monarchien; O.G.J. …] Es ist kein Zufall, dass dieses [schweizerische
‚Staats‘-]Gemälde in dieselbe Zeit fällt wie die erste offizielle
Neutralitätserklärung der Eidgenossenschaft, die 1674 verkündet, "dass wir
uns als ein Neutral Standt halten wollen". Helvetia will sich für keinen
der fremden Freier entscheiden, sie ist, wie andere Gebrauchsprodukte der politischen
Propaganda zeigen, eine resolute[sic!] Dame, die dazu auch selbst zu den Waffen
zu greifen bereit ist. […]» (Th.Ma.; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.) 
Selbstständigkeit - (vielleicht gar k)ein (also
ebemfalls kaum willkürlich, weniger zwingend am Maria/Myrium, dann an
Jungfräulichkeitsvorstellungen festgemachter) generativ und ökonomische, bis politisch, gegenwärtiger (zumal [un]keuscher Unschuld-)Mythos, dessen – jederzeit abrufbare und emotional hoch
aufladbare – Verfügbarkeit so manche Spannungsverhältnisse
sowohl Bundes- als auch Zentralstaaten gegenüber, und erst recht wider trans-,
supra- und internationale Institutionen/Regime, zu illustrieren/befeuern
vermag, die derart absolut verstandenen/verwendeten
Souveränitäten soziokultureller Figurationen zivilisierend beschränken, bis gar unterwerfen? (O.G.J.) 
 Vielfach «ergänzen sich Text und Bild. Sie sind unterschiedliche, aber
gleichwertige[sic!] Quellen, wenn man verstehen will, wie neuartige
staatsrechtliche Wörter[sic! damit mehr/anders als immerhin verbalen
Etikettentausch meinend] breiteren Bevölkerungskreisen
vermittelt werden. Konzeptionen wie "Staat",
"Republik", "Neutralität" oder
eben "Souveränität" werden im Gefolge des
"Linguistic Turn" und dann des "Iconic Turn" nicht länger als zeitlose Kategorien
der Verfassungsgeschichte gedeutet, sondern als kulturelle[sic!]
Leistungen, mit denen Gesellschaften
sich Ordnung geben und
diese Ordnung symbolisch zum Ausdruck bringen. Das Beispiel der[art; O.G.J.] souveränen
Jungfrau[sic!] belegt […], dass man [auch nach/trotz 1605/20; O.G.J.] Neues nicht einfach[/voraussetzungslos]
aus dem[sic! wie
verstandenen? O.G.J.] Nichts
schaffen[sic! wesentlichste Kreativitätsfragen aufwerfend; O.G.J.]» könne: «Um in der Frühen Neuzeit das neuartige, von Bodin definierte Konzept der Souveränität zu vermitteln[sic! bis gar ‚durchzusetzen/überziehen‘; O.G.J.], muss[sic! jedenfalls ‚haben’ belehren s/wollende Männer,
und manche Frau; O.G.J. …] auf die mittelalterliche
Bildersprache zurückgreifen [Abb. Klugheit überwindet Gewalt q417] und
sie als Analogie zur Jungfräulichkeit[sic!] der zu Gott unmittelbaren[sic!]
Braut Maria[/Ekklesia] präsentieren. » (Th.Ma.; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.:) – Was aber und allerdings wenig, bis nichts,
über Beziehungsrelationen der (existenziell immerhin kaum bestreitbaren) zumal grammatikalischen Repräsentationen
(etwa an semiotischer, auch
neurologischer, Optik, Haptik, Olfaktorik und/oder Akustik) zum (vielleicht Verstandenen, bis intersubjektiv konsensfähig) Gemeinten, und\aber zu/mit/von/des (wie auch immer beschaffen sein/werden
mögenden/könnenden) Repräsentiertem: Denk(- bis
Empfindungs-)Konzeptionen
(‚Sichtweisen‘) erweißen sich als
unverzichtbare, anstatt als
unwandelbar richtige (oder
falsche),
Realität/en – damit
und darum aber nicht notwenigerweise auch als die einzig möglichen / ganze ‚Welt(wirklichkeit/en)‘.]
Vielfach «ergänzen sich Text und Bild. Sie sind unterschiedliche, aber
gleichwertige[sic!] Quellen, wenn man verstehen will, wie neuartige
staatsrechtliche Wörter[sic! damit mehr/anders als immerhin verbalen
Etikettentausch meinend] breiteren Bevölkerungskreisen
vermittelt werden. Konzeptionen wie "Staat",
"Republik", "Neutralität" oder
eben "Souveränität" werden im Gefolge des
"Linguistic Turn" und dann des "Iconic Turn" nicht länger als zeitlose Kategorien
der Verfassungsgeschichte gedeutet, sondern als kulturelle[sic!]
Leistungen, mit denen Gesellschaften
sich Ordnung geben und
diese Ordnung symbolisch zum Ausdruck bringen. Das Beispiel der[art; O.G.J.] souveränen
Jungfrau[sic!] belegt […], dass man [auch nach/trotz 1605/20; O.G.J.] Neues nicht einfach[/voraussetzungslos]
aus dem[sic! wie
verstandenen? O.G.J.] Nichts
schaffen[sic! wesentlichste Kreativitätsfragen aufwerfend; O.G.J.]» könne: «Um in der Frühen Neuzeit das neuartige, von Bodin definierte Konzept der Souveränität zu vermitteln[sic! bis gar ‚durchzusetzen/überziehen‘; O.G.J.], muss[sic! jedenfalls ‚haben’ belehren s/wollende Männer,
und manche Frau; O.G.J. …] auf die mittelalterliche
Bildersprache zurückgreifen [Abb. Klugheit überwindet Gewalt q417] und
sie als Analogie zur Jungfräulichkeit[sic!] der zu Gott unmittelbaren[sic!]
Braut Maria[/Ekklesia] präsentieren. » (Th.Ma.; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.:) – Was aber und allerdings wenig, bis nichts,
über Beziehungsrelationen der (existenziell immerhin kaum bestreitbaren) zumal grammatikalischen Repräsentationen
(etwa an semiotischer, auch
neurologischer, Optik, Haptik, Olfaktorik und/oder Akustik) zum (vielleicht Verstandenen, bis intersubjektiv konsensfähig) Gemeinten, und\aber zu/mit/von/des (wie auch immer beschaffen sein/werden
mögenden/könnenden) Repräsentiertem: Denk(- bis
Empfindungs-)Konzeptionen
(‚Sichtweisen‘) erweißen sich als
unverzichtbare, anstatt als
unwandelbar richtige (oder
falsche),
Realität/en – damit
und darum aber nicht notwenigerweise auch als die einzig möglichen / ganze ‚Welt(wirklichkeit/en)‘.]
 [Abb.
Doch bitte – irret Euch nicht,
Ihr ‚kleinen Leute‘: Zumal im Senat(ssaal)
präsentiert ihr vor-stehender Doge, der thronenden Venez(s)ia,
die – eben dazu,
protokollgerecht formell, sichtbar weiblich dargestellt, niederknienden,
unterworfen, bis sich Venedigs Ordnungsmodus
auslieferenden/anvertrauenden, –
Städte(-/Kolonien-Personifikationen). – Zudem holten hier – ‚auf dem Wasser‘ – Delegationen, aus ‚vieler
Herren Länder‘, Verfassungsanregungen
und ganze Gesetzestexte, bis Führungspersonal,
ab. [Ambassadors of Nuremberg receiving a
copy of Venetian laws from Doge Leonardo Loredan in 1508, by Carlo Caliari
(1570–1596), Doge’s Palace, Venice. Italy, 16th century. Detail
[Abb.
Doch bitte – irret Euch nicht,
Ihr ‚kleinen Leute‘: Zumal im Senat(ssaal)
präsentiert ihr vor-stehender Doge, der thronenden Venez(s)ia,
die – eben dazu,
protokollgerecht formell, sichtbar weiblich dargestellt, niederknienden,
unterworfen, bis sich Venedigs Ordnungsmodus
auslieferenden/anvertrauenden, –
Städte(-/Kolonien-Personifikationen). – Zudem holten hier – ‚auf dem Wasser‘ – Delegationen, aus ‚vieler
Herren Länder‘, Verfassungsanregungen
und ganze Gesetzestexte, bis Führungspersonal,
ab. [Ambassadors of Nuremberg receiving a
copy of Venetian laws from Doge Leonardo Loredan in 1508, by Carlo Caliari
(1570–1596), Doge’s Palace, Venice. Italy, 16th century. Detail
The ambassadors of Nuremberg receiving a copy of the Venetian laws from
Doge Leonardo Loredan in 1508, by Carlo Caliari (1570–1596), Doge’s
] 
Abb. Nürnberger ‚Diplomaten‘ in Venedig] Die zwar von/seitens der Bevölkerung /
Individuen zu respektieren / einzuhalten, bis von den Verwaltungen
und Gerichten
durchzusetzen, waren – doch eben also überall stets von/in optional
gestaltbaren Verhaltensentscheidungen, durchaus (auch zwischenmenschlich/persönlich: ‚pettitiv bittend‘ /
‚gnadenhalber‘ pp. Prinzipien, gar menschenfreundlich, wohlverstanden ‚aufhebend‘,
statt etwa dadurch abschaffend) beeinflussbarer, (zumal
mehr oder minder ‚selbst‘) exekutierender Menschen auszuführen sind.  [Das
Gemälde: ‘The Petition to the Doge‘, von Carl Ludwig Friedrich Becker zeigt
eine um 1600 im Pallazo Comunale kniende Frau,
mit ihrer Tochter, bei der Übergabe einer Bittschrift an ‚die venezianischen
Staatsgewalt‘. Image colored by Walters #37162 / black and white by Getty
#71612098]
[Das
Gemälde: ‘The Petition to the Doge‘, von Carl Ludwig Friedrich Becker zeigt
eine um 1600 im Pallazo Comunale kniende Frau,
mit ihrer Tochter, bei der Übergabe einer Bittschrift an ‚die venezianischen
Staatsgewalt‘. Image colored by Walters #37162 / black and white by Getty
#71612098]
![]() Dogen (na klar - die
Männer
Dogen (na klar - die
Männer  mit/unter
der besonderen 'Fischermütze' /
mit/unter
der besonderen 'Fischermütze' / ![]() Corono ducale)
gelten – nach/neben/über/hinter/vor (was
eben relational/'beziehungsmäßig' umstritten/dahingestellt bleiben mag)
Corono ducale)
gelten – nach/neben/über/hinter/vor (was
eben relational/'beziehungsmäßig' umstritten/dahingestellt bleiben mag) ![]() Familien/case (zumal eher
Familien/case (zumal eher ![]() Patrizier/Cittadini
- also
städtisch-kaufmännusch, bis Manukakturen, unternehmendeen - denn
grundherrschaftlich feudale, mit ihren, teils
unterschiedlichen/konfligierenden, Interessen)
einerseits und
Patrizier/Cittadini
- also
städtisch-kaufmännusch, bis Manukakturen, unternehmendeen - denn
grundherrschaftlich feudale, mit ihren, teils
unterschiedlichen/konfligierenden, Interessen)
einerseits und ![]() Überzeugtheiten (insbesondere davon wie Realität(en
funktionieren oder stattdessen funktional besser zusammenhängen sollten/würden
– also Theorien) weiterseits – als
älteste, bis höchstrangige, Instanz, äh
Institution, Venedigs/der Veneter (und verhaltensfaktisch – womöglich zunehmend – vergleichsweise
'souverän' gegenüber religiös( erfahren)en, 'naturgewaltlichen'
und auswärtigen/überregionalen
Autoritäten). - Das venezianische Dogenamt hat einerseits und
zunehmend an Ansehen/Einfluss und sogar ersichtlicher Macht 'gewonnen' –
respektive (auch unterschiedlich zyklenartig)
wieder 'verloren/abgegeben' – während/da 'Venedig' dies tat/so wirkte, und\aber weieterseits hat
es gleichzeitig (tendenziell, wohl nur zunehmend, komplexer – und zwar
spätestens bereits im 9. Jahrhundert mit ‚Verfassungsrang‘, durch zwei
Beisitzer /#hier-JJP-ClTo/ in Rechtsangelegenheiten, sowie eigenständige
Wahlgremien und
Gerichtshöfe/Cueien bereits Ende des 9. Jahrhundert) mehr an Kontrolle und
Rechtfertigungsverpflichtungen von/vor/in (jedenfalls seit Anfang des 12.
Jahrhunderts) zahlreicher werdenden, einander teils, auch personell,
überlappenden, wechselseitig beeinflussenden, bis prüfenden, Berater- und Beratungsgremeinen
erfahren. - (Angebliche –
zumal hoheitliche / Daseins-vorsorgliche – Sicherstellungen
und – zumal: 'verbindliche' – Ordnung/Deutung [des
Vorfindlichen und des zu Erwartenden/Kommenden]),
die – gar nicht so selten, und insbesondere auch heute (mit Ansprüchen auf
allgemeine Gültigkeit) – als nachteilig für (zumal heimliches, bis spontanes)
Regierungshandeln, wo nicht gleich als
notwendigerweise polizeilich-geheimdienstliches
Überwachungs- und Spitzelsystem, gedeutet – wo nicht interessiert diffamiert – werden.
Überzeugtheiten (insbesondere davon wie Realität(en
funktionieren oder stattdessen funktional besser zusammenhängen sollten/würden
– also Theorien) weiterseits – als
älteste, bis höchstrangige, Instanz, äh
Institution, Venedigs/der Veneter (und verhaltensfaktisch – womöglich zunehmend – vergleichsweise
'souverän' gegenüber religiös( erfahren)en, 'naturgewaltlichen'
und auswärtigen/überregionalen
Autoritäten). - Das venezianische Dogenamt hat einerseits und
zunehmend an Ansehen/Einfluss und sogar ersichtlicher Macht 'gewonnen' –
respektive (auch unterschiedlich zyklenartig)
wieder 'verloren/abgegeben' – während/da 'Venedig' dies tat/so wirkte, und\aber weieterseits hat
es gleichzeitig (tendenziell, wohl nur zunehmend, komplexer – und zwar
spätestens bereits im 9. Jahrhundert mit ‚Verfassungsrang‘, durch zwei
Beisitzer /#hier-JJP-ClTo/ in Rechtsangelegenheiten, sowie eigenständige
Wahlgremien und
Gerichtshöfe/Cueien bereits Ende des 9. Jahrhundert) mehr an Kontrolle und
Rechtfertigungsverpflichtungen von/vor/in (jedenfalls seit Anfang des 12.
Jahrhunderts) zahlreicher werdenden, einander teils, auch personell,
überlappenden, wechselseitig beeinflussenden, bis prüfenden, Berater- und Beratungsgremeinen
erfahren. - (Angebliche –
zumal hoheitliche / Daseins-vorsorgliche – Sicherstellungen
und – zumal: 'verbindliche' – Ordnung/Deutung [des
Vorfindlichen und des zu Erwartenden/Kommenden]),
die – gar nicht so selten, und insbesondere auch heute (mit Ansprüchen auf
allgemeine Gültigkeit) – als nachteilig für (zumal heimliches, bis spontanes)
Regierungshandeln, wo nicht gleich als
notwendigerweise polizeilich-geheimdienstliches
Überwachungs- und Spitzelsystem, gedeutet – wo nicht interessiert diffamiert – werden.
#Thron
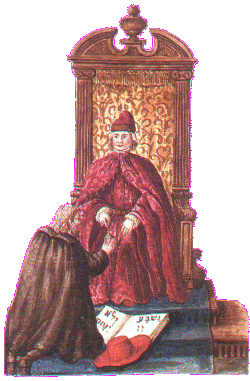 An
– nein: ‚vor‘ – ihren Thronen, wo auch immer (bis eben gerade auf die Dogenwohnung, wo es keinen gab) im Palazzo
Comunale
An
– nein: ‚vor‘ – ihren Thronen, wo auch immer (bis eben gerade auf die Dogenwohnung, wo es keinen gab) im Palazzo
Comunale 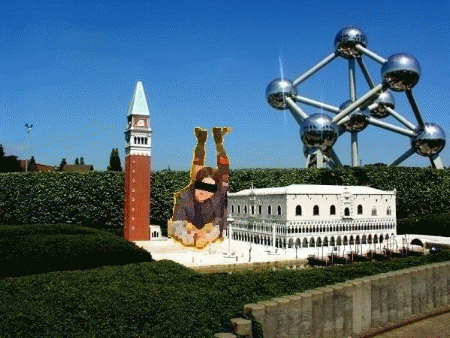 sie gerade (für
Venezia - und zumeist erst recht nicht alleine, doch am deutlichsten,
hervorgehoben) hoheitlich thronten, knieten
gar so manche Personen
– und längst nicht alle davon,, oder ständig, 'äußerlich' anatomisch respektive
sichtbar symbolisiert, zeremoniell auf physischen Knien, zudem oft eher weniger
'wörtlich'/'buchstäblich' und dennoch, oder gerade desswegen, bis eben
'inhaltlich' nennbar, deutlich fühlbar und verhaltensfaktisch eher umfassender
dauerhaft. [Abbs. Erhaltene Thronreihe der 7 - Juden verbeugen sich vor Doge
''Immerhin 'inhaltlich' (im verhaltensfaktischen Sinne jenseits der Throne
kommt es eben wenige auf die semiotischen/körperlichen Formen der Reverenzen –
sondern entscheidend auf Tund & Lassen – an.'']
sie gerade (für
Venezia - und zumeist erst recht nicht alleine, doch am deutlichsten,
hervorgehoben) hoheitlich thronten, knieten
gar so manche Personen
– und längst nicht alle davon,, oder ständig, 'äußerlich' anatomisch respektive
sichtbar symbolisiert, zeremoniell auf physischen Knien, zudem oft eher weniger
'wörtlich'/'buchstäblich' und dennoch, oder gerade desswegen, bis eben
'inhaltlich' nennbar, deutlich fühlbar und verhaltensfaktisch eher umfassender
dauerhaft. [Abbs. Erhaltene Thronreihe der 7 - Juden verbeugen sich vor Doge
''Immerhin 'inhaltlich' (im verhaltensfaktischen Sinne jenseits der Throne
kommt es eben wenige auf die semiotischen/körperlichen Formen der Reverenzen –
sondern entscheidend auf Tund & Lassen – an.'']
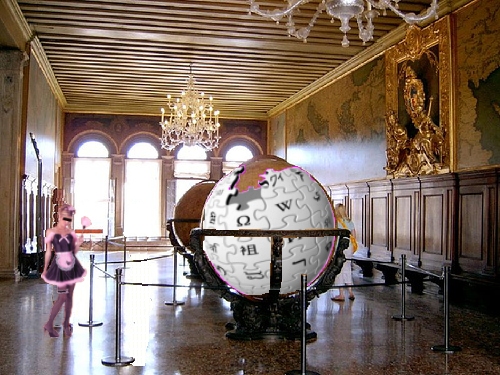 #
Ihre/Eure Hoheit eine Republik? – Sollte/muss
nicht ernstlich
überraschen, denn/wo/solange Herrschaftsformen des und der über den und die
Menschen hoheitliche (etwa anstelle von [gar intrinsisch/‚innerlich‘]
überzeugten/[überzeugenden]? - vgl. zumal tanachische Torati-Konzeptionen) sind, kommt es
formal/rechtlich weder darauf an wie sich diese Hoheit nennt, resoektive wie
sie genannt wird, noch wie legitim, nützlich pp. sie funktioniert, bis wie
nötig sie sein/werden
mag. – Dies ändert allerdings auch nichts daran, dass der Begriff der ‚republica‘ (sowie dessen
Verwendungsgeschichte – übrigens auch/gerade ‚bereits‘ beschränkt allein auf
Venedig/Venizsia) mit vielfältig unterschiedlichen, bis widersprüchlichen,
‚Sachverhalten‘, Definitionen
und Ansprüchen (daran – was sie bedeute/bewirke) respektive Vorstellungen
#
Ihre/Eure Hoheit eine Republik? – Sollte/muss
nicht ernstlich
überraschen, denn/wo/solange Herrschaftsformen des und der über den und die
Menschen hoheitliche (etwa anstelle von [gar intrinsisch/‚innerlich‘]
überzeugten/[überzeugenden]? - vgl. zumal tanachische Torati-Konzeptionen) sind, kommt es
formal/rechtlich weder darauf an wie sich diese Hoheit nennt, resoektive wie
sie genannt wird, noch wie legitim, nützlich pp. sie funktioniert, bis wie
nötig sie sein/werden
mag. – Dies ändert allerdings auch nichts daran, dass der Begriff der ‚republica‘ (sowie dessen
Verwendungsgeschichte – übrigens auch/gerade ‚bereits‘ beschränkt allein auf
Venedig/Venizsia) mit vielfältig unterschiedlichen, bis widersprüchlichen,
‚Sachverhalten‘, Definitionen
und Ansprüchen (daran – was sie bedeute/bewirke) respektive Vorstellungen  (davon
– wie sie funktioniere) assozeirt wurde – und weiterhin vielzahlig wird.
(davon
– wie sie funktioniere) assozeirt wurde – und weiterhin vielzahlig wird.
Im Sinne der
Herrschaftsausübung durch mehrere gleichrangige – unter Juristen inzwischen
‚natürlich‘ genannte - Personen,
mag der Ausdruck, selbst dann/da noch angemessen erscheinen, wenn diese dazu –
wie in dieser Serenissima (die
sich selbst damals ‚dialektisch‘, bekanntlich nur mit einem ‚s‘
orthograpgierte/aussprach), oder den Vereinigten Staaten von Amerika,
sogar die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken einer nominellen
Volksrepublik resoektive sogar einer (bisher wohl eher seltene, bis verklärend
idealisierte) Gelehrtenherrschaft – arbeitsteilig getrennt, bis stausmäßig
gestuft, aggieren. – Würde/Wird hingegen auch etwa eine repräsentative
Abbildung / anteilige Mitsprache der gesamten Bevölkerung, oder
'immerhin'/meist macher (etwa ethnischer, alterskohortischer, sprachkundiger,
weltanschaulicher, steuerpflichtiger, administartiv erfasster pp.)
Gruppoerinmgen davon (zumal 'persönlich empfunden beteiligt' in Unterschieden
zu - ja durchaus behaupteten, bis denkbaren/möglichen - jBerücksichtigungen von
deren [wenigstens/immerhin intersubjektiv
konsensfägigen] Interessen)
gemeint/gewollt – könnten unverglichlich viel größere Schwierigkeiten und Konflikte
bekannt ... Sie wissen heutzutage scjon. 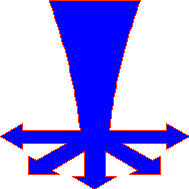
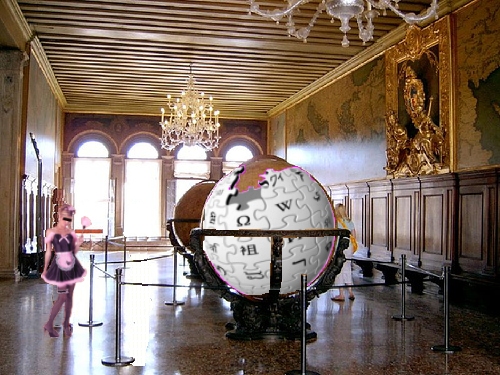 Eine weitere, hier, zu/wegen Venedig
(respektive neuzeitlichen Versuch[ung]en
‚es‘ zu besitzen/benutzen, äh
zu benennen), besonders schwierige/prekär
sperrige Begrifflichkeit
ist bekanntlich jene der ‚Adel/ung‘:
Eine weitere, hier, zu/wegen Venedig
(respektive neuzeitlichen Versuch[ung]en
‚es‘ zu besitzen/benutzen, äh
zu benennen), besonders schwierige/prekär
sperrige Begrifflichkeit
ist bekanntlich jene der ‚Adel/ung‘:
Immerhin gegenwärtig (nach kaiserlichen Verbots- bzw.
Unterwerfungsversuchen – in dieser Verwendung seit 1866-1946, Venedigs
Zugehörigkeit zum letzten ![]() Italienischen Königreich unter dem
Hause #hier
Italienischen Königreich unter dem
Hause #hier![]() Savoyen
Savoyen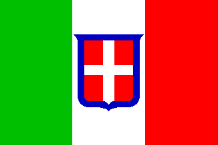 )
ist ‚Patrizier von Venedig‘ zwar ein möglicher Bestandteil
)
ist ‚Patrizier von Venedig‘ zwar ein möglicher Bestandteil ![]() italienischer
Adelstitel. – Doch, während ‚des Jahrtausends‘
hoheitlicher Serenisima der Venezia, waren die Cittadini originali
eine (alte, ursprüngliche)
Gruppierung/Minderheit der Familien, hier: case,
die in der Lagune und auch auf der umliegenden Terraferma wohnten –
insbesondere durch Handel, auch mit allerlei handwerklichen, unternehmerischen.
landwerklichen bzw.
fischereiwirtschaftlichen und diplomatischen Künsten,
über Generationen, zu erheblichen Vermögen gekommen, sowie (bis 1797 offiziell, meist durch Avvogaria di
commun) in Listen – lange dem #hier
italienischer
Adelstitel. – Doch, während ‚des Jahrtausends‘
hoheitlicher Serenisima der Venezia, waren die Cittadini originali
eine (alte, ursprüngliche)
Gruppierung/Minderheit der Familien, hier: case,
die in der Lagune und auch auf der umliegenden Terraferma wohnten –
insbesondere durch Handel, auch mit allerlei handwerklichen, unternehmerischen.
landwerklichen bzw.
fischereiwirtschaftlichen und diplomatischen Künsten,
über Generationen, zu erheblichen Vermögen gekommen, sowie (bis 1797 offiziell, meist durch Avvogaria di
commun) in Listen – lange dem #hier![]() libro d'argento / ‚Silbernes
Buch‘ - verwaltet und für wichtige administrativ ausführende Dienste im ‚Staatswesen‘
herangezogen. Die ja durchaus zutreffende Übersetzung
von ‚Cittadini‘ mit/als/in
‚Bürger‘ ist
gleichwohl nicht mit den (übrigen
neuzeitlichen, bis heutigen) Vorstellgsfirmament/en,
Assoziationsreichweite/n und Erfahrungshorizonten (des/im und vom, zumal abendländischen,‘'Bürgerlichen Zeitalter(s‘ her) selbig/identisch (wo dieser zumal
rechtliche, definierte Status – auch nicht für die gesamte Bevölkerung, gar geschlechtsunabhängig, gilt bzw.
erreichbar sei, bis ist), zumal sich hier auch nicht-venetische,
immerhin Adelige eintragen lassen, und so in venezianische Diesnte und
Berechtigungen/Sicherheit, eintreten, konnten.
libro d'argento / ‚Silbernes
Buch‘ - verwaltet und für wichtige administrativ ausführende Dienste im ‚Staatswesen‘
herangezogen. Die ja durchaus zutreffende Übersetzung
von ‚Cittadini‘ mit/als/in
‚Bürger‘ ist
gleichwohl nicht mit den (übrigen
neuzeitlichen, bis heutigen) Vorstellgsfirmament/en,
Assoziationsreichweite/n und Erfahrungshorizonten (des/im und vom, zumal abendländischen,‘'Bürgerlichen Zeitalter(s‘ her) selbig/identisch (wo dieser zumal
rechtliche, definierte Status – auch nicht für die gesamte Bevölkerung, gar geschlechtsunabhängig, gilt bzw.
erreichbar sei, bis ist), zumal sich hier auch nicht-venetische,
immerhin Adelige eintragen lassen, und so in venezianische Diesnte und
Berechtigungen/Sicherheit, eintreten, konnten.
[Nicht allein zu Venedig, oder im
sogenannten / dafür gehaltenen, bis wie und von wem auch immer angesehen,
‚Adel‘, finden (und fanden) die wesentlichsten
Auseinandersetzungen / ‚Schlechten‘ zwischen Generationen (zumindest/jeweils über vier, bis fünf, davon.
in allen Wortsinnen, ‚[weiter]vererbt‘, warnt die Tora) respektive unter Geschwistern, zumal ‚der
Familie (ursächlich [etwa prägend.
Gewalten und anderes tuend &
lassend, einiges ermöglichend …] ![]() wie zielgerichtet [etwa Muster/Gelegenheiten wiederholend, Nrdzände
sichernd / weitergebend / mehrend …] verstanden) wegen‘, statt: Dass, wie und soweit Familien(feden) auch ‚nach/von außen‘ wechselwirken mögen/sollen immerhin
venexianisch bekannt, bis (staatsrechtlich zivilisiert/weise,
gegenseitig oppositionelle ‚Clans‘ einbindend / duldend respektierend,
geregelt)
gehandhabt worden, sein]
wie zielgerichtet [etwa Muster/Gelegenheiten wiederholend, Nrdzände
sichernd / weitergebend / mehrend …] verstanden) wegen‘, statt: Dass, wie und soweit Familien(feden) auch ‚nach/von außen‘ wechselwirken mögen/sollen immerhin
venexianisch bekannt, bis (staatsrechtlich zivilisiert/weise,
gegenseitig oppositionelle ‚Clans‘ einbindend / duldend respektierend,
geregelt)
gehandhabt worden, sein]  Wiederum nur ein kleinerer Teil der alten
Wiederum nur ein kleinerer Teil der alten ![]() partrizischen – in der Literatur mancherorts
partrizischen – in der Literatur mancherorts ![]() als ‚stadtadelig‘
angesehenen – Familien (1367
waren es 204, mit wohl über zweitausend erwachsenen Männern, 1797 noch 111;
vgl. auch Bevölkerungs-Ploetz) erkannte sich (insbesondere
durch Duldung bei 'religiösen' Staatszeremonien in der Cappella ducal/Markuskirche und in
Prozessionszügen) wechselseitig
als ‚stadtadelig‘
angesehenen – Familien (1367
waren es 204, mit wohl über zweitausend erwachsenen Männern, 1797 noch 111;
vgl. auch Bevölkerungs-Ploetz) erkannte sich (insbesondere
durch Duldung bei 'religiösen' Staatszeremonien in der Cappella ducal/Markuskirche und in
Prozessionszügen) wechselseitig
 – (ab 1297 sind Listen überliefert und seit
1506/1526 bis 1797) in 'einem' der
– (ab 1297 sind Listen überliefert und seit
1506/1526 bis 1797) in 'einem' der ![]() libri d'oro
Venedigs aufgeführt, es gab/gibt hier ja mehrere Goldene
Bücher unterschiedlicher Gruppierungen, so etwa auch ein namentliches
Verzeichnis der Glasbläserzunft; und offizielle, insbesondere kommunale,
Gästebücher werden ja weiterhin so genannt, zumal bereits früh auch 'Ausländer
ehrenhalber' aufgenommen wurden (und Ursprungsfragen betreffen ohnehin drüben
das, jedenfalls flächenmäßig, größte der 'Goldenen 'Bücher' der Stadt, bis
weltweit: Etwa, nach dem. ja so
lästerlichen, bis angeblich Wehrkraft/Zusammenhalt zersetzenden, Denkmuster,
'als Adam säte und Eva spoann, wo war da der Edelmann?' oder, gar immerhin elementar wichtiger, final,
'gutes Einschreiben' /chatima towa!/ und zwar gegönnt in's 'Buch des – gar
ewigen [zumal im begrifflich qualifizierten Sinne von Randlosigkeiten] – Lebens',
welcher Färbungen dann auch immer, betreffend) –
libri d'oro
Venedigs aufgeführt, es gab/gibt hier ja mehrere Goldene
Bücher unterschiedlicher Gruppierungen, so etwa auch ein namentliches
Verzeichnis der Glasbläserzunft; und offizielle, insbesondere kommunale,
Gästebücher werden ja weiterhin so genannt, zumal bereits früh auch 'Ausländer
ehrenhalber' aufgenommen wurden (und Ursprungsfragen betreffen ohnehin drüben
das, jedenfalls flächenmäßig, größte der 'Goldenen 'Bücher' der Stadt, bis
weltweit: Etwa, nach dem. ja so
lästerlichen, bis angeblich Wehrkraft/Zusammenhalt zersetzenden, Denkmuster,
'als Adam säte und Eva spoann, wo war da der Edelmann?' oder, gar immerhin elementar wichtiger, final,
'gutes Einschreiben' /chatima towa!/ und zwar gegönnt in's 'Buch des – gar
ewigen [zumal im begrifflich qualifizierten Sinne von Randlosigkeiten] – Lebens',
welcher Färbungen dann auch immer, betreffend) –
den einen, insofern ungestuft
gleichen, parlamentarischen, regierungsfähigen und für die höchsten Staatsämter als geeignet
erscheinenden, Rang eines Nobilhòmini zu (eben auf der Basis anerkannter
männlicher Abkömmling einer Familie mit herausragenden finanziellen Möglichkeiten, bei altangestammtem Wohnsitz auf den
Laguneninseln, zu sein – die schließlich, nach Annahme eines Senatsvorschlages
zur begrenzenden Regelung der Aufstiegsmöglichkeiten / serreta von 1297, ab
Mitte des 14. Jahrhunderts einem weitgehend abgeschlossenen Kreis der
Herrschenden angehörte). Prompt wurde dieser venexianische Ausdruck (gleich 1798 und 1814) von den Habsburgern
gesetzlich verboten, und auch/schon Napoleon hatte (zumal seinerseits als Kaiser -
gar ebenfalls vergebens?) versucht sich diese, 'venezianisch'/venexian ohnehin 'Nobilòmo'
oder 'Nobiluomo' genannten, Männer als/zu ![]() Vasallen zu unterwerfen; zumal sie und ihre Familien vom
europäischen Hochadel weitgehend als 'ebenbürtig' (und
damit immerhin heiratsfähig), 'da/ja regierend' (vgl. Einteilungslogik genealogischer
Verzeichnisse wie des 'Gota'/), angesehen wurden, und einen mindestens dem entsprechenden, wo nicht eher vornehmeren und exklusiveren,
Lebensteil, mit so nobel herausgehobenem Selbstverständnis, pflegten, dass es
jenem von Fürstlichkeiten nicht nachstand – aber eben (an
ein und dem selben / jedem Ort) nicht nur eine einzelne ([aller]höchste) Familie / ein Herrscherhaus (alternativlos für sich, äh
'für alle') allein(e
führend). – Zu Venedig ist eben nichts
natürlich, schon gar nicht die Machtordnung, auch dies eine Art Brauch des Landes, more Veneto,
Vasallen zu unterwerfen; zumal sie und ihre Familien vom
europäischen Hochadel weitgehend als 'ebenbürtig' (und
damit immerhin heiratsfähig), 'da/ja regierend' (vgl. Einteilungslogik genealogischer
Verzeichnisse wie des 'Gota'/), angesehen wurden, und einen mindestens dem entsprechenden, wo nicht eher vornehmeren und exklusiveren,
Lebensteil, mit so nobel herausgehobenem Selbstverständnis, pflegten, dass es
jenem von Fürstlichkeiten nicht nachstand – aber eben (an
ein und dem selben / jedem Ort) nicht nur eine einzelne ([aller]höchste) Familie / ein Herrscherhaus (alternativlos für sich, äh
'für alle') allein(e
führend). – Zu Venedig ist eben nichts
natürlich, schon gar nicht die Machtordnung, auch dies eine Art Brauch des Landes, more Veneto, ![]() 'm.v.' gar
nicht allein/immerhin – wie 'seine' italienisch/lateinische Übersetzung: 'secondo l'uso veneto' nahelegend
vermeint – auf die Zeitrechnung beschränkt/bezogen.
'm.v.' gar
nicht allein/immerhin – wie 'seine' italienisch/lateinische Übersetzung: 'secondo l'uso veneto' nahelegend
vermeint – auf die Zeitrechnung beschränkt/bezogen. 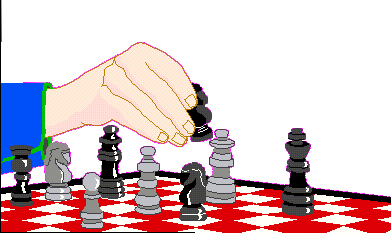
 [‚Gute
Polizeien‘ bezeichnet/e. gleich gar ‚christlich mittelalterlich‘ was #hierProvveditori überlassen] Zu den – na klar venexianischen – Familiendramen gehört/e bekanntlich auch die
Detailvarianten: (Frauen-)Klöster – nicht
etwa ‚nur‘/allein verwitwete Dogeresse betreffen s/wollende Polizien – in Sachen Familienvermögensverteilung – selbst/gerade auf Kosten ihres genealogisch(
legitimiert)en Fortbestehens – verhindern, äh ‚Moralitätswahrung zur
Segensgarantieerzwingung‘.
[‚Gute
Polizeien‘ bezeichnet/e. gleich gar ‚christlich mittelalterlich‘ was #hierProvveditori überlassen] Zu den – na klar venexianischen – Familiendramen gehört/e bekanntlich auch die
Detailvarianten: (Frauen-)Klöster – nicht
etwa ‚nur‘/allein verwitwete Dogeresse betreffen s/wollende Polizien – in Sachen Familienvermögensverteilung – selbst/gerade auf Kosten ihres genealogisch(
legitimiert)en Fortbestehens – verhindern, äh ‚Moralitätswahrung zur
Segensgarantieerzwingung‘. [Reverenzen der Nonne resch/ ר für ihre (sie nicht ‚bemitgiften‘ müssende) Familie, bis für’s (arbeitsteilig moralische Standarts an sie
einzuhalten Habende delegierende) Gemeinwesen überhaupt (ent …)]
[Reverenzen der Nonne resch/ ר für ihre (sie nicht ‚bemitgiften‘ müssende) Familie, bis für’s (arbeitsteilig moralische Standarts an sie
einzuhalten Habende delegierende) Gemeinwesen überhaupt (ent …)]
 In der
gesellschaftswissenschaftlichen Forschung werden, namentlich durch und seit
Max(imilian) Weber, drei Formen respektive Seiten/Säulen – ‚traditionelle‘,
‚charismatische‘ und ‚bürokratische/hirokratische‘ – von Herrschaft
In der
gesellschaftswissenschaftlichen Forschung werden, namentlich durch und seit
Max(imilian) Weber, drei Formen respektive Seiten/Säulen – ‚traditionelle‘,
‚charismatische‘ und ‚bürokratische/hirokratische‘ – von Herrschaft
analytisch beschrieben:  #hier
#hier
|
|
Meist eher Idealtypen, die 'sich' empirisch überwiegend in unterschiedlichen, wandelbaren
Mischungen des Verhaltens 'vor Thron und Altar' finden lassen –
illustriert/belegt/verrät hier immerhin Ihre
Hoheit die Fürstin (von Monaco bzw. dessen Herrscherfamilie –
respektive Thailands erste Ministerpräsidentin) diese
Behavioreme, als
zumeist auch, bis hauptsächlich/nur, Menschen gegenüber vollzogen/ausgeführt. |
|
|
|
Wobei eben weder 'der hohe Stuhl/The Holy See' oder 'der
geweihten Stein/Tisch' noch der immerhin symbolisch/vorgeblich
damit/darin/darüber repräsentierte 'Gott' bzw. das (Absolutheit/en bekanntlich überindividuell
konkretisierende, bis beanspruchende, gar singulär ersetzende) Gemeinwesen – und auch nicht einmal immer notwendigerweise anatomische
Kniebewegungen – derart deutlich veröffentlichet, dabei zu sehen sein
müssen/werden. |
|
|
|
|
|
|
|
 Ratgebende, gar
kritische/opossitionelle, bis Senate und ganze (Rats-)Versammlugen – zumal verstanden (bis realisiert) als Gelehrtengremien der
Weisen/Klugen respektive Erfahrenen einer soziokulturellen Figuration
(womöglich, bis möglichst, gesammtgesellschaftlich) – haben zwar bekanntlich
einige Vorzüge (sogar von/in Kompromissen, Inkremantalismus pp.) und Nachteile
(zumal in/von Kompromissen, Inkrementalismus
pp.) gegenüber Entscheidungsverfahren
von/durch individuelle/n Menschen/Amtsträgern (weit oben, allein an der
Statuspitze) - doch gelten dort/so – ok,
Schreckwortwarnung - 'kollektiver' zustande gekommene Be- und
Entschlüße zumeist als
umfassender durchdachte Rechtsprechung (selbst 'Minderheitsvoten' können versähnen,
spalten jedenfalls nicht nur illoyal dauerhaft spalten), bis als besser qualifiziertes und etwa
breiter akzeptableres/unterstütztes Regierungshandeln (sogar, bis gerde, verglichen mit konzentrierter
Entscheidungsmacht heldenhafter und/oder inspirierter Charismatiker/Sympatieträgerinnen
an der/als
Regierung – wobei sich die Veneter/Venezianer ja gerade die integrierenden,
zusammenhaltenden und Kontinuitäten stiftenden Funktionen, plus die nicht
weniger wichtige. 'mehrfach' lebenslange Erfahrung ihrer höchstranigen Amtsträger, auch an der bürokratischen Verwaltungsvollzugsspitze
sowie ihrer Ratsmitglieder erhielten/sicherten):
Ratgebende, gar
kritische/opossitionelle, bis Senate und ganze (Rats-)Versammlugen – zumal verstanden (bis realisiert) als Gelehrtengremien der
Weisen/Klugen respektive Erfahrenen einer soziokulturellen Figuration
(womöglich, bis möglichst, gesammtgesellschaftlich) – haben zwar bekanntlich
einige Vorzüge (sogar von/in Kompromissen, Inkremantalismus pp.) und Nachteile
(zumal in/von Kompromissen, Inkrementalismus
pp.) gegenüber Entscheidungsverfahren
von/durch individuelle/n Menschen/Amtsträgern (weit oben, allein an der
Statuspitze) - doch gelten dort/so – ok,
Schreckwortwarnung - 'kollektiver' zustande gekommene Be- und
Entschlüße zumeist als
umfassender durchdachte Rechtsprechung (selbst 'Minderheitsvoten' können versähnen,
spalten jedenfalls nicht nur illoyal dauerhaft spalten), bis als besser qualifiziertes und etwa
breiter akzeptableres/unterstütztes Regierungshandeln (sogar, bis gerde, verglichen mit konzentrierter
Entscheidungsmacht heldenhafter und/oder inspirierter Charismatiker/Sympatieträgerinnen
an der/als
Regierung – wobei sich die Veneter/Venezianer ja gerade die integrierenden,
zusammenhaltenden und Kontinuitäten stiftenden Funktionen, plus die nicht
weniger wichtige. 'mehrfach' lebenslange Erfahrung ihrer höchstranigen Amtsträger, auch an der bürokratischen Verwaltungsvollzugsspitze
sowie ihrer Ratsmitglieder erhielten/sicherten):
![]() Formell
codifiziert wurden Venedigs Dogen – und zwar bereits im 9. Jahrhundert -
zunächst
Formell
codifiziert wurden Venedigs Dogen – und zwar bereits im 9. Jahrhundert -
zunächst ![]() für richterliche Funktionen zwei 'adelige'/patrizische
Männer/Nobiluomo als 'judices' zur Seite gestellt – jeweils gerade nicht
den Dogen stellende, bis oppositionelle, 'Adelssippen'/Nobiluomo-Familien
(und insbesondere Mitte des 12. Jahrhunderts auch ganze
für richterliche Funktionen zwei 'adelige'/patrizische
Männer/Nobiluomo als 'judices' zur Seite gestellt – jeweils gerade nicht
den Dogen stellende, bis oppositionelle, 'Adelssippen'/Nobiluomo-Familien
(und insbesondere Mitte des 12. Jahrhunderts auch ganze ![]() 'Stadtteilfraktionen')
hatten allerdings bereits, wiederholt, auch recht blutig ausgefochtene. Einflüsse
auf dogales Handeln genommen/gehabt – und setzten schließlich sechs (einen für
jeden der Sestieri/Inselstadtteile) 'Berater' respektive 'Weise' (sapientes
oder savi, später auch consiglieri oder preordinati – ind schließlich als es
seit 1380 meherere derartig mächtiger, gar 'sachverständiger' Gremeinen gab
savi grandi) gennante, vom Großen Rat (und bereits einer Art kommunalem
Vorläufer – bereits im 12. jahrhundert: auf zunächst zwölf, später achtzehn,
Monate begrenzte Amtszeit und für mindestens einer weitere oausieren
müssend).gewählte Nobiluomo, als eigentliche, venezianische
'Regierung'/consiglio minore, durch, die (spätestens
seit dem 13. Jahrhundert) sämtliche offiziellen 'Staatsgeschäfte' 'des, bis für
den, Dogen(/Venezias)' mehrheitlich entscheiden'/gegenzeichnen' mussten.
'Stadtteilfraktionen')
hatten allerdings bereits, wiederholt, auch recht blutig ausgefochtene. Einflüsse
auf dogales Handeln genommen/gehabt – und setzten schließlich sechs (einen für
jeden der Sestieri/Inselstadtteile) 'Berater' respektive 'Weise' (sapientes
oder savi, später auch consiglieri oder preordinati – ind schließlich als es
seit 1380 meherere derartig mächtiger, gar 'sachverständiger' Gremeinen gab
savi grandi) gennante, vom Großen Rat (und bereits einer Art kommunalem
Vorläufer – bereits im 12. jahrhundert: auf zunächst zwölf, später achtzehn,
Monate begrenzte Amtszeit und für mindestens einer weitere oausieren
müssend).gewählte Nobiluomo, als eigentliche, venezianische
'Regierung'/consiglio minore, durch, die (spätestens
seit dem 13. Jahrhundert) sämtliche offiziellen 'Staatsgeschäfte' 'des, bis für
den, Dogen(/Venezias)' mehrheitlich entscheiden'/gegenzeichnen' mussten. 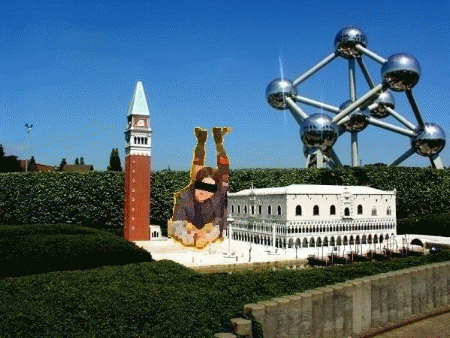 Die
bis heute vorfindliche Sala degli Scarlatti (Rundgang
#5), im Palazzo Comunale den l'appartemento ducale/Dogenwohnung im 'Ostflügel' zugehörig, wurde bekanntlich (nach/seit
dem letzten großen Brand) in der Farbe der Antsgewänder der Ratgeber des Dogen
gehalten, danach benannt - und von ihnen (bis 1797)
bei der Amtsausübung genutzt. - Übrigens hatte der selsbt zumeist nicht
simmbereichtigte Doge den Vorsitz fast aller wichtigen venezianiscjen
Insitutionen, und zusammen mit dem meist boch länger gedienten Leiter seiner
Kanlei (), einen sonst unereichten Über- und Einblick des hoheitlichen
Handelns Venedigs und seiner politischen Hinter-, bis Beweggründe. Falls/Soweit
und wo von 'der Entmachtung' des Dogen gesprochen werden s/wollte drohen
indirekte und formelle Aspekte seines/des Amtes Einflusses
vergessen/unterschätz zu werden.
Die
bis heute vorfindliche Sala degli Scarlatti (Rundgang
#5), im Palazzo Comunale den l'appartemento ducale/Dogenwohnung im 'Ostflügel' zugehörig, wurde bekanntlich (nach/seit
dem letzten großen Brand) in der Farbe der Antsgewänder der Ratgeber des Dogen
gehalten, danach benannt - und von ihnen (bis 1797)
bei der Amtsausübung genutzt. - Übrigens hatte der selsbt zumeist nicht
simmbereichtigte Doge den Vorsitz fast aller wichtigen venezianiscjen
Insitutionen, und zusammen mit dem meist boch länger gedienten Leiter seiner
Kanlei (), einen sonst unereichten Über- und Einblick des hoheitlichen
Handelns Venedigs und seiner politischen Hinter-, bis Beweggründe. Falls/Soweit
und wo von 'der Entmachtung' des Dogen gesprochen werden s/wollte drohen
indirekte und formelle Aspekte seines/des Amtes Einflusses
vergessen/unterschätz zu werden.
Alle ‚Ratgeber‘ des Dogen,
bis (oder sogar, diesen inklusive, eigentlich/also) ‚der
historischen Venezia‘ als Gemeinwesen überhaupt, wurden allmählich / lassen sich
in/zu zweierlei – teils mit der Zeit zunehmend, insbesondere zu wechselseitigen
Kontrollzwecken, weiter ausdiffernzeierte – Gremienkategorien, für eher
alltägliches hoheitliches Handeln (des 'Kleinen Rates')
verus eher paradigmatisch-startegisches und über das Führungspersonal
entscheidendes Hoheitshandeln (des 'Großen Rates')
einteilen/zurechenen. Wobei 'beide Seiten' sowohl exekutive, legislative und
judikative Funktiopnen verbunden, als auch miteinander um Zuständigkeiten
konkurriert, bis einander kontrolliert, haben. Wissenschaftliche Analysen
bemerken/betonen, bis bewundern,die – hier innerhin über mehr als sieben
Jahrhunderte schriftlich belegbar andauerende - Gemeinsamkeit: Dass 'zu Venedig' jene Ämter,
die entscheidenen politischen
– Wohl und Wehe vieler Mensc hen elementar betreffenden - Einfluss hatten, auf
eher kurze Zeit (kaum eines für mehr als 12 Monate – und nur nach einer
ebensolnagen Pause wiederwählbar) vergeben wurden; während, bis wogenen, jene
Ämter mit besonders hohem Ansehen und
zermeoniellen, bis sogar formellem (also Beschluss- und
Durchsetzungsverfahren wesentlich beeinflussendes, bis nutzendes) Perstige
(tendenziell alle, Dogen, Prokuratorren, Mitgliedschaft im Großen Rat und sogar
das wichtigste der 'aus dem Silbernen Buch' venezianiscjer 'Bürgerschaft'/Cittadini
partrizisch besetzen Verwaltungsposten des
Großkanklers und Leites der Dogenkanzlei) auf hilfreich verbeleibende
Lebenszeit besetzt (ohne Rücktritsrecht, aber jederzeit entlass- und dann auch
anklagbar) – und zudem sämtliche Amtsführungen kontinuierlich und wiederholt,
mehrfach (zumal beim Dogen nochmals nach seinem
Tode, wegen möglicher Schadensersatzansprüche
gegen seine Familie) genau/streng kontrolierend/begleitet wurden.
![]() Sehr
lange und ebenfalls bereits früh (exemplarisch erstmals seit byzantinischer Einfluss zurück gegenagen, Venedig mehr am
Frankenreich orientiert, war und sich der beratende und Dogen
wählende
Sehr
lange und ebenfalls bereits früh (exemplarisch erstmals seit byzantinischer Einfluss zurück gegenagen, Venedig mehr am
Frankenreich orientiert, war und sich der beratende und Dogen
wählende ![]() plácito / placitum, Ende des 9. Jahrhunderts. auch als Gerichtshof/curia, urkundlich
belegt, etablierte - sowie dann, seit dem 12. Jahrhundert, ausführlich und
nahezu lückenlos überliefert) bestanden also auch Formen
eines/des Großen 'Rates (zunächst etwa) der 500' (ums Jahr 1200 gehörten ihm
faktisch wohl knapp über 40 Mitglieder an – seit/zumal damals insbesondere
Kraft wechselseitiger Anerkennung als solche
plácito / placitum, Ende des 9. Jahrhunderts. auch als Gerichtshof/curia, urkundlich
belegt, etablierte - sowie dann, seit dem 12. Jahrhundert, ausführlich und
nahezu lückenlos überliefert) bestanden also auch Formen
eines/des Großen 'Rates (zunächst etwa) der 500' (ums Jahr 1200 gehörten ihm
faktisch wohl knapp über 40 Mitglieder an – seit/zumal damals insbesondere
Kraft wechselseitiger Anerkennung als solche ![]() Nobilhòmini) erwachsenen Männer aus
lokalen, eben besonders angesehenen case
Nobilhòmini) erwachsenen Männer aus
lokalen, eben besonders angesehenen case ![]() nobiluomo, gar 'adelig' genannten/gebärdenden, Patrizierfamilien
in der Lagune – sich zwar, zumindest 'legendär',
auf eine / gewählt aus der 'Volksversammlung' hervorgehend/zurückführend
empfanden haben mag, jedenfalls so dargestellt wurde/wird; die aber höchstens
eine solche Versammlung wie jene der als '(ur)demokratisch',
bis vorbildlich, gepriesenen
nobiluomo, gar 'adelig' genannten/gebärdenden, Patrizierfamilien
in der Lagune – sich zwar, zumindest 'legendär',
auf eine / gewählt aus der 'Volksversammlung' hervorgehend/zurückführend
empfanden haben mag, jedenfalls so dargestellt wurde/wird; die aber höchstens
eine solche Versammlung wie jene der als '(ur)demokratisch',
bis vorbildlich, gepriesenen ![]() Oligarchien
Oligarchien ![]() der
Antike (etwa mancher. männlicher Athener auf dem Areopark) aus qua
Besitzstandsminimum mit sogenannten 'Bürgerrechten' ausgestatteten, da nicht zu
Vasallengefolgschaft oder Sklavendiensten verpflichteten/gezwungenen (insofern
'freien'), Männern – also
aus einem vergleichsweise kleinen (leicht in einem Amphietehater
oder auf dem Forum/Markzpatz unter zu bringenden, überschaubaren)
Bevölkerungsanteil - des Landes bestanden. Das Streben nach Zugang zur
Mitgliedschaft in diesem Maggior consiglio gilt zwar mit dessen als 'Schließung' verstandener, bis praktizierter
der
Antike (etwa mancher. männlicher Athener auf dem Areopark) aus qua
Besitzstandsminimum mit sogenannten 'Bürgerrechten' ausgestatteten, da nicht zu
Vasallengefolgschaft oder Sklavendiensten verpflichteten/gezwungenen (insofern
'freien'), Männern – also
aus einem vergleichsweise kleinen (leicht in einem Amphietehater
oder auf dem Forum/Markzpatz unter zu bringenden, überschaubaren)
Bevölkerungsanteil - des Landes bestanden. Das Streben nach Zugang zur
Mitgliedschaft in diesem Maggior consiglio gilt zwar mit dessen als 'Schließung' verstandener, bis praktizierter ![]() 'serreta',im Jahre 1297, als abgeschlossen, doch
erhileten auch danach (damit/dadurch als nobiliomo/'adelig'
angesehenen, und seit 1315 vzw. 1506 in deren – 1797 'gebrantopferte'
- Verzeichnis, zeitweilig von den sie beaufsichtigenden Avvogaria di Commun
als
'serreta',im Jahre 1297, als abgeschlossen, doch
erhileten auch danach (damit/dadurch als nobiliomo/'adelig'
angesehenen, und seit 1315 vzw. 1506 in deren – 1797 'gebrantopferte'
- Verzeichnis, zeitweilig von den sie beaufsichtigenden Avvogaria di Commun
als ![]() 'Goldenes Buch'
geführt, aufgenommenen) Familen (und einzelne zumal ausländische Männer
ehernhalber – vermutlich ohne Stimm- eventeull aber mit Rederecht) die
lebenslange Mitgliedschaft, all ihrer männlichen (bis 1376 wohl auch unehelich
geborenen Familien-)Angehörigen ab dem Alter von 20/21 respektive später ab 25
Jahren, ma klar - auf
Antrag und beurkundet, verliehen (so dass die Wahlen neuer Mitglieder
dieses Rates durch seine bisherigen bereits seit dem 14. Jahrhundert meist –
mit Ausnahme der wenigen anerkennenden Neuaufnahmen/'Adelungen' ganzer Familien,
insbesondere meherer ''case nuove' im 14. und 'case nuovissime' im 27.
Jahrhundert - ein reiner/bloßer Verwaltungsakt waren. - Und wer nicht 'in
Gefahr geraten' wollte, bis zum hösten Staatsamt etc. verpflichtet werden zu
können,,hatte seinerseits, zumal soweit seine Familie mitmachte/wollte,
durchaus die Wahlmöglichkeit überhaupt nicht
Mitglied/haftbar zu werden).
'Goldenes Buch'
geführt, aufgenommenen) Familen (und einzelne zumal ausländische Männer
ehernhalber – vermutlich ohne Stimm- eventeull aber mit Rederecht) die
lebenslange Mitgliedschaft, all ihrer männlichen (bis 1376 wohl auch unehelich
geborenen Familien-)Angehörigen ab dem Alter von 20/21 respektive später ab 25
Jahren, ma klar - auf
Antrag und beurkundet, verliehen (so dass die Wahlen neuer Mitglieder
dieses Rates durch seine bisherigen bereits seit dem 14. Jahrhundert meist –
mit Ausnahme der wenigen anerkennenden Neuaufnahmen/'Adelungen' ganzer Familien,
insbesondere meherer ''case nuove' im 14. und 'case nuovissime' im 27.
Jahrhundert - ein reiner/bloßer Verwaltungsakt waren. - Und wer nicht 'in
Gefahr geraten' wollte, bis zum hösten Staatsamt etc. verpflichtet werden zu
können,,hatte seinerseits, zumal soweit seine Familie mitmachte/wollte,
durchaus die Wahlmöglichkeit überhaupt nicht
Mitglied/haftbar zu werden). 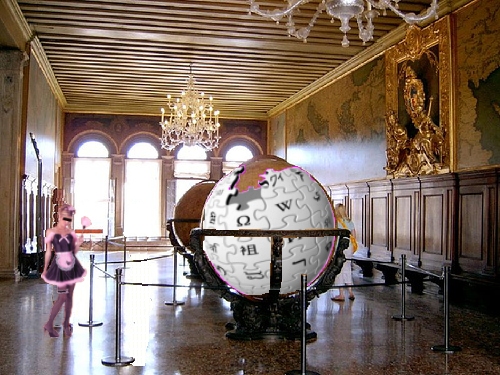 Diese
‚Paralamente‘ wurden allerdings und also nicht in dem Sinne (‚aktiv‘) gewählt, dass sie zumal als Repräsentaten
eingesetzt wurden, sondern kamen (insofern quasi bereits ‚passiv‘) durch Duldung, bis Einladung, ihrer
‚Mitglieder‘ durch diese/seitens dieser/anderen selbst zustande. – Mit derart
erheblichen Streitigkeiten über die Zusammensetzung, dass jedenfalls zu
Venedig, der Senat/Äktestenrat als Ausschuss zu deren
Regelung begründet/verwendet wurde.
Diese
‚Paralamente‘ wurden allerdings und also nicht in dem Sinne (‚aktiv‘) gewählt, dass sie zumal als Repräsentaten
eingesetzt wurden, sondern kamen (insofern quasi bereits ‚passiv‘) durch Duldung, bis Einladung, ihrer
‚Mitglieder‘ durch diese/seitens dieser/anderen selbst zustande. – Mit derart
erheblichen Streitigkeiten über die Zusammensetzung, dass jedenfalls zu
Venedig, der Senat/Äktestenrat als Ausschuss zu deren
Regelung begründet/verwendet wurde. 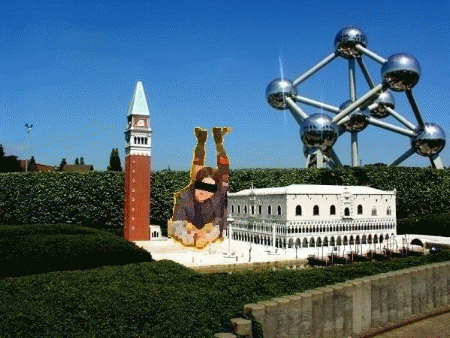 Eine/Die wohl deutlischste Zunahme der Mitgliederanzahl des Großen
Rates bis auf über 2.700 (wenn auch zu keiner ‚Sitzung‘ vollzählig
zusammenstehend anwesenden) Männern im 16. Jahrhundert gilt als wichtiger Anlass für
den gotischen Ausbau des Palazzo Comunale mit den rießigen Saal zur Versammlung dieser hoheitkichen
Institution der 'Adelsrepublik'/Nobiluomooligarchie im
(bis ‚als‘) Südflügel des heutigen
Gebäudekomplexes.
Eine/Die wohl deutlischste Zunahme der Mitgliederanzahl des Großen
Rates bis auf über 2.700 (wenn auch zu keiner ‚Sitzung‘ vollzählig
zusammenstehend anwesenden) Männern im 16. Jahrhundert gilt als wichtiger Anlass für
den gotischen Ausbau des Palazzo Comunale mit den rießigen Saal zur Versammlung dieser hoheitkichen
Institution der 'Adelsrepublik'/Nobiluomooligarchie im
(bis ‚als‘) Südflügel des heutigen
Gebäudekomplexes.
Sehr eng (auf piano 1° nobile gar durch gleich
zweierlei/beiderlei südliche Portale – für/von ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ votierend?) damit verbunden ist ja auch der (Bauteil des) Westflügel(s) südlich vom Kuppel(n)bau, mit dem, und für
den zweiten ‚gewaltigen‘, beinahe genau
so großen Versammlungsraum der Sernisima: Sala
dello Scrutinio (Rundgang #28/R).
[Abb. Südwand mit Portalen und Gerichtsgemälde über
Thronetribüne]
Denn zu den wichtigsten Aufgaben / Funktionen (zumindest) dieses Großen Rates (gar des und der Menschen
überhaupt) gehört,
äh gehörte, es (durchaus bemerkte, reflektierbare, bis in mehrerlei Wortsinnen ‚übersehene‘, zumal auch in Entscheidungsverweigungsfällen
gefallene)
Wahlentscheidungen zu treffen – zumal solche in Personalfragen (gar inklusive jener, besonders
unausweichlichen: ‚Wer, zumal wenn nicht eben ich, was, wie [hier und jetzt] zu tun respektive zu unterlassen
…?‘). – Na klar (jedenfalls zu und f+r Venedig), unter einer Darstellung des ‚Jüngsten
Gerichts‘ Gottes, jedenfalls angesichts des
Futurum exactums / vollendeter Zukunft(en –
über das Hier und Jetzt hinaus, [auch} hinterher [vollständiger ‚informiert‘],
beurteilt werdend).
Ein wesentlicher (Komplexitäten
reduzierender) Aspekt
des Wählens besteht eben darin, aus sehr vielen optionalen (also nicht gleichzeitig und nicht alle
gemeinsam durchführbaren) Alternativen, jene herauszufinden, die überhaupt akzeptabel, nis
wünschenswert, erscheinen. – Ein so wichtiger. Durchaus bereits mit Konflikten
und Befürchtungen behafteter, erster
tückischer Schritt (der
Möglichkeitenfindung und –bewertung) dass er (bis
heute) nur
allzu gerne unterlassen, ignoriert oder als (arbeitsteilig/autoritativ/inspirativ) erledigt betrachtet wird: Indem von (unterstellten, bis immerhin vorgelegten) Entscheidungsvorschlägen ausgeganagen werden
solle/müsse oder will, äh (bis die Möglichkeit oder Zulässigkeit anderer Verfahrensweisen
bestritten / eingespart – Führungsanspruch-verdächtige Symptomwortfelder:
‚alternativlos notwendig‘) wird. – Ganz besonders heftig schlägt diese Tendenz wiederum in
Personalfragen zu. Da/wo/falls es etwas Besonders sein/werden mag für etwas
Besonderes geeignet, bereit etc. zu sein. – Ohnehin kann sich keine (zumal
keine neuzeitliche) Gesellscgaft leisten, zu warten, bis genügend Menschen
hinreichend weise/intelligent geworden sind, sondern diese so verwenden muss
wie sie vorzufinden (doch
durchaus künftig änderbar/lernfähig – also unberechenbar
bleibend/kontrollbedürftig) erscheinen, bis sind.
Die Dogenwahlverfahren Venedigs verbanden eine Mehrzahl
Personenuswahlmöglichkeiten, bis auf jene eher willkürlich freier Berufung
durch einzelne Personen bzw. Gruppierungen, mit allerlei vor- und Nachteilen
bezüglich der Manipulationsthematik, die – bzw. deren omnipräsenter Verdacht –
maßgeblich zur aufwendigen Komplexität beitrug.
Zwar verstehe, bis
unterstütze, ich manche (wenigstens
provokationsärmer belehrend / übergriffige) Apelle / Versuche: gerade nach / wegen Abstimmung(sentscheidung)en auf Rache
und Siegesfeiern zu verzichten –
doch! LaMeD zumal und
zumindest auf Überzegungsänderungsbemühungen nicht etwa immer vorbehaltelos. –
Selbst wenn die Mehrheit ‚Unrecht‘ hätte / täte, hat sie so viel Macht, dass
diese nicht unbegrenzt durchgesetzt werden darf! Sogar wenn die Minderheit
/ Unterlegene ‚Recht hätte‘, darf das Verfahren nicht so gestaltet / blockiert
werden, dass Entscheidungen undurchführbar sind / (oder auf Empfindungs- bis
Überzeugungsänderungen / Bekehrung ‚Andersdenkender / Ungläubiger‘ angewiesen) werden (auch deren hinreichend unterstützendes Verhalten dennoch, bis
daher, nötig oder erzwingbar sein kamm/wird)! Gerichtliche und
politische (zumal rechtlich und
parlamentarisch zivilisiert gemäßigte) Verfahren sind nicht allein ‚materiell‘ (um herauszufinden was / wer sachlich /
tatsächlich: vorgefallen, gegeben, zu tun möglich, urheberlich, besser, falsch,
gerecht, nötig, motivational, wichtig
pp. – wo also viele sich ohnehin gewiss,
dass ‚die Andern‘ bestenfalls irren) auf so verhältnismäßig komplex erscheinende ‚äußerliche‘
Formalismen verwiesen.
Abb.-bowing-Lordpresident-GB
Institutionen / Menschen irren durchaus – ohne
dadurch Würde / Observanz verlieren zu müssen-!/?/-/. [Mich
einsehbaren Gesetzen, bemerkten
Burgfriedensregeln, gar lokalen Sitten und Gebräuchen, bis immerhin
transpartent(
beachteten, gar antitotalitär)en Verfahrensweisen, zu beugen – fällt manchmal schon schwer gwnug – einem / mir bis uns / Elieser
gutachterlich
falsch / böse vorkommendem Ansinnen / Menschen / G‘tt gegenüber kaum weniger] Dürfen / Mussten Frauen / Juden / Kinder da genügend üben, Personen und ‚deren‘
Verhaltenswahrnehmungen
auseinander zu halten?  [Reverenzen
sind/werden – allerdings (zudem) folglich unabhängig-ups von der Gesten Aussehen(svielfalten und Anlassvielzahlen) /
Ansehen / Be-, An- und Umstand / Wandel / Wortlaut (als ‚Referent/zen‘ /
Handlungsweise / Formalie / Bewegungen) – allenfalls duldend beziehungsrelational:
sich unübergriffig, gar ausliefernd erscheinende, Annäherungen / Störungen /
Vorsichten / Zumutungen, doch eben dabei / dazu Respektdistanzen-wahrende
/ wiederherstellende (immerhin sehr gefühlsrelevante) Bitten / Dankbarkeiten / sorrys / äußerlich-geäußerte
Erkennenssignal- (als ‚Feinde‘, ‚Freunde‘ und ‚jenseits davon‘) bis Verstehensgrüße – aber eben gerade keine
[Reverenzen
sind/werden – allerdings (zudem) folglich unabhängig-ups von der Gesten Aussehen(svielfalten und Anlassvielzahlen) /
Ansehen / Be-, An- und Umstand / Wandel / Wortlaut (als ‚Referent/zen‘ /
Handlungsweise / Formalie / Bewegungen) – allenfalls duldend beziehungsrelational:
sich unübergriffig, gar ausliefernd erscheinende, Annäherungen / Störungen /
Vorsichten / Zumutungen, doch eben dabei / dazu Respektdistanzen-wahrende
/ wiederherstellende (immerhin sehr gefühlsrelevante) Bitten / Dankbarkeiten / sorrys / äußerlich-geäußerte
Erkennenssignal- (als ‚Feinde‘, ‚Freunde‘ und ‚jenseits davon‘) bis Verstehensgrüße – aber eben gerade keine Gefolgschaft
oder Zustimmungszeichen – obwohl/weil sie (nicht alleine
‚verbale‘ oder ‚inhaltliche/sachliche‘) allzugerne (appellierend / betörend / ersatz-,
zwangs- oder verfügbarerweise) so
eingesetzt / verlangt / umverstanden …] 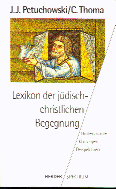
Begriff,
biblische Grundlagen
In den alt- und neutestamentlichen [sic!]
Schriften meint Erwählung ein
Hineingenommen werden in Gottes bbesondere
Fürsorge und eine damit verbundene
Einverleibung [sic!]
ins [sic!]
Volk
Gottes hinein
oder eine Assozeierung mit dem Volk
Gottes. [sic! vgl. unten b) und die
omnipräsente Unschrärfe/Konflikthaftigkeiten zwischen Individualität und bzw.
zu Komunitäten der ganzen ‚Volks-‚ bis ‚Gemeinwesens‘-Konzeptionen; O.G.J.]
Die Erwählungsgemeinschaften [sic!] werden so in soziologischer Sichtweise
zu einer „Kontrast Gesellschaft“,
die den machtbesessen,
unterdrückerischen und selbstüberheblichen Mächten dieser Welt [sic!]
gegenüber steht (Lohfink 1M ). Verwandte
Begriffe sind Berufung, Erlösung [sic!], Heil, Tröstung, Bund u.a. Weil sich
im Zusammenhang t nit
diesem religiösen [sic! längst nicht
allein solchen, zumal politisch; O.G.J.] Intimbegriff leicht
Chauvinismen und Exklusivismen breit
machen konnten und können, ist auf
folgenden Grundbedingungen zu
insistieren, ohne die Erwählung nicht möglich ist und vor allem nicht
durchgehalten werden kann:
a) Kein Mensch und keine Gruppe hat
von sich auseinen Anspruch
auf Erwählung. Am Anfang, in der Bewährungszeit und in der endzeitlichen
Vollerfüllung (synieleia, Eschaton) besteht die erwählungskausale
Zuwendung Gottes. Die primäre Rolle des frei berufenden, erwählenden und
verzeihenden Gottes (in christlicher Sicht:
des Gottes Israels durch den
auferstandenen Christus [sic! jedenfalls Jeschua/Jesus; O.G.J.])
darf nicht verwischt
und verdunkelt werden (Num 16, 5 -7;
Dtn 18, 15; Ri 2, 18; 3, 9; 1 Sam 2, 35;
2 Sam 7, 12; 1 Kön 11, 14; 1 Chr 5, 26;
Jes 41, 2.8-10; 51, 2f; Joh 15, 16; Apg
15, 7; Eph 1, 4).
b) Niemand wird für sich selbst, zu
seiner privaten [sic!]
Erhöhung, erwählt,
sondern nur im Hinblick auf
Mitmenschen, denen das Heil durch die Erwählung einzelner mitermöglicht werden
soll. Erwählung ist ihrer Intention
nach auf „ganz Israel“ bezogen (in
christlicher Sicht: Israel- und
Menschheitsbezogen [sic! was durchaus den Universalitischen Aspekten
jüdischerseits entspricht, auch wenn diese mit anderen Mitteln, in anderen
Weisen, zum Ausdruck kommen mögen als christliche Ansprücje – war Israel nie,
und verstand sich kaum je, nur für und um/für seiner selbst willen da, wie ihm
immern noch zu gerne vorgeworfen wird; O.G.J. vgl. Th.Ck. oben a)]),
hat also ein gesellschaftlich-soziales [sic! bis durchaus ‚globales‘/menschenheitliches;
O.G.J.] Ziel. Man kann Erwählung daher auch als ein Amt bezeichnen,
das von Gott zum Dienst an der stets größer werden sollenden Gemeinschaft [sic!]
der Erwählten [sic!
nämlich allen? zumindest jener die dies(e Erwählung) auch wollen/akzeptieren
(wärend soziokultureller- und politischer-, bis staatlicherseits, also unter
Menschen, Zwangszugehörigkeiten vorkommen, bis vorherschen. mpgen) O.G.J.] eingerichtet
wird. In Sach 3, 8 (vgl. Ez 12, 6) steht für Beauftragte der Erwählung der
Ausdruck 'anšê môfet: ### Männer
des
Zeichens, des Beweises für Gottes
tröstendesund heilendes Wirken, des
Hinweises auf Gottes Bereitschaft zum
Verzeihen und Authelfen (vgl. Dtn 7, 6;
14, 2).
c) Die Erwählungsgemeinschaft [sic!]
bringt
es in historischer Zeit nicht fertig,
dem
steten Erwählungsrufen Gottes so vollzu
entsprechen, wie dies etwa in der
Priesterschrift (Num 9, 15-23)
idealtypisch dargestellt wird. Die Erwählungsgeschichte Israels und der Kirche [sic!]
ist auch eine Geschichte des Aufruhrs,
des Abfalls und [sic!]
der Sünde (Ex 32-34;
M t 20, 16). Dem Judesein muß daher in
Lebenslangem Ringen das Judewerden
- 58 -
ERWÄHLUNG
und dem Christsein das Christwerden
folgen [sic!] (1 Petr 2, 1-10). Daß es trotz
andauerndem Menschlichem Versagen
das erwählte Volk [sic!]
Gottes nachwievor
gibt - dies ist Grundlegende jüdische
und christliche Glaubensüberzeugung -,
ist einzig der Treue Gottes und seiner
Überlegenheit über die Bundesbrüche
der Menschen zuzuschreiben (J es
4, 2-6; 10, 20-23; 28, 16f; Jer 18, 11;
25, 5: 31, 31-34; Röm 9-11).
d) Gott allein weiß um die Zahl und
die Effizienz der Gemeinschaften [sic!]
der
Erwählung. Den Menschen ist nur
kundgetan, daß das [sic!]
Volk Gottes ein
Segen für die Völker sein wird (Gen
12, 3) und daß es so zahlreich sein
wird
wie die Sterne des Himmels (Gen
15, 5) und der Sand am Meer (Gen
22, 17; 32, 13) . Nach 1 Chr 21 wurde
David schwer bestraft, weil er aus
machtpolitischem Interesse den Befehl
gegeben hatte, die Israeliten zu
zählen,
„damit ich weiß, wie viele es sind“
( V. 2). In Offb 7 wird gesagt, daß
Gott
die Vollzahl aus allen Stämmen Israels
(sc. die Besiegelten) retten wird (V.
4-8): und danach „eine große Schar aus allen
Nationen, Stämmen, Völkern und
Sprachen, die Niemand zu zählen vermochte“
(V. 9), den Besiegelten beigesellen wird. Der Zuzug [sic!]
der Völker ist
Bereits ein Grundtenor der Hebräischen
Bibel (z.B. Sach 2, 15: „es werden sich
viele Völker Israel zugesellen“). Die
Hoffnung, daß das Israel Gottes reichen
Zuzug aus der Völkerwelt [sic!] erhalten wird, ist die Krönung der
Erwählung Abrahams und Israels (vgl. Joel
3,
l-5; Apg 2, 14-36; Röm 10, 13).
Dieser Zuzug ist aber nur möglich,
wenn kein Antisemitismus mit im Spiele
ist (Dtn 32, 10; Sach 2, 12).
Erwählungskonkurrenz
,.Die
Erwählung ist zwischen Judentum
Christentum (und Islam) strittig.
und zwar so stark, daß daraus eine
schaurige Geschichte des Antijudaismus
und der scharfen jüdischen Apodiktik gegen die Völker der Welt [sic!]
und speziell gegen das Christentum wurde.
Der Ursprung des Streites liegt
vorallem im Gulaterbrief des Paulus und im
Johannes Evangelium. Paulus spricht
davon, daß die Verheißungen Abrahams an seine wahren Glaubenssöhne,
die Christen, übergegangen sind: „Ihr
seid alle durch den Glauben Söhne
Gottes in Christus Jesus ... Wenn ihr
aber zu Christus gehört, dann seid ihr
Abrahams Nachkommen, Erben Kraft
der Verheißung“ (Gal 3, 26. 29).
Ähnlich Gal 4, 28: „Ihr aber, Brüder, seid Kinder der Verheißung wie Isaak.“ In
Joh 8, 39-44 wird den Juden die
Abrahamkindschaft mit groben Ausdrücken
abgesprochen. [Ergänzung der
Neuausgabe:] Als überaus spannungsgeladen und negativ hat sich im
Verlaufe der Geschichte auch die Esau-Jakobs-Typologie erwiesen. In ihr
widerspiegelt sich derjeeigene Standpunkt der jeweiligen Glaubensgemeinschaft [sic!],
von dem her der anderen das
Recht auf Erwählung abgesprochen
wird. [Ende der Ergänzung]
Vertiefungen
des Erwählungsbewußtseins
Im Verlauf e des Mittelalters und der
Neuzeit war das Theologumenon vom
Hinauswurf der Juden aus der Erwählung
eine dominante christliche Ideologie. Man darf aber die Vertiefung des
jüdischen Erwählungsbewußtseins nicht
übersehen. Der prophetische
spanisch-jüdische Kabbalist Abraham Abulafia
(1240-1291) erzählte
bei seinen Versuchen, die Juden und die Christen
messianisch zu beeinflussen, eine
Perlenparabel, die mit Lessings späterer
Ringparabel („Nathan der Weise“)
vergleichbar ist: Ein Mann (Gott) besaß
eine kostbare Perle, die er seinem Sohn
- 59 -
ERWÄHLUNG
(dem jüdischen Volk [sic!])
nicht vererben
konnte, weil dieser sich schlecht gegen
ihn aufführte. Er versteckte die Perle,
bis sich der Sohn bessere. Der Sohn
aber blieb ungehorsam. In der
Zwischenzeit behaupteten andere (die
Christen und Moslems), sie besäßen
die wahre Perle und sie. seien die
wahren Söhne. Sie begannen den Sohn so
zu quälen, daß dieser zum Vater
zurückkehrte. Da verzieh ihm der Vater
alles und schenkte ihm die Perle (Idel
69f). Abulafia betont zwar, die Juden
seien die wahren Erwählten und die
Christen und Moslems hätten keine
gerechtfertigte Erwählungsgrundlage.
Das innovatorische Element seiner
Perlenparabel besteht aber in der
Verkündigung, daß die Juden als Geineinschaft [sic!] in der historischen Zeit der
Erwählungskonkurrenz zwischen Juden,
Christen und Moslems den Beweis
ihrer Erwählung nicht in Händen hätten.
Erst in der messianischen Zeit,
wenn die Juden ganz [sic!]
zum Vater
zurückkehren [sic!], wird klar werden, daß
sie die Erwählten sind und daß ihre
Feinde sich Erwählung anmaßten. Der
chassidische Rabbi Nachman von
Bratzlaw (1722-1811) redet in seinen
Erzählungen (besonders in der Erzählung
„Vom Verlust der Königstochter“ und „Vom Königssohn und dem Sohn
der Magd, die vertauscht wurden“
(BrockeI 1-17.141-159) davon, daß in
der harten Konfrontation die Wahrheit [sic!]
oft in der Falschheit gefangen sei, daß
die Schekhina verschleppt und
geschändet werde, daß aber an dem von
Gott bestimmten Endtag alles
Verschobene wieder an die rechte Stelle
gerückt werde. In der Liturgie des
Reformjudentums, in dessen Theologie
die „Sendung Israels“ als raison
d'être
des Fortbestehens der jüdischen
Glaubensgemeinschaft [sic!]
eine erhebliche
Rolle spielt, findet der traditionelle
Erwählungsglaube („Gott hat uns erwählt, um uns die Tora z u geben“) weiterhin
seinen Ausdruck, wird aber ohne
Blick auf andere Gruppen der Menschheit
formuliert.
In der heutigen Zeit der
jüdisch-christlichen Bewegung spielt der von Juden
und Christen schon früher
ausgesprochene „eschatologische Vorbehalt“ eine
beruhigende und versöhnende Rolle:
Juden und Christen „harren mit der
ganze n Schöpfung .sehnsüchtig auf das
Offenbarwerden der Söhne Gottes“
(Röm 8, 19). Vorläufig sollen sie zu
ihrer je eigenen Erwählung gläubig [sic!]
stehen. Sie sollen aber hoffen, daß das
letzte Erwählungswort Gottes für beide [sic!]
ausgesprochen werden wird. Kämpfe
um exklusive Erwählungen werden
aber nicht nur von der Eendzukunft her
sinnlos, sondern auch von der Gegenwart
mit ihren Menschheitsanliegen.
Die Menschen sind nicht für die
Erwählung da, sondern die Erwählung
für die Menschen. Toleranz,
Zusammenarbeit zum Wohle aller, Anerkennung von je anderen religiösen
Traditionen sind das unabweisbtire Gebot
der Stunde. Dies gilt vor allem für die
Christen, diese durch Christus ins
erste
Gottesvolk [sic!]
hinein Assoziierten (Röm
9-11).
/
Abraham; Absoluthcitsanspruch; Antisemitismus;
Bund;
Eschaton/Eschatologie; Gott; Holocaust;
Israel;
Liberales Judentum/Reformjudentum;
Partikularismus
und Universalismus: Synagoge
und
Kirche; Tora.
Literatur» (Clemens Thoma mit J.J.P. im
jüdisch-christlichen Begegenungslexikon, S. 58-; ähnlich bereits Sp. 107-112) ![]()
Sowohl zur
Entscheidungsherbeiführung (in ihren Gremien) als auch zur
Entschheidungsdurchführung der ‚Repubkica Serenisima Venezsia‘ respektive
Überwachungen amtierte:
![]() Der
Der ![]() Kleine Rat/consiglio minore, eine/die eher alltägliche Art ‚Regierung‘ und zwar ‚gemeinsam – zumal
vorm/über dem Großen Rat – thronende /
vorsitzende Repräsentation des ‚Staates‘ Venedig (eines
seiner alltäglich einflussreichsten ‚Staatsorgane‘, wenn auch – gar zwecks
Machtbegrenzung – in wechselnden Kompetenzüberschneidungen mit dem Kollegium
und dem Senat angelegt/konkurierend, sowie in seiner Amtsführung und dem
persönlich und ökonomisch deutlich einschränkend reglementierten Verhalten
dieser jeweils für kurze Zeiten gewählten, erfahrenen Nobiluomo, durch die
Avogadori),#olaf seit
1462 häufig wie zwar jene
anderer, umliegender ‚Stadtstaaten‘ auch
Kleine Rat/consiglio minore, eine/die eher alltägliche Art ‚Regierung‘ und zwar ‚gemeinsam – zumal
vorm/über dem Großen Rat – thronende /
vorsitzende Repräsentation des ‚Staates‘ Venedig (eines
seiner alltäglich einflussreichsten ‚Staatsorgane‘, wenn auch – gar zwecks
Machtbegrenzung – in wechselnden Kompetenzüberschneidungen mit dem Kollegium
und dem Senat angelegt/konkurierend, sowie in seiner Amtsführung und dem
persönlich und ökonomisch deutlich einschränkend reglementierten Verhalten
dieser jeweils für kurze Zeiten gewählten, erfahrenen Nobiluomo, durch die
Avogadori),#olaf seit
1462 häufig wie zwar jene
anderer, umliegender ‚Stadtstaaten‘ auch ![]() ‚Signoria‘ genannt, doch hier deutlich
anders verfasst, und zeitgenössisch dafür anerkannt, bis gefragt:
Zumal kollektiv, als Collegium (und in allerlei ‚Rätevarianten‘ teils in Personalunion, äh wechselseitigen Kontrollen), um ‚des‘ durchaus vorsitzenden, doch eben
nicht allein /
‚Signoria‘ genannt, doch hier deutlich
anders verfasst, und zeitgenössisch dafür anerkannt, bis gefragt:
Zumal kollektiv, als Collegium (und in allerlei ‚Rätevarianten‘ teils in Personalunion, äh wechselseitigen Kontrollen), um ‚des‘ durchaus vorsitzenden, doch eben
nicht allein / ![]() monokratisch
entscheidenden (wie ein / der Herr ‘signore‘ – und seine gleichnamig bezeichneten
‚Amtskollegen‘), Dogen (in / aus politisch gestaltenden Machtpersoektiven, die weitaus längste Zeit (wenigstens sieben lückenlos beurkundet überliueferte
Jahrhunderte) über, sogar eher – geradezu ‚biblisch‘ –
‚Letzter‘, denn etwa ‚Erster, unter
Gleichen‘. – So war seine formelle Unterschrift meist nur zusammen mit der
mehrerer dieser, ihn kontrollierenden, ‚Dogenberater‘ gültig / rechtswirksam (die / deren dann
Vorsitzender ihn bei Abwesenheit, Anklagen oder Tod, sogar in außenpolitischen
Repräsentationsaufgaben vertraten).
monokratisch
entscheidenden (wie ein / der Herr ‘signore‘ – und seine gleichnamig bezeichneten
‚Amtskollegen‘), Dogen (in / aus politisch gestaltenden Machtpersoektiven, die weitaus längste Zeit (wenigstens sieben lückenlos beurkundet überliueferte
Jahrhunderte) über, sogar eher – geradezu ‚biblisch‘ –
‚Letzter‘, denn etwa ‚Erster, unter
Gleichen‘. – So war seine formelle Unterschrift meist nur zusammen mit der
mehrerer dieser, ihn kontrollierenden, ‚Dogenberater‘ gültig / rechtswirksam (die / deren dann
Vorsitzender ihn bei Abwesenheit, Anklagen oder Tod, sogar in außenpolitischen
Repräsentationsaufgaben vertraten). 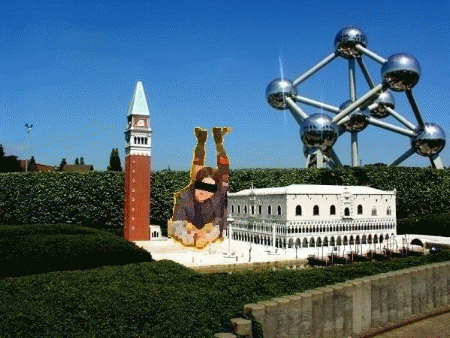 Offizielle
Amtsräume des Collegio, des ‚Kabinetts‘ der Serenissima,
ebenfalls einem weisen Sachverständigenrat, befanden sich / sind im 'Ostflügel'
des Palazzo Communale über ‚der Dogenwohnung‘ an
der Innenhofseite durchs ‚Vorzimmer‘ Anticollegio mit dem Viertürensaal am
oberen Ende der Goldenen Treppe (und ‚der Staatssicherheit‘) verbunden.
Offizielle
Amtsräume des Collegio, des ‚Kabinetts‘ der Serenissima,
ebenfalls einem weisen Sachverständigenrat, befanden sich / sind im 'Ostflügel'
des Palazzo Communale über ‚der Dogenwohnung‘ an
der Innenhofseite durchs ‚Vorzimmer‘ Anticollegio mit dem Viertürensaal am
oberen Ende der Goldenen Treppe (und ‚der Staatssicherheit‘) verbunden.
 [#hier Serenissima] Im goldenen Kleid
der Dogeressa, jedenfalls venexianischer Venezia, hier emblematisch / ‚stellvertertend‘
eine künftige Fürstin inszeniert / ‚schausüielermd.
[#hier Serenissima] Im goldenen Kleid
der Dogeressa, jedenfalls venexianischer Venezia, hier emblematisch / ‚stellvertertend‘
eine künftige Fürstin inszeniert / ‚schausüielermd. 
Diese – eben zugleich geteilte und/aber gemeinsame –
Allerdurchlauchtigste Hoheit der Wenigen/![]() Nobilhòmini. (immerhin anstatt nur Einzelner [Herr/inn/en}),
war jedenfalls zu Venedig, allerdings faktisch vorfindlich (in Unterschieden zu so manchen
dahin wollenden
Absichten, und – auch gegenwärtig zu – vielen entblößenden,
äh blosen, immerhin Behauptungen) für/zur kreative/n Entfaltung/Blüte besonders der
unternehmerischen Handels- und anderer/weiterer, gar einzigartig ergiebiger. Kunstfreiheit/en aller, zumal inklusive weiblicher,
Einwohner, auch ‚der Kolonien‘, da/dienlich – hier sogar, wenn auch weitergehend begrenzend (als etwa
Frauen), Juden – die, und so lange sie,
sich hinreichend loyal gegenüber dem Gemeinwesen Venezia verhielten. – Wobei
die vielen, ja kaum je allseits beliebten, Kontrollen, Überwachungen und
Sanktionen – hauptsächlich und eher zum Schutz der Bevölkerung/en und ihrer
(Werte, Kunst, Gelehrsamkeit pp.) schöpferischen Freiheiten vor Willkür und
Übergriffen ihrer (‚eigennen‘) Mächtigen (bis durchaus des
Staates/Gemeinwesens) weiterentwickelt und verfeinert wurden. Was bekanntlich
ettlichen (gar kurzfristig, individueller – oder zeitgenössischer
politischer Rechtfertigungs-)Interessen(optimierungen)/Arroganzen – etwa unter dem ‚Bann abenländischer, zumal
popularisierter, Aufklärung‘ (durch weiter fortschreitende Erziehung und/oder immerhin Bildung, alle
[relevanten] Ungleicheiten
zwischen/unter Menschen aufheben
zu können, bis zu müssen),
zumindest davon ausgehend wenigstens selbst so gut / edel / unverführbar /
vertrauenswürdig / selbstbeherrscht zu sein, dass Zweifel / Prüfungen / Strafaussichten beleidigen/entblößten – oder, dass etwa
strukturelle 'Vorkoszen' des / 'Leistungen' für's Gemeinwesen/s als 'Umverteilung'
diffamiert - so deutlich im Wege wäre/war, dass (jedenfalls teils bis)
heute geradezu gegenteilige, namentlich 'poliziestaatlliche
Überrwachungs'-Vorstellungen/Überzeugtheiten
kolportiert und (bis absichtlich- wider Nichtidemtitäten/Ungleichheiten, äh von/vor
Vertrauensbeadrfsfragen in/trotz Anderheiten /wegen Freiheit - abschrecken s/wollend) angedroht werden.
Nobilhòmini. (immerhin anstatt nur Einzelner [Herr/inn/en}),
war jedenfalls zu Venedig, allerdings faktisch vorfindlich (in Unterschieden zu so manchen
dahin wollenden
Absichten, und – auch gegenwärtig zu – vielen entblößenden,
äh blosen, immerhin Behauptungen) für/zur kreative/n Entfaltung/Blüte besonders der
unternehmerischen Handels- und anderer/weiterer, gar einzigartig ergiebiger. Kunstfreiheit/en aller, zumal inklusive weiblicher,
Einwohner, auch ‚der Kolonien‘, da/dienlich – hier sogar, wenn auch weitergehend begrenzend (als etwa
Frauen), Juden – die, und so lange sie,
sich hinreichend loyal gegenüber dem Gemeinwesen Venezia verhielten. – Wobei
die vielen, ja kaum je allseits beliebten, Kontrollen, Überwachungen und
Sanktionen – hauptsächlich und eher zum Schutz der Bevölkerung/en und ihrer
(Werte, Kunst, Gelehrsamkeit pp.) schöpferischen Freiheiten vor Willkür und
Übergriffen ihrer (‚eigennen‘) Mächtigen (bis durchaus des
Staates/Gemeinwesens) weiterentwickelt und verfeinert wurden. Was bekanntlich
ettlichen (gar kurzfristig, individueller – oder zeitgenössischer
politischer Rechtfertigungs-)Interessen(optimierungen)/Arroganzen – etwa unter dem ‚Bann abenländischer, zumal
popularisierter, Aufklärung‘ (durch weiter fortschreitende Erziehung und/oder immerhin Bildung, alle
[relevanten] Ungleicheiten
zwischen/unter Menschen aufheben
zu können, bis zu müssen),
zumindest davon ausgehend wenigstens selbst so gut / edel / unverführbar /
vertrauenswürdig / selbstbeherrscht zu sein, dass Zweifel / Prüfungen / Strafaussichten beleidigen/entblößten – oder, dass etwa
strukturelle 'Vorkoszen' des / 'Leistungen' für's Gemeinwesen/s als 'Umverteilung'
diffamiert - so deutlich im Wege wäre/war, dass (jedenfalls teils bis)
heute geradezu gegenteilige, namentlich 'poliziestaatlliche
Überrwachungs'-Vorstellungen/Überzeugtheiten
kolportiert und (bis absichtlich- wider Nichtidemtitäten/Ungleichheiten, äh von/vor
Vertrauensbeadrfsfragen in/trotz Anderheiten /wegen Freiheit - abschrecken s/wollend) angedroht werden.
![]() Senatoren mit/unter dieser Amtsbezeichnung
(aus bereits, zumal als
Amtsträger, erfahrenen Mitgliedern des Großen Rates, als eine Art ständiger
Unterausschuß des selben für häufiger anfallende Entscheidungen – oft [und im
Unterschied zum ansonsten üblichen Verfahren
Verendigs / Moris venoto] für viele aufeinanderfolgende Amtsperioden
kontinuierlich [allerdings beschränkt was die gleichzeitige Mitgliedschaft
mehrerer Männer aus der selben Familie angeht und inquisitorischen
Sicherheitsämtern ähnlich kontrolliert] - gewählt) bzw. das entsürechend
genannte Gremium, seit den 1330er Jahren urkundlich zunächst als 'Consiglio dei
pregadi' belegt, erst nahe mit dem 'judikativen' Rat der 40/
vermischt/verbunden, und später als wichtiges
Entscheidungs- und Kontroll- sowie oberstes Verwaltungsorgan Venezias zumeist
Senatoren mit/unter dieser Amtsbezeichnung
(aus bereits, zumal als
Amtsträger, erfahrenen Mitgliedern des Großen Rates, als eine Art ständiger
Unterausschuß des selben für häufiger anfallende Entscheidungen – oft [und im
Unterschied zum ansonsten üblichen Verfahren
Verendigs / Moris venoto] für viele aufeinanderfolgende Amtsperioden
kontinuierlich [allerdings beschränkt was die gleichzeitige Mitgliedschaft
mehrerer Männer aus der selben Familie angeht und inquisitorischen
Sicherheitsämtern ähnlich kontrolliert] - gewählt) bzw. das entsürechend
genannte Gremium, seit den 1330er Jahren urkundlich zunächst als 'Consiglio dei
pregadi' belegt, erst nahe mit dem 'judikativen' Rat der 40/
vermischt/verbunden, und später als wichtiges
Entscheidungs- und Kontroll- sowie oberstes Verwaltungsorgan Venezias zumeist ![]() 'Senat' genannt.
'Senat' genannt. 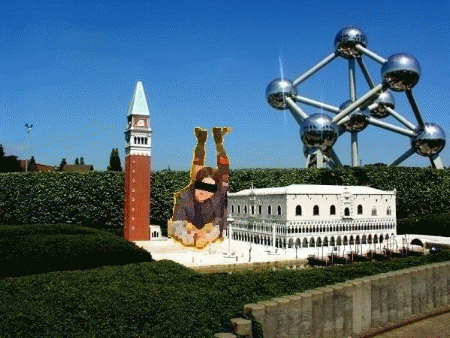 Der
heute erhaltene Sitzungssaal liegt oben im 'Ostflühel' des Palazzo Comunale
über der Dogenwohnung an Rivo, mit dem Amtszinnern seines ständigen
Unterausschuisses, 'dem Kabbibett/
Der
heute erhaltene Sitzungssaal liegt oben im 'Ostflühel' des Palazzo Comunale
über der Dogenwohnung an Rivo, mit dem Amtszinnern seines ständigen
Unterausschuisses, 'dem Kabbibett/![]() Kollegium' (einem 'resorzuständigen' weisen
Sachverständigenrat für basale Interessen Vendigs 'zur Seaa' und schließlich
auch 'an Land') und der Goldenen Treppe im quatro porte (alao rüber zu 'Staatssicherheitsangelegenheiten),
docch auch zu jener 'eigenen' der Senatoren am Nordende des Gebäudes verbunden,
die durchgehend mit dem Innengof der/dieser Senatori (neben/nördlich der
Gigantentreppe) zusammenhängt.
Kollegium' (einem 'resorzuständigen' weisen
Sachverständigenrat für basale Interessen Vendigs 'zur Seaa' und schließlich
auch 'an Land') und der Goldenen Treppe im quatro porte (alao rüber zu 'Staatssicherheitsangelegenheiten),
docch auch zu jener 'eigenen' der Senatoren am Nordende des Gebäudes verbunden,
die durchgehend mit dem Innengof der/dieser Senatori (neben/nördlich der
Gigantentreppe) zusammenhängt.
![]() Rat der – nahezu immer (bereits 1310 gab es
zusätzlich zwei ebenfalls ‚parlamentarisch‘ gewählte Untersuchungsrichter,
plus 'Mitarbeiter von Dogenamtes wegen') und zunehmend weitaus mehr als
– Zehn/deci X (nämlich 20 plus Inquisitoren plus sechs vollziehende Wachleute
und vier Sekretäre) obersten Sicherheitsmänner und Kontrollinstanz der
Serenisima Venezia, mit zahlreichen, zumal
Rat der – nahezu immer (bereits 1310 gab es
zusätzlich zwei ebenfalls ‚parlamentarisch‘ gewählte Untersuchungsrichter,
plus 'Mitarbeiter von Dogenamtes wegen') und zunehmend weitaus mehr als
– Zehn/deci X (nämlich 20 plus Inquisitoren plus sechs vollziehende Wachleute
und vier Sekretäre) obersten Sicherheitsmänner und Kontrollinstanz der
Serenisima Venezia, mit zahlreichen, zumal ![]() inquisitorischen (bereits das heißt und bedeutete übrigens:
auf empirisch
vorliegenden/beschafften Indizien/Beweisen, anstatt [gleich gar allein] auf
[Zeugen- bzw. erzwungene ]Aussagen,
angelegte/beruhende – gleichwohl diese bemerkende/beobachtende und/aber interpretierende, fehlbare Subjekte, äh Menschen, nicht los werdend) Unter- und Teileinrichtungen. –
Insgesamt zudem deutlich besser (geradezu 'rechtsstaatlich' begrenzt mächtig
und kontrolliert verantwortlich – persönlich nicht etwa für immer
immun/unantastbar, sondern ‚nachträglich‘ haftbar, während der Amtszeit zudem
ständig militärisch begleitet), als sein, bereits
zeitgenössisch ambivalent (auch im durchaus beabsichtigten/zweckdienlichen
Abschreckungssinne) 'fürchterlicher' Ruf – wohl
zumindest zeitweilig, Venedigs Regierungsgeschäfte entscheidend bestimmend (wie
zumal von/in der Forschung bemerkt wird). Jenes weite, eigentümmliche Feld, das und was – auch/gerade unter
Bedingungen freiheitlicher, demokratischer, moderner Gesellschaften – und\aber
zugleich wogegen es, ‚Minister‘ Beten lehrt.
inquisitorischen (bereits das heißt und bedeutete übrigens:
auf empirisch
vorliegenden/beschafften Indizien/Beweisen, anstatt [gleich gar allein] auf
[Zeugen- bzw. erzwungene ]Aussagen,
angelegte/beruhende – gleichwohl diese bemerkende/beobachtende und/aber interpretierende, fehlbare Subjekte, äh Menschen, nicht los werdend) Unter- und Teileinrichtungen. –
Insgesamt zudem deutlich besser (geradezu 'rechtsstaatlich' begrenzt mächtig
und kontrolliert verantwortlich – persönlich nicht etwa für immer
immun/unantastbar, sondern ‚nachträglich‘ haftbar, während der Amtszeit zudem
ständig militärisch begleitet), als sein, bereits
zeitgenössisch ambivalent (auch im durchaus beabsichtigten/zweckdienlichen
Abschreckungssinne) 'fürchterlicher' Ruf – wohl
zumindest zeitweilig, Venedigs Regierungsgeschäfte entscheidend bestimmend (wie
zumal von/in der Forschung bemerkt wird). Jenes weite, eigentümmliche Feld, das und was – auch/gerade unter
Bedingungen freiheitlicher, demokratischer, moderner Gesellschaften – und\aber
zugleich wogegen es, ‚Minister‘ Beten lehrt.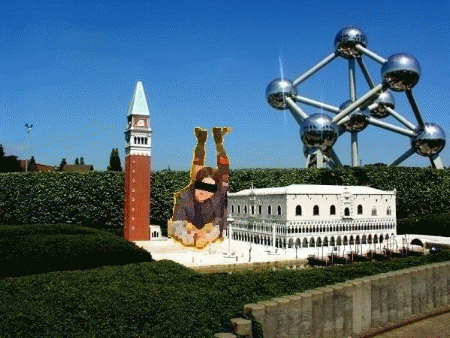 Für, gleich gar die innere, Sicherheit zuständig, erhalten/verwenden S/sie (ja
durchaus vernünftig begründbar, verantwortlicher weise) stets erhebliche Mittel
– doch anscheinend/‚offensichtlich‘ nie genug (alle Gefahrenrisiken,
Verbrechen, etc. vollständig abzuwenden) – dafür/daher ständig zunehmenden,
systemischen Überwachungseinfluss, bis Kontrollmöglichkeiten(befugnissebedarf).
– Während Führungen also darum zu flehen und darauf zu hoffen versucht
sind/werden: Es möge sich (wenigstens zu ihrer
Amtszeit bis) niemals so fügen, dass kommende
Wirklichkeit /olam haba‘/ (das G’ttesreich/‚Paradiesisches‘ in Form)
ungefährdeter Sicherheit eintrete, was ja nicht
nur/immerhin bei Jesaja(hu) Verteidigungsaufwendungen und Vorsichten
hinfällig werden ließe;
Für, gleich gar die innere, Sicherheit zuständig, erhalten/verwenden S/sie (ja
durchaus vernünftig begründbar, verantwortlicher weise) stets erhebliche Mittel
– doch anscheinend/‚offensichtlich‘ nie genug (alle Gefahrenrisiken,
Verbrechen, etc. vollständig abzuwenden) – dafür/daher ständig zunehmenden,
systemischen Überwachungseinfluss, bis Kontrollmöglichkeiten(befugnissebedarf).
– Während Führungen also darum zu flehen und darauf zu hoffen versucht
sind/werden: Es möge sich (wenigstens zu ihrer
Amtszeit bis) niemals so fügen, dass kommende
Wirklichkeit /olam haba‘/ (das G’ttesreich/‚Paradiesisches‘ in Form)
ungefährdeter Sicherheit eintrete, was ja nicht
nur/immerhin bei Jesaja(hu) Verteidigungsaufwendungen und Vorsichten
hinfällig werden ließe; ![]()
![]()
![]() Wesentliche, teils heute noch eher vertraulich, bis geheim, verborgene, Teile des
südlichen 'Ostflügels' im oberen Prachtstockwerk des Palazzo Comunale und
darüber werden von Einrichtungen des, eben deutlich zahlreicheren,
'Zehnerrates' und seinem Waffenarsenal eingenommen.
Wesentliche, teils heute noch eher vertraulich, bis geheim, verborgene, Teile des
südlichen 'Ostflügels' im oberen Prachtstockwerk des Palazzo Comunale und
darüber werden von Einrichtungen des, eben deutlich zahlreicheren,
'Zehnerrates' und seinem Waffenarsenal eingenommen. 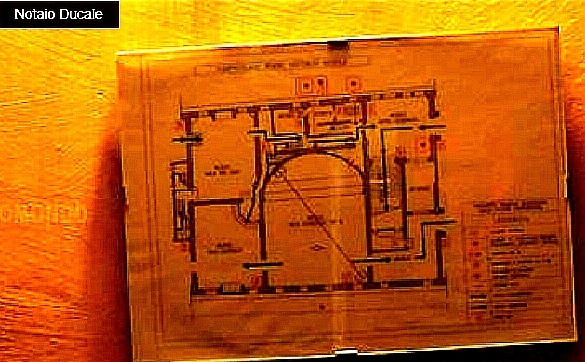 Baulich quasi ‚äußerlich‘, aber eben auch
‚mental‘. zeigt der Palazzo mit den Amtssälen, und was ihre Dogen angeht, sogar
Wohnräumen, Venezias, manche gar überraschend, offene Einstellung: Sogar und
selbst dem Meer gegenüber, nicht zu maueren/verbunkern, sondern auf Interessen-
bis Wahrenaustausch zu setzen, ohne etwa dauerhaft/totalitär auf (seit Mitte
des 18. Jahrhunderts doch errichtete)
Baulich quasi ‚äußerlich‘, aber eben auch
‚mental‘. zeigt der Palazzo mit den Amtssälen, und was ihre Dogen angeht, sogar
Wohnräumen, Venezias, manche gar überraschend, offene Einstellung: Sogar und
selbst dem Meer gegenüber, nicht zu maueren/verbunkern, sondern auf Interessen-
bis Wahrenaustausch zu setzen, ohne etwa dauerhaft/totalitär auf (seit Mitte
des 18. Jahrhunderts doch errichtete) ![]() strategische
Festungsoptionen (und Sturmflutverbauungen zumal im Bereich der Lidi), oder
gar je auf den (im Unterschied zum Frühjahr 1797
eben) aussichtsreichen Einsatz von Truppen, und Kampfschiffen zu verzichten.
strategische
Festungsoptionen (und Sturmflutverbauungen zumal im Bereich der Lidi), oder
gar je auf den (im Unterschied zum Frühjahr 1797
eben) aussichtsreichen Einsatz von Truppen, und Kampfschiffen zu verzichten.
![]() Doch
gingen, gerade zu Venedig, die ersten/ältesten/höchsten Ämter und Funktionen
zunächst von den Herrschenden in Byzanz und
zunegmend. bis dann, allerspätestens ab dem ausgehenden 13. Jahrhundert (gar
mit der militärischen Eroberung von
Konstantinopel durch Venedig, mittels der Kreuzritter 1204), vollständig, sowie
alle weiteren, von den patrizischen Nobiluomo-Familien in
der Lagune aus. – Versammelt/Vertreten im als 'Maggior consiglio /
Großer Rat' bezeichneten Gremium, dessen Zusammensetzung aus volljährigen
Männern dieser Familien, seit dem 14. Jahrhundert insofern als abgeschlossen galt,
dass kaum weitere dieses Recht/Privileg, und damit verbundene
Verpflichtbarkeiten, erhalten konnten. Die Sereinissima Republica Venezia war zumeist eine demokratisch organisierte Nobiluomooligarchie – in der eine
kleine Bevölkerungsminderheit – die Rede ist gerne pauschalisierend von 2%
Nobiluomo, bis (immerhin – alle, auch ‚verwaltende/silbern
gelistete‘ Patriziergeschlechter der Cittadini, zusammen) einem Drittel (eher
ungeachtet der jeweiligen Beteiligung – bekanntlich werden etwa derzeitige
US-Präsidenten von ca. einem Viertel der Bevölkerung gewählt) – auch politisch/‚paralamentarisch‘ – folglich: ‚das Gesetz‘, ‚das Buget‘ und über (Fühurungs-)Personal (mit)bestimmend
Doch
gingen, gerade zu Venedig, die ersten/ältesten/höchsten Ämter und Funktionen
zunächst von den Herrschenden in Byzanz und
zunegmend. bis dann, allerspätestens ab dem ausgehenden 13. Jahrhundert (gar
mit der militärischen Eroberung von
Konstantinopel durch Venedig, mittels der Kreuzritter 1204), vollständig, sowie
alle weiteren, von den patrizischen Nobiluomo-Familien in
der Lagune aus. – Versammelt/Vertreten im als 'Maggior consiglio /
Großer Rat' bezeichneten Gremium, dessen Zusammensetzung aus volljährigen
Männern dieser Familien, seit dem 14. Jahrhundert insofern als abgeschlossen galt,
dass kaum weitere dieses Recht/Privileg, und damit verbundene
Verpflichtbarkeiten, erhalten konnten. Die Sereinissima Republica Venezia war zumeist eine demokratisch organisierte Nobiluomooligarchie – in der eine
kleine Bevölkerungsminderheit – die Rede ist gerne pauschalisierend von 2%
Nobiluomo, bis (immerhin – alle, auch ‚verwaltende/silbern
gelistete‘ Patriziergeschlechter der Cittadini, zusammen) einem Drittel (eher
ungeachtet der jeweiligen Beteiligung – bekanntlich werden etwa derzeitige
US-Präsidenten von ca. einem Viertel der Bevölkerung gewählt) – auch politisch/‚paralamentarisch‘ – folglich: ‚das Gesetz‘, ‚das Buget‘ und über (Fühurungs-)Personal (mit)bestimmend  (eben
nicht allein repräsentativ und administrativ hoheitlich
verwaltend – was ja allzumeist von/durch vergleichsweise wenigen Menschen
in/aus der Bevölkerung, bis Belegschaft, vollzogen
wird) über
alle Veneter, und deren jeweilige ‚Kolonien‘, herrschte.
(eben
nicht allein repräsentativ und administrativ hoheitlich
verwaltend – was ja allzumeist von/durch vergleichsweise wenigen Menschen
in/aus der Bevölkerung, bis Belegschaft, vollzogen
wird) über
alle Veneter, und deren jeweilige ‚Kolonien‘, herrschte. 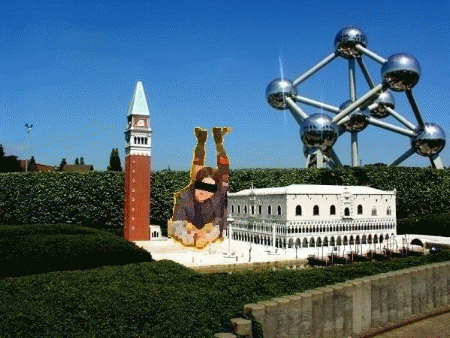 Hauptraum des Südflügels im Palazzo Comunale ist
über dem (zweiten) Loggiengeschoss der Große Ratssaal (Rundgang #27) uit dem auch die ‚Zensorentreppe‘/Scala dei Censori verbindet, die
nordöstlich davon ‚neben‘ einer Diele / Andito (Rundgang ) und an der
Verbindung zur ‚Dogenwohneng‘ und den Amtsräumen der anderen obersten – eher
alltäglich präsenten und handelnden – Institutionen darüber, liegt.
Hauptraum des Südflügels im Palazzo Comunale ist
über dem (zweiten) Loggiengeschoss der Große Ratssaal (Rundgang #27) uit dem auch die ‚Zensorentreppe‘/Scala dei Censori verbindet, die
nordöstlich davon ‚neben‘ einer Diele / Andito (Rundgang ) und an der
Verbindung zur ‚Dogenwohneng‘ und den Amtsräumen der anderen obersten – eher
alltäglich präsenten und handelnden – Institutionen darüber, liegt.
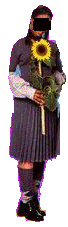 Manche
Leute vielleicht eher überraschender
das Arsenale – (deutlich weiter östlich
außerhalb des 'Dogenpasastes' und auch außerhalb von San Marco im Sestiere
Castello gekegens) frühes, bis einziges Industrieunternehmen, des
christlich-abendländischen 'Mittelaters' mit modularen und vorgeferigten
Schiffsbaukapazitäten und Personalbeständen – hier zu finden, da es nicht
ausdrüchlich gar als
'Verfassungsorgan' bezeichnet, doch La serinissima wesentliche Möglichleoten
verschaffte.
Manche
Leute vielleicht eher überraschender
das Arsenale – (deutlich weiter östlich
außerhalb des 'Dogenpasastes' und auch außerhalb von San Marco im Sestiere
Castello gekegens) frühes, bis einziges Industrieunternehmen, des
christlich-abendländischen 'Mittelaters' mit modularen und vorgeferigten
Schiffsbaukapazitäten und Personalbeständen – hier zu finden, da es nicht
ausdrüchlich gar als
'Verfassungsorgan' bezeichnet, doch La serinissima wesentliche Möglichleoten
verschaffte. 
 So zeigt ein wichtiges, großes Wandbild des Großen Ratssaales im Palazzo Comunale den Vierten Kreuzzug
(1202-04). In den drei großen Deckenbildern wird das Imperium Venezianum
gefeiert: Eines von Jacopo
Palma il Giovane zeigt die militärische Macht Venedigs, ein
weiteres von Tintoretto illustriert die freiwillige Unterwerfung
anderer/fremder Ethnien/Regionen/Kulturen unter die Herrschaft von Venezias
anschießend zur/ausgehend von der Tribuna hin/her dargestellten 'Frieden' – den(n)
das dritte/erste der großen Deckengemälde des grkßten Innenraums des Palazzo
zeigt Paolo Veroneses Pax Venetia.
So zeigt ein wichtiges, großes Wandbild des Großen Ratssaales im Palazzo Comunale den Vierten Kreuzzug
(1202-04). In den drei großen Deckenbildern wird das Imperium Venezianum
gefeiert: Eines von Jacopo
Palma il Giovane zeigt die militärische Macht Venedigs, ein
weiteres von Tintoretto illustriert die freiwillige Unterwerfung
anderer/fremder Ethnien/Regionen/Kulturen unter die Herrschaft von Venezias
anschießend zur/ausgehend von der Tribuna hin/her dargestellten 'Frieden' – den(n)
das dritte/erste der großen Deckengemälde des grkßten Innenraums des Palazzo
zeigt Paolo Veroneses Pax Venetia. 
![]() Zumindest nicht weniger wichtig, als seine
seefahrerischen und militärischen Möglichkeiten,
waren Venedigs diplomatischen Einrichtungen und Erfahrungen, sowie
(durchaus immernoch) seine Handelskontakte, Venexias
Künste und sonstige (zumal überregeionalen)
zwischenmenschlichen Austauschbeziehungen. So zeigt ein wichtiges, großes
Wandbild des Großen Ratssaales Kaiser Friedrich I . Barbarossa beim venezianisch vermittelten ‚Friedensschluss‘ mit Papst Alexander III. (1177).
Zumindest nicht weniger wichtig, als seine
seefahrerischen und militärischen Möglichkeiten,
waren Venedigs diplomatischen Einrichtungen und Erfahrungen, sowie
(durchaus immernoch) seine Handelskontakte, Venexias
Künste und sonstige (zumal überregeionalen)
zwischenmenschlichen Austauschbeziehungen. So zeigt ein wichtiges, großes
Wandbild des Großen Ratssaales Kaiser Friedrich I . Barbarossa beim venezianisch vermittelten ‚Friedensschluss‘ mit Papst Alexander III. (1177).
 [DFG geförderte wissenschaftliche Abhandlung
über die Entszehung der Diplomatie, als
instituitionalisierte Mittel staatlicher Akteure.]
[DFG geförderte wissenschaftliche Abhandlung
über die Entszehung der Diplomatie, als
instituitionalisierte Mittel staatlicher Akteure.]
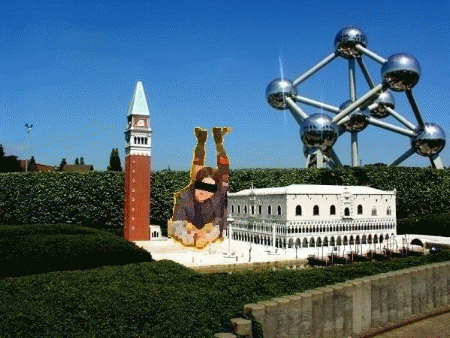 Baulich im Palazzo Comunale und funktional
insbesondere mit den Amts- bis Wohnräumen des Dogen
und darüber jenen der Regierung (#17 u. #18) sowie
des Senates (#19) verbunden.
Baulich im Palazzo Comunale und funktional
insbesondere mit den Amts- bis Wohnräumen des Dogen
und darüber jenen der Regierung (#17 u. #18) sowie
des Senates (#19) verbunden.
'Neben', nein 'mit' der Stadt
auf den Inseln, der Lagune und der Terrafderma hatte Venezia ein ![]() 'Kolonialreich'
zu verwalten, das zeitweilig vom heutigen Oberitalien die Adria entlang bis
Kreta und zur Krim im Schwarzen sowie Zypern im Mittelländischen Meer reuchte.
[Abb. Wiki-Karte]
'Kolonialreich'
zu verwalten, das zeitweilig vom heutigen Oberitalien die Adria entlang bis
Kreta und zur Krim im Schwarzen sowie Zypern im Mittelländischen Meer reuchte.
[Abb. Wiki-Karte]
 Und/Aber
Und/Aber ![]() schließlich
– eher zuerst denn zuletzt (respektive, zwar historisch und je nach Institution
recht unterschiedlich doch, ständig üräsent) – die jeweiligen administrativ-ökonomischen Verwaltung(sverfahren und -strktur)en vollzogener
Bereitstellung und exekutiver Verwendung bestimmter' materieller' und
'personeller' Resourcen.
schließlich
– eher zuerst denn zuletzt (respektive, zwar historisch und je nach Institution
recht unterschiedlich doch, ständig üräsent) – die jeweiligen administrativ-ökonomischen Verwaltung(sverfahren und -strktur)en vollzogener
Bereitstellung und exekutiver Verwendung bestimmter' materieller' und
'personeller' Resourcen. 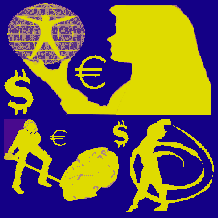 Im
Machtzentrum Palazzo Comunale räumlich umfänglich (doch keineswegs
nur) auf den unteren (und 'spezeill' in Teilen der obersten) Stockwerken des 'Ostflügels' untergebracht.
Im
Machtzentrum Palazzo Comunale räumlich umfänglich (doch keineswegs
nur) auf den unteren (und 'spezeill' in Teilen der obersten) Stockwerken des 'Ostflügels' untergebracht. 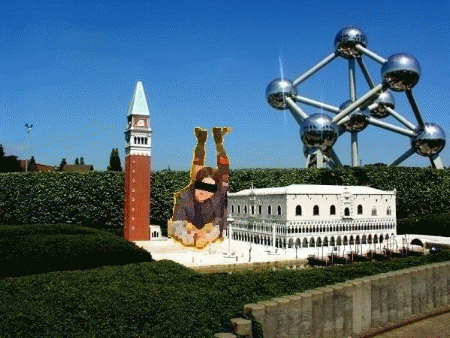
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Was also Macht-, äh
Einflüsse- und}aber ‚Herrschaftsausübungen
des und der über den und die Menschen‘ angeht, komme Venezia, jedenfalls nach Ansicht der Wikipedia, zu nebenstehendem Ergebnis:
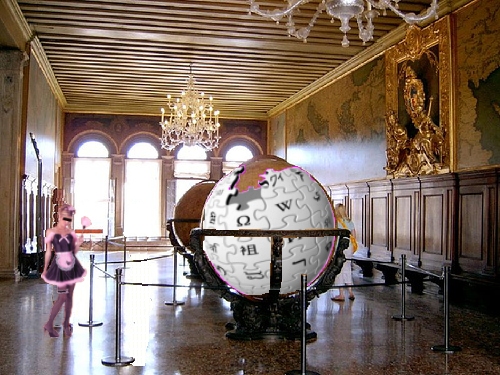 ‚Macht‘-Begrifflichkeiten,
bis damit Gemeintes, haben
jederzeit/häufig einen (‚drüben‘, Angesichts von עזר /‘ezär,
‚ezer/ Ur-Fragen ‚Macht‘ und\aber ‚Hilfe‘ sogar ‚zu‘) schlechten Ruf/Leumund – doch werden Einflüsse
(welcher ‚Reichweiten‘/Größen und Wirkrichtungen auch immer – eben immerhin
‚auch‘) von
Menschen auf/an/‚in sich selbst
und/oder andere/n (respektive ‚ihresgleichen‘, sogar/gerade
asketischer-, bis authistischerrseits) kaum dauerhaft allgemeingültig/allumfassend bestreitbar bleiben. -
Bedeutungshöfe der Wortfelder von 'Herrschaft' und ihre Synonme
betreffen/meinen (hier) jene Teilaspekte des (zwar
unvermeidlichen doch nicht, bis nie,
alternativlosen) Verhaltens
von Menschen, die beabsichtigtes, bis gar (zumal dadurch) versehentlich
'bewirktes'/nicht unterbundenes, – mehr oder minder weitgehendes – Erreichen
bestimmter Verhaltensweisen / Ausüben gegebener Handlungsoptionen beschreiben/thematisieren.
‚Macht‘-Begrifflichkeiten,
bis damit Gemeintes, haben
jederzeit/häufig einen (‚drüben‘, Angesichts von עזר /‘ezär,
‚ezer/ Ur-Fragen ‚Macht‘ und\aber ‚Hilfe‘ sogar ‚zu‘) schlechten Ruf/Leumund – doch werden Einflüsse
(welcher ‚Reichweiten‘/Größen und Wirkrichtungen auch immer – eben immerhin
‚auch‘) von
Menschen auf/an/‚in sich selbst
und/oder andere/n (respektive ‚ihresgleichen‘, sogar/gerade
asketischer-, bis authistischerrseits) kaum dauerhaft allgemeingültig/allumfassend bestreitbar bleiben. -
Bedeutungshöfe der Wortfelder von 'Herrschaft' und ihre Synonme
betreffen/meinen (hier) jene Teilaspekte des (zwar
unvermeidlichen doch nicht, bis nie,
alternativlosen) Verhaltens
von Menschen, die beabsichtigtes, bis gar (zumal dadurch) versehentlich
'bewirktes'/nicht unterbundenes, – mehr oder minder weitgehendes – Erreichen
bestimmter Verhaltensweisen / Ausüben gegebener Handlungsoptionen beschreiben/thematisieren.
«Die seltene] Stabilität und der Jahrhunderte bestehende Rang»
Venedigs «im ja [oft eher dissonannten]
Konzert der europäischen Mächte ist erreicht worden durch » »«
Ein «abgestimmtes Gleichgewicht zwischen den beteiligten Kräften,
die Zuteilung von wirklicher Macht immer nur auf kurze Zeit und die rigorose
Verhinderung persönlicher Macht bei einem Einzelnen.
Gleichzeitig
wurde, von jedem an der Ausübung der Macht Beteiligten,
ein hoher und ausschließlicher Einsatz aller persönlichen, finanziellen und
zeitlichen Ressourcen ‚zum Wohl der Republik‘
verlangt.» O:G.J.: Was auf eine (gar Null-)Summenvertelungs-oaradigmatische Vorgehensweise auf Kosten des Lebens von/der
Menschen hinaus laufen –
gleichwohl so mancherlei Glück und Befriedigungen, bis Erfüllungen,
bieten – konnte und kann – mithin Opfer
(auch seitens der Täter-/KünstlerInnen) mindestens
Selbstaufopferung, inklusive ‚(einem) leiblich( Nahestehend)er‘, hinausläuft.  Gar nicht so selten gehört dazu, dass, bis wie,
menschenunfreundlich Institutionen sein/werden dürfen bzw. können;
zumal mit dem kulturalistisch
überzogen Argument / Anspruch das (überindividuelle) Gemeinwesen,
also dessen exekutierende Einrichtung,
sei wichtiger, gar wertvoller / berechtigter, als namentlich einzelne
Individuen / sterbliche Exemplare der Gattung Mensch. Gleich gar da / wo
Institutionen ‚Gesetze/Nomoi‘ machen (sind und werden
sie nicht mit dem Geschehen, respektive –
und sei / wäre dies auch wider
so manches Erwarten – [nicht] mit Gott, identisch/selbig).
Gar nicht so selten gehört dazu, dass, bis wie,
menschenunfreundlich Institutionen sein/werden dürfen bzw. können;
zumal mit dem kulturalistisch
überzogen Argument / Anspruch das (überindividuelle) Gemeinwesen,
also dessen exekutierende Einrichtung,
sei wichtiger, gar wertvoller / berechtigter, als namentlich einzelne
Individuen / sterbliche Exemplare der Gattung Mensch. Gleich gar da / wo
Institutionen ‚Gesetze/Nomoi‘ machen (sind und werden
sie nicht mit dem Geschehen, respektive –
und sei / wäre dies auch wider
so manches Erwarten – [nicht] mit Gott, identisch/selbig).
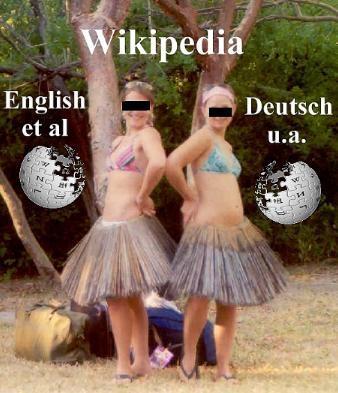 «
« ![]() Nomos
(griechisch νόμος; Plural Nomoi) ist der
griechische Terminus für Gesetz, aber auch für Brauch, Übereinkunft. Gemeint
ist etwas, das bei allen Lebewesen Gültigkeit besitzt. Seit dem 5. Jahrhundert
v. Chr. wurden im
Nomos
(griechisch νόμος; Plural Nomoi) ist der
griechische Terminus für Gesetz, aber auch für Brauch, Übereinkunft. Gemeint
ist etwas, das bei allen Lebewesen Gültigkeit besitzt. Seit dem 5. Jahrhundert
v. Chr. wurden im ![]() antiken
Griechenland auch gesetzesförmige Regelungen so genannt (zu unterscheiden
ist aber von Entscheidungen der
antiken
Griechenland auch gesetzesförmige Regelungen so genannt (zu unterscheiden
ist aber von Entscheidungen der ![]() Volksversammlung
einer
Volksversammlung
einer ![]() Polis, siehe
Polis, siehe ![]() Psephisma).
… »
Psephisma).
… »
...
«Venedig wurde nicht geboren, um die Welt zu erobern, es trachtete
niemals danach, sie zu
besitzen - aber heute, da es vollendet ist, erkennen wir, dass
es geschaffen wurde, um die Welt zu bedeuten.»
(R.R. -Hörbild; verlinkende Hervorhebungen
O.G.J.) 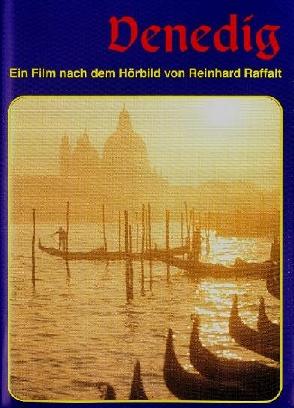
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kommentare und Anregungen sind willkommen unter: webmaster@jahreiss.eu |
||
|
|
|
||
|
|
|
by |