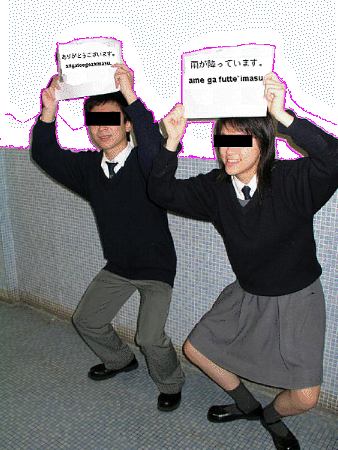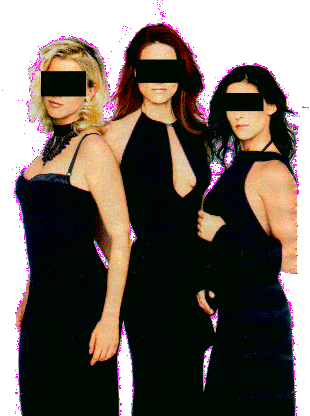|
|
|||
|
Volles Abendzeremoniell |
Dear
Friends, Ladies and Gentlemen, Your
Excellencies, Mrs. President, Royal Highnesses,
Your Majesty! |
|
Realitäten wechselwirken zwar durchaus, doch nicht unvermittelt – zumal damit. |
‚Wirklich sei was wirkt’ und\aber jenseits dieser ontologischen Kausalitätsauffassung des Bestimmens gegebene Realitäten werden – jedenfalls im Plural, bis im Widerspruch zum indoeuropäischen Kosmos-Konzept / Singular(-Gebrauch) – auch/zumal sino-tibetisch kaum bestritten.
Jenes ‚Ganze‘ zu betrachten, das sich nicht allein aus Teilen zusammengesetzt verstehen, und noch nicht einmal von seinen Elementen her, umfassend begreifen lässt, stellt derart vorfindliche Teile – also auch uns, gar selbst © Sie, hier bis dort – notwendigerweise vor kaum, bis nicht, lösbare Aufgaben. – Und das wäre es auch schon, das ist bereits Alles ‚für heute Abend‘ undװaber morgen.
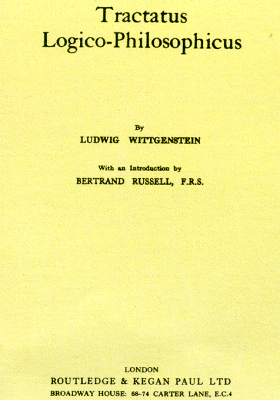
«Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.»
Und ‚gute Nacht!‘ doch klänge, oder wäre, solches
vielleicht doch schon etwas zu sehr, so wie der fromme Wunsch einer ‚angenehmen
Ruh‘, nachdem soeben tunlichst für deren Gegenteil gesorgt ward? 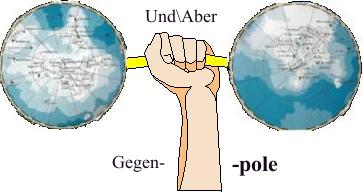
Und «Ceterum censio vor Übertreibungen .... Sie wissen vielleicht schon.» Auch sind, oder wenigstens scheinen, uns ja nicht alle Wege verschlossen, überhaupt Etwas (also Teile, bis zumindest Aspekte) des Alles zu betrachten, das eine und andere davon sogar zu ergreifen, etwas weniger davon (oder wenigstens sich bis einander) auch noch verstehen, und immerhin Vereinzeltes davon noch (wenn auch eher erst in unserem Bewusstsein/Bewusswerden, als mit unseren ‚übrigen‘ Sinnesorganen) zu sehen, respektive repräsentierend ‚ezeigt‘ zu bekommen – vielleicht sogar unserseits davon erfasst, wenigstens aber betroffen, zu sein respektive zu werden.
 Ein höchst gefährliches Unterfangen also,
sehen Sie sich folglich bitte unbedingt gut vor! Und sollten Sie sich nicht persönlich darauf einlassen
wollen, stößt dies auf so erhebliches Verständnis, wie sonst wohl kaum jemals
oder irgendwo. Und es verbleibt Ihnen dennoch die Möglichkeit zur inhaltlich-sachlichen
Betrachtung, oder zu unserer Kontrolle, virtuell hier/dabei zu bleiben, so Sie
dies wollen sollten.
Ein höchst gefährliches Unterfangen also,
sehen Sie sich folglich bitte unbedingt gut vor! Und sollten Sie sich nicht persönlich darauf einlassen
wollen, stößt dies auf so erhebliches Verständnis, wie sonst wohl kaum jemals
oder irgendwo. Und es verbleibt Ihnen dennoch die Möglichkeit zur inhaltlich-sachlichen
Betrachtung, oder zu unserer Kontrolle, virtuell hier/dabei zu bleiben, so Sie
dies wollen sollten.  [Das ganze
Jahr-eises-kalt
…]
[Das ganze
Jahr-eises-kalt
…]
Tatsächliche Wahrheit realer Wirklichkeit[en] (mit Anderheit[em])
Wahrheit אמת EMeT und Lüge שקר SCHeKeR. – gleicht gar nicht so notwendigerweise ausgerechnet im Singular wie indoeuropäisch gemeint, bis verlangt, wird – zumindest auf Iwrit gibt es bekanntlich zudem mehrere so übersetz- und verstehbare Wörter.
![]() JeSCH
יש
und/oder\aber אין AJIN עין, dass/falls es überhaupt etwas Seinedes/Werdendes gibt und nicht (nur) Nichts existiert,
respektive dieses nicht völlig leer ist/wird:
JeSCH
יש
und/oder\aber אין AJIN עין, dass/falls es überhaupt etwas Seinedes/Werdendes gibt und nicht (nur) Nichts existiert,
respektive dieses nicht völlig leer ist/wird:
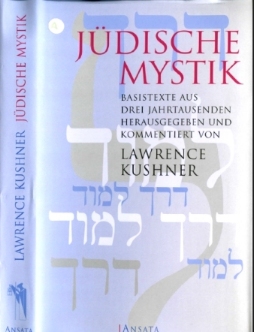
![]() JeSCH
OlaM שלום bis OlaMoT עולמות und\aber עולםהבא OlaM HaBA
JeSCH
OlaM שלום bis OlaMoT עולמות und\aber עולםהבא OlaM HaBA
![]() Wie wirklich ist die Wirklichkeit?
Wie wirklich ist die Wirklichkeit? 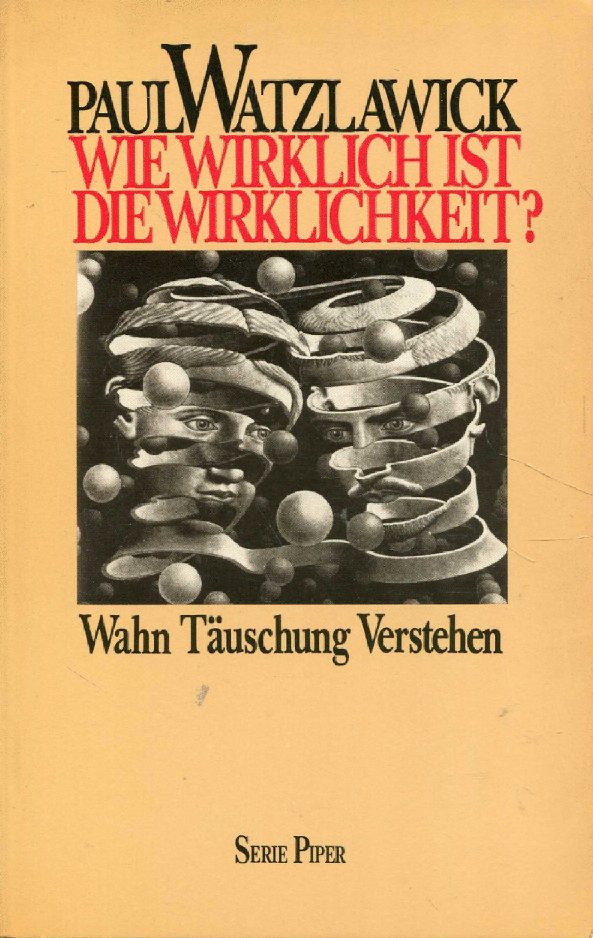
[Vorwort 7
Teil 1 - Konfusion 11
Genesis 11,7
![]() Traduttore, traditore
14
Traduttore, traditore
14
![]() Paradoxien 25
Paradoxien 25
![]() Die Vorteile der Konfusion 38
Die Vorteile der Konfusion 38
![]() Der Kluge Hans 41
Der Kluge Hans 41
![]() Das Kluge-Hans-Trauma 44
Das Kluge-Hans-Trauma 44
![]() Subtile Beeinflussungen 47
Subtile Beeinflussungen 47
![]() »Außersinnliche Wahrnehmungen«
50
»Außersinnliche Wahrnehmungen«
50
Teil II - Desinformation 55
Alexander Pope (Ordnung ist des Himmels oberstes
Gesetz.)
Albert Einstein (Die Theorie bestimmt,
was wir beobachten können.)
![]() Nichtkontingenz – oder: Die
Entstehung von Wirklichkeitsauffassungen 58
Nichtkontingenz – oder: Die
Entstehung von Wirklichkeitsauffassungen 58
![]() Das neurotische Pferd 59
Das neurotische Pferd 59
![]() Die abergläubische Ratte 59
Die abergläubische Ratte 59
![]() Warum einfach, wenn's kompliziert
auch geht? 61
Warum einfach, wenn's kompliziert
auch geht? 61
![]() Der vielarmige Bandit 64
Der vielarmige Bandit 64
![]() Von Zufall und Ordnung 67
Von Zufall und Ordnung 67
![]() »Psychische Kräfte« 70
»Psychische Kräfte« 70
![]() Interpunktion - oder: Die Ratte und
der Versuchsleiter 72
Interpunktion - oder: Die Ratte und
der Versuchsleiter 72
![]() Semantische Interpunktion 76
Semantische Interpunktion 76
![]() Wo alles wahr ist, auch das Gegenteil
77
Wo alles wahr ist, auch das Gegenteil
77
![]() Der metaphysische Versuchsleiter
82
Der metaphysische Versuchsleiter
82
![]() Die zerkratzten Windschutzscheiben
84
Die zerkratzten Windschutzscheiben
84
![]() Das Gerücht von Orleans 85
Das Gerücht von Orleans 85
![]() Experimentell erzeugte Desinformation
91
Experimentell erzeugte Desinformation
91
![]() Die Macht der Gruppe 92
Die Macht der Gruppe 92
![]() Herrn Slossenn
Boschens Lied 97
Herrn Slossenn
Boschens Lied 97
![]() Candid Camera
98
Candid Camera
98
![]() Die Ausbildung von Regeln 99
Die Ausbildung von Regeln 99
![]() Interdependenz 103
Interdependenz 103
![]() Das Gefangenendilemma 103
Das Gefangenendilemma 103
![]() Was ich denke, daß
er denkt, daß ich denke 108
Was ich denke, daß
er denkt, daß ich denke 108
![]() Drohungen 111
Drohungen 111
![]() Die Glaubhaftigkeit einer Drohung
113
Die Glaubhaftigkeit einer Drohung
113
![]() Die Drohung, die ihr Ziel nicht
erreichen kann 115
Die Drohung, die ihr Ziel nicht
erreichen kann 115
![]() Die unbefolgbare
Drohung 119
Die unbefolgbare
Drohung 119
![]() Geheimdienstliche Desinformation
123
Geheimdienstliche Desinformation
123
![]() Unternehmen Mincemeat
131
Unternehmen Mincemeat
131
![]() Unternehmen Neptun 139
Unternehmen Neptun 139
![]() Die zwei Wirklichkeiten 142
Die zwei Wirklichkeiten 142
Teil III - Kommunikation 145
![]() Der Schimpanse 149
Der Schimpanse 149
Aristoteles
![]() Zeichensprache 152
Zeichensprache 152
![]() Projekt Sarah 157
Projekt Sarah 157
![]() Der Delphin 160
Der Delphin 160
![]() Außerirdisdie Kommunikation 173
Außerirdisdie Kommunikation 173
![]() Wie kann außerirdisdie
Kommunikation hergestellt werden? 176
Wie kann außerirdisdie
Kommunikation hergestellt werden? 176
![]() Antikryptographie - oder: Das »Was«
von
Antikryptographie - oder: Das »Was«
von
Weltraumkommunikation 179
![]() Projekt Ozma
184
Projekt Ozma
184
![]() Vorschläge für einen kosmischen Code
185
Vorschläge für einen kosmischen Code
185
![]() Radioglyphen und Lincos
192
Radioglyphen und Lincos
192
![]() Eine Nachricht aus dem Jahre 11.000
v. Chr.? 193
Eine Nachricht aus dem Jahre 11.000
v. Chr.? 193
![]() Pionier 10 [NASA-Sonde] 199
Pionier 10 [NASA-Sonde] 199
![]() Unvorstellbare Wirklichkeiten
201
Unvorstellbare Wirklichkeiten
201
![]() Imaginäre Kommunikation 205
Imaginäre Kommunikation 205
![]() Newcombs Paradoxie 206
Newcombs Paradoxie 206
![]() Flachland 214
Flachland 214
![]() Reisen in die Zeit 219
Reisen in die Zeit 219
[Zitat]
![]() Die ewige Gegenwart 235
Die ewige Gegenwart 235
Offenbarung
10,6
Bibliographie 23
Personen- und Sachregister 247; Paul
Watzlawick, verlinkende Hervorhebungen und einige Illustrationen O.G.J.]
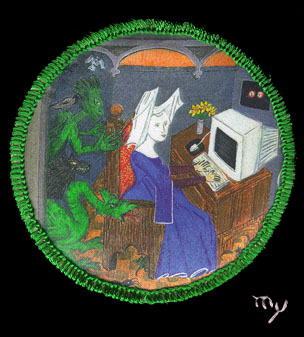 [Wie wirklich
[wirkend] ist die Wirklichkeit?] Fragte etwa P.W.
und gab bereits wichtige ‚grammatische‘ Antworten in kommunikativer
Hinsicht, so dass wir sinnvoll/erhellend zwischen verschiedenen, dennoch
ineinander ‚verwoben‘ bleibenden, ‚Ebenen‘ bzw. ‚Sphären‘ genannten Vorstellungshüllen zu trennen vermögen, gar Horizonte die
so gerne hierarchisierend als ‚Wirklichkeit erster‘, und solche (wahrnehmender/erlebender) ‚zweiter, Ordnung‘ bezeichnet
werden. – Wobei bereits der Ordnungsbegriff
[Wie wirklich
[wirkend] ist die Wirklichkeit?] Fragte etwa P.W.
und gab bereits wichtige ‚grammatische‘ Antworten in kommunikativer
Hinsicht, so dass wir sinnvoll/erhellend zwischen verschiedenen, dennoch
ineinander ‚verwoben‘ bleibenden, ‚Ebenen‘ bzw. ‚Sphären‘ genannten Vorstellungshüllen zu trennen vermögen, gar Horizonte die
so gerne hierarchisierend als ‚Wirklichkeit erster‘, und solche (wahrnehmender/erlebender) ‚zweiter, Ordnung‘ bezeichnet
werden. – Wobei bereits der Ordnungsbegriff
 jenen Kossmos, namentlich: ‚schmucker Schönheit‘, zu
entblößen vermag, der damit hier erreichtet/erhalten werden soll, bis könne – äh
müsse.
jenen Kossmos, namentlich: ‚schmucker Schönheit‘, zu
entblößen vermag, der damit hier erreichtet/erhalten werden soll, bis könne – äh
müsse.
«Dieses Buch
handelt davon, daß die sogenannte Wirklichkeit das
Ergebnis von Kommunikation ist. Diese These scheint den Wagen vor das Pferd zu
spannen, denn die Wirklichkeit ist doch offensichtlich
das, was wirklich der Fall ist, und Kommunikation nur die Art und Weise, sie zu beschreiben
und mitzuteilen.
Es soll gezeigt werden, daß dies nicht so ist; daß das wacklige Gerüst unserer Alltagsauffassungen der
Wirklichkeit im eigentlichen Sinne
wahnhaft ist, und daß wir fortwährend mit seinem
Flicken und Abstützen beschäftigt sind - selbst auf die erhebliche Gefahr hin,
Tatsachen verdrehen zu müssen, damit sie unserer Wirklichkeitsauffassung nicht
widersprechen, statt umgekehrt unsere Weltschau den unleugbaren Gegebenheiten
anzupassen.
Es soll ferner gezeigt werden, daß» die absolut sichere Überzeugtheit davon/‚der Glaube‘ [im heute meist üblichen sekundären, weiteren, ‚den Wissen‘ unter- bis entgegengeordneten Sinne], «es gäbe nur eine Wirklichkeit, die gefährlichste all dieser Selbsttäuschungen ist; daß es vielmehr zahllose Wirklichkeitsauffassungen gibt, die sehr widersprüchlich sein können, die alle das Ergebnis von Kommunikation und nicht der Widerschein ewiger, objektiver Wahrheiten sind. [...]»
Die bereits «gefährliche Wahnidee [....] wird dann aber noch gefährlicher, wenn sie sich mit der messianischen Berufung verbindet, die Welt dementsprechend aufklären und ordnen zu müssen - gleichgültig, ob die Welt diese Ordnung wünscht oder nicht. Die Weigerung, sich einer bestimmten Definition der Wirklichkeit (zum Beispiel einer Ideologie) zu verschreiben, die »Anmaßung«, die Welt in eigener Sicht zu sehen und auf eigene Façon selig zu werden, wird [...] zum »think-crime« in Orwells Sinne abgestempelt [...] Vielleicht kann dieses Buch einen bescheidenen Beitrag dazu leisten, den Blick für bestimmte Formen psychologischer Violenz zu schärfen und so den modernen Gehirnwäschern und selbsternannten Weltbeglückern die Ausübung ihres üblen Handwerks zu erschweren.» (Paul Wartzlawick S. 7+9; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.)
Es geht bei und an dieser bzw. gar jeder Interaktion mit dem (wie des/der) Wirklichen nicht allein um ein labortechnisch-sauberes analytisches Trennen und Auseinanderhalten, etwa im Sinne der Welt chemischer Stoffe (über deren diesbezügliche Schwierigkeiten schon so manches bemerkt wurde), sondern um eine denkerisch-verstehende Unterscheidung und das Erkennen zunächst bzw. wenigstens zweier ziemlich berühmter, gar berüchtigter, Levels, die notwendigerweise ineinander verstrickt bleiben und durchaus interdependent miteinander wechselwirken – also ein erhebliches Ordnungsproblem illustrieren/beleben.
Interessiert äh interesannt an der These vom kommunikativen Charakter, bis an den Theoerien interaktionaler Wirklichkeiten, sind/werden insbesondere die Fragen:
Wie weit gehend total, bis totalitär, sie gemeint sind und gehen?
Gibt es nur, respektive ist alles überhaupt ausschließlich 'Kommunikation' (in diesem erweiterten Sinne)?
Auch im Lichte (anti)monokausalitischer Warnungen vor dichotomisierenden Nullsummenpardigmen des mechanisch-tozallitären 'Weltbildes' mag an den Denkformen der Zusammenhänge von Allem mit Allem illustrativ sein, und richtig bleiben: Dass ein/das/die vom weißen, über buntes bis schwarzes, Rauschensspektrum der Interaktion unterschiedliche Stabilitätsgraduierungen und verschiedene Reprodumtionswahrscheinlichkeiten dessen anbietet, was als 'Aufrechterhaltung äh Beständigkeit von Strukturen erfahren/empfunden – oder immerhin als Muster, bis Ordnung, wahrgenommen – werden mag.
 [Abb.
exemplarisch Elektromagnetisches Rausschensspektrum]
[Abb.
exemplarisch Elektromagnetisches Rausschensspektrum]
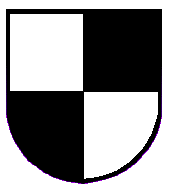
![]() Pablo Picasso – wollte
nicht suchen und fand gar eher.
Pablo Picasso – wollte
nicht suchen und fand gar eher.

Ein paar Kindern, bei deren quasi ‚Schulausflug‘, in die meist ‚Welt‘ genannt עולם der Wirklichkeiten zu folgen mag ja immerhin möglich sein/werden.

![]() Wirklich ist/sei ‚was
wirkt‘, so etwa C.G. Jung (vgl. Thomas-Theorem). –
Hyperrealitäten – weniger, bis überhaupt nicht, wie es/etwas ist (fachsprachlich: ‚ontologisch / Ontologie‘ genannt),
hat Wirkung, sondern hauptsächlich wie es bei uns (betreffend)
ankommt und (gleich gar intersubjektiv konsens- und
eben damit konfliktfähig) gedeutet wird.
Wirklich ist/sei ‚was
wirkt‘, so etwa C.G. Jung (vgl. Thomas-Theorem). –
Hyperrealitäten – weniger, bis überhaupt nicht, wie es/etwas ist (fachsprachlich: ‚ontologisch / Ontologie‘ genannt),
hat Wirkung, sondern hauptsächlich wie es bei uns (betreffend)
ankommt und (gleich gar intersubjektiv konsens- und
eben damit konfliktfähig) gedeutet wird. 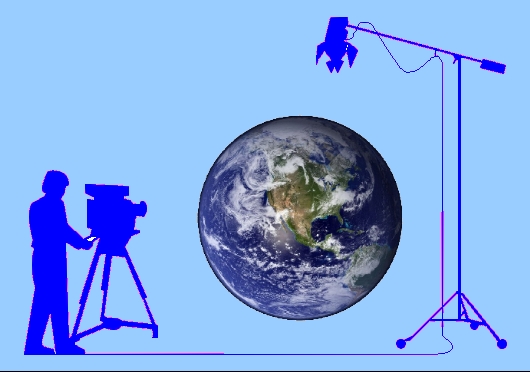

![]() Noch (und gerade) nicht einmal Realita
und Virtualita
schließen einander wechselseitig, notwendig aus.
Noch (und gerade) nicht einmal Realita
und Virtualita
schließen einander wechselseitig, notwendig aus.  - Auch der, teils irreführend dichotom
trennend verstandene, 1989 von
- Auch der, teils irreführend dichotom
trennend verstandene, 1989 von ![]() Jaron Lanier eingeführte Begriff 'virtual reality
/ Virtuelle Realität' betont jedenfalls den Realitätscharakter von
Simuliertem, sich/einem vorgeblich 'bloß' aber immerhin – oder eben elektronisch/computeranimiert allgemein
und vielen Lebewesen recht eindrücklich – Vorgestelltem/Ausgedachtem,
vor (während und/oder nach) seiner oder
ganz ohne seine darüber hinausgehende/n (namatlich: 'stofflich' bis gar 'materiell' genannten)
Realisierung/Umsetzung, An- bis Wahrgenommenen.
Jaron Lanier eingeführte Begriff 'virtual reality
/ Virtuelle Realität' betont jedenfalls den Realitätscharakter von
Simuliertem, sich/einem vorgeblich 'bloß' aber immerhin – oder eben elektronisch/computeranimiert allgemein
und vielen Lebewesen recht eindrücklich – Vorgestelltem/Ausgedachtem,
vor (während und/oder nach) seiner oder
ganz ohne seine darüber hinausgehende/n (namatlich: 'stofflich' bis gar 'materiell' genannten)
Realisierung/Umsetzung, An- bis Wahrgenommenen.
Der vom/durchs französische/n 'virtuel' (fähig zu wirken, möglich) auf das lateinische 'virtus' (Tugend, Tapferkeit, Tüchtigkeit, Kraft, Männlichkeit) zurückgehende Ausdruck steht also/(un)bekanntlich keineswegs im Gegensatz zu 'real'/'wirklich', sondern sucht – auf/vor dem prekären Hintergrund eines antagonistisch gewollten Gegensatzes: Geist oversus Matreie - allenfalls (bis vergebvens – so war immerhin die kirchenlateinische Idee des christlichen Mittelaters ein Wort für die unsichtbare 'virtualita' Anwesenheit Christi, zumal in der Hostie, zu schaffen - und Bildschirme, Projektoren, Bücher pp. sind ohnehien vergleichsweise handfest) von 'physisch/phsysiologisch' Vorfindlichem zu scheiden. - Viel eher gilt quasi umgekejrt, dass icht nur/erst (cyberspace) virtuelle, sondern auch/bereits legendäre und erst recht literarisch erdachte Persönlichkeiten – hauptsächlich aber Ideen und Vorszellungen überhaupt – recht ansehliche, ja durchaus größere/wichtigere Wirkungen auf die und in 'der vorfindlichen Wirklichkeit erster Ordnung' haben, als diese auf 'ihre', nein auf der Menschen, denkerischen Repräsentatio(svorstellung)en davon.
Zwar scheinen Vorstellungen nur Vorstellungen zu sein – doch sind sie derart unverzichtbar, dass sie wichtiger/wirklicher als das zu werden tendieren, was sie vorstellen/darstellen sollen, und\aber unvermeidlich – auch 'hyperreal' genannt - rhetorisch, bis deutend, abbildend erschaffen/d.
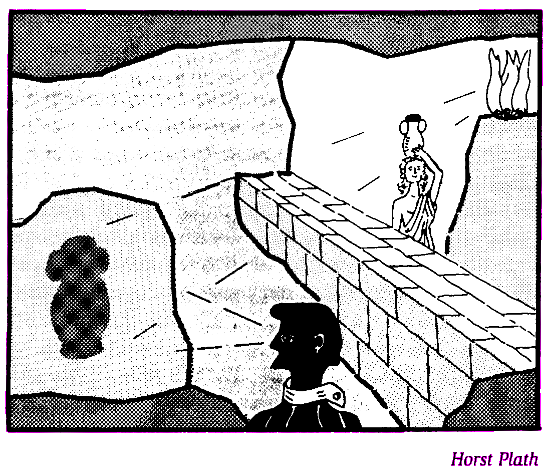 „Flachland“ und/oder immerhin bereits das Höhlengleichnis des
Philosophen Platons bei/mit P.W. (illustriert
etwa vom P.M.-Magazin):
„Flachland“ und/oder immerhin bereits das Höhlengleichnis des
Philosophen Platons bei/mit P.W. (illustriert
etwa vom P.M.-Magazin):
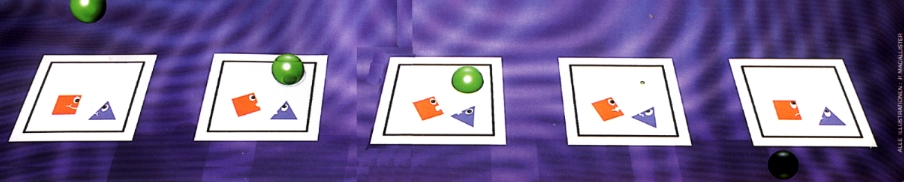
„Es gibt ein
kleines, [1974; O.G.J.] fast hundert Jahre altes Buch, dessen Autor der damalige
Direktor der City of London School, der Hochwürdige Edwin A. Abbott war. Obwohl er über
vierzig andere Werke verfaßte, die alle von seinem Fach,
der klassischen Literatur und Religion, handelten, ist »sein einziger Schutz
gegen völlige Vergessenheit« - um Newmans [117] lapidare Bemerkung zu borgen -
jenes unscheinbare Buch mit dem Titel »Flachland - Eine phantastische
Geschichte in vielen Dimensionen« [1].
Obwohl es
sich nicht bestreiten läßt, daß
Flachland in einem - nun, recht flachen Stil verfaßt ist, ist
es doch ein sehr ungewöhnliches Buch; ungewöhnlich nicht nur deswegen, weil es
gewisse Erkenntnisse der modernen theoretischen Physik vorwegnimmt, sondern
besonders wegen seiner scharfsinnigen psychologischen Intuition, die auch
sein
langatmiger viktorianischer Stil
nicht zu erdrücken vermag. Und es scheint nicht übertrieben, zu wünschen, daß es (oder eine modernisierte Version) zur Pflichtlektüre
für Mittelschüler gemach t würde. Der Leser wird den Grund dafür bald erkennen.
Flachland ist die
Erzählung eines Bewohners einer zweidimensionalen Welt [sic!]; also einer Wirklichkeit, die nur Länge und Breite, aber keine Höhe
kennt; einer Welt [sic!], die flach wie
ein Bogen Papier und von Linien, Dreiecken, Quadraten, Kreisen usw. bevölkert
ist. Diese können sich frei auf, oder besser gesagt, in
dieser Oberfläche bewegen, doch sind sie wie Schatten unfähig, sich über sie zu
erheben oder unter sie abzusinken. Es brau t nicht betont zu werden, daß
sie sich dieser Beschränkung unbewußt sind, denn die
Idee einer dritten Dimension, der Höhe, ist für sie unvorstellbar.
Der Erzähler
dieser Geschichte hat ein ihn völlig überwältigendes Erlebnis, dem ein
sonderbarer Traum vorausgeht. In seinem Träume findet er sich plötzlich in
einer eindimensionalen Welt, deren Bewohner entweder Striche oder Punkte sind,
die sich alle auf ein und der selben
Linie vor- oder rückwärts bewegen. Diesen Strich nennen sie ihre Welt [sic!], und für die Bewohner von Strichland ist die Idee, sich auch nach rechts oder
links, statt nur nach vorne oder rückwärts zu bewegen, vollkommen
unvorstellbar. Vergeblich versucht unser Träumer also, dem längsten Strich in
Strichland (ihrem Monarchen) die Wirklichkeit von Flachland verständlich zu
machen. Der König hält ihn für
geistesgestört,
und angesichts solch hartnäckiger Borniertheit verliert der Träumer schließlich
die Geduld:
Wozu noch
mehr Worte verschwenden? Wisse, daß ich die Vollendung deines
unvollständigen Selbsts bin. Du bist eine Linie, aber
ich bin eine Linie von Linien, in meinem Lande ein Quadrat genannt: Und selbst
ich, obwohl dir unendlich überlegen, gelte wenig im Vergleich zu den großen
Edlen von Flachland, von wo ich, in der Hoffnung, deine Unwissenheit zu
erleuchten, gekonmen bin. [2]
Auf diese
wahnwitzigen Behauptungen hin stürzen sich der König und alle seine strich- und
punktf örmigen Untertanen
auf das Quadrat, das aber durch das Läuten der Frühstücksglocke in die flachländische Wirklichkeit zurückgeholt wird.
Im Laufe des
Tages tritt ein weiteres ärgerliches Ereignis ein. Das Quadrat gibt seinem
kleinen Enkel, einem Sechseck*, Unterricht in den Grundbegriffen der Arithmetik
und ihrer Anwendung auf die Geometrie. Es zeigt ihm, wie die Zahl der
Quadratzoll eines Quadrats einfach dadurch berechnet werden kann, daß man die Seitenlänge in Zoll zu ihrer zweiten Potenz
erhebt:
Das kleine
Sechseck überlegte sich dies eine Weile und sagte dann: »Du hast mich aber auch
gelehrt, Zahlen zur dritten Potenz zu erheben: Ich nehme an, 3³ muß eine
geometrische
Bedeutung haben; was bedeutet es?« »Nichts, gar
nichts«, antwortete ich, »wenigstens nicht in der Geometrie; denn die Geometrie
hat nur zwei Dimensionen.« Und dann zeigte ich dem
Jungen, wie ein Punkt, der sich um drei Zoll verschiebt, eine Linie von drei
Zoll erzeugt, die sich durch die Zahl 3 ausdrücken läßt;
und wie eine Linie von drei Zoll, die sich drei Zoll weit parallel zu sich
selbst
verschiebt,
ein Quadrat von drei Zoll Seitenlänge ergibt, das durch 3² ausgedrückt
werden kann.
Worauf mein
Enkel wiederum auf seinen früheren Einwand zurückkam, in dem er mich unterbrach
und ausrief: »Nun denn , wenn ein Punkt durch die Bewegug
von drei Zoll eine Linie von drei Zoll erzeugt, die durch 3 dargestellt wird;
und wenn eine grade Linie von drei Zoll, die sich parallel zu sich selbst
verschiebt, e in Quadrat von drei Zoll Seitenlänge ergib t, dargestellt durch
3²; so muß ein Quadrat von drei Zoll Seitenlänge, das
sich irgendwie parallel zu sich selbst bewegt
(obwohl ich
mir nicht vorstellen kann, wie), etwas ergeben (obwohl ich mir nicht vorstellen
kann, was), das in jeder Richtung drei
Zoll mißt - und das muß
durch 3³ dargestellt sein.«
»Geh z u
Bett«, sagte ich, etwas über seine Unterbrechung verärgert, »wenn du weniger
Unsinn sprächest, hättest du mehr Vernunft.« [3]
Und so
wiederholt das Quadrat, ohne sich von seinem eigenen T r a ume
eines Besseren belehren zu lassen, den selben Irrtum, von dem
er [es!] den König von Strichland
zu befreien versucht hatte. Im Laufe des Abends aber will ihm das Geschwätz
seines Enkelkindes nicht aus dem
Kopf [sic!] gehen, und
schließlich ruft es laut aus : »Der Junge ist ein
Dummkopf, sage ich; 3³ kann keine Entsprechung in der Geometrie haben.«
Plötzhch aber hört
er [es] eine Stimme: »Der Junge ist kein
Dummkopf; und 3³ hat eine offensichtliche geometrische Bedeumng.« Es ist die Stimme eines
sonderbaren Besuchers, der aus Raumland gekommen
* Wie der
Erzähler erklärt, ist es ein Naturgesetz in Flachland, daß
ein männliches Kind immer um eine Seite mehr als sein Vater hat, sofern der
Vater wenigstens ein Quadrat und nicht bloß ein gesellschaftlich tiefstehendes
Dreieck ist. Wenn
schließlich
die Seitenzahl so groß ist, daß die Figur sich nicht
mehr von einem Kreis unterscheiden läßt, gehört diese
Person der Kreis- oder Priesterkaste an.
Zu sein
behauptet - einer unvorstellbaren Welt [sic!], in der die Dinge drei
Dimensionen haben. Und ähnlich, wie das Quadrat selbst sich in seinem Traume
bemüht hatte, versucht nun der Besucher, ihm die Augen dafür zu öffnen, wie
eine dreidimensionale Wirklichkeit beschaffen und wie beschränkt Flachland im
Vergleich zu ihr ist. Und genauso, wie das Quadrat selbst sich dem König von
Strichland als Linie von Linien vorstellte, definiert sich der Besucher als
Kreis von Kreisen, der in seinem Heimatland eine Kugel genannt wird. Dies aber
kann das Quadrat natürlich nicht fassen, denn
es sieht seinen Besucher als Kreis - allerdings als einen Kreis mit sehr
befremdlichen, unerklärlichen Eigenschaften: Er wächst und nimmt wieder ab,
schrumpft gelegentlich zu einem Punkt oder verschwindet völlig.
Mit großer
Geduld erklärt ihm die Kugel, daß an all dem nichts
Merkwürdiges ist: Sie ist eine unendliche Zahl von Kreisen, deren Durchmesser
von einem Punkt bis zu dreizehn Zoll steigt und die auf einander gelegt sind.
Wenn sie sich also durch die zweidimensionale Wirklichkeit von Flachland
bewegt, ist sie für einen Flachländer zunächst unsichtbar, erscheint dann als
Punkt, sobald sie die Fläche von Flachland berührt, wird dann zu einem Kreis
mit stetig wachsendem Durchmesser, bis ihr Durchmesser wieder abzunehmen
beginnt und sie schließlich ganz verschwindet (Abbildung 14)
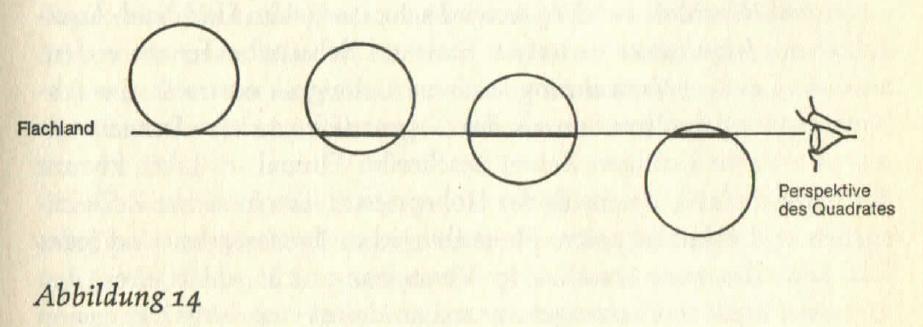
Dies erkläre
auch die überraschende Tatsache, daß die Kugel das
Haus des Quadrats trotz der verschlossenen Türen betreten konnte. Die Kugel
betrat es natürlich von oben, doch die Idee
»von oben«
ist dem Denken des Quadrats so fremd, daß es sie
nicht fassen kann und sich daher weigert, sie zu glauben [sic1]. Schließlich
sieht die Kugel keinen anderen Ausweg, als dem Quadrat, indem sie es nach Raumland mitnimmt, eine Erfahrung zu vermitteln, die wir
heute ein transzendentales Erlebnis nennen würden:
Ein
unbeschreibliches Grauen packte mich. Da war Finsternis; dann eine
schwindelerregende, schreckliche Sicht, die nichts mit Sehen zu tun hatte; ich sah eine Linie,
die keine Linie war; Raum [sic! eher ‚Ebene, die doc
keine …‘? O.G.J.], der kein Raum war: ich war ich selbst und nicht ich selbst.
Als ich meiner Stimme wieder mächtig war, schrie ich in Todesangst:
»Dies ist
entweder Wahnsinn, oder es ist die Hölle.« »Es ist
weder das eine noch das andere«, antwortete die ruhige Stimme der Kugel, »es
ist Wissen; es sind drei Dimensionen: öffne deine Augen wieder und versuche,
ruhig zu blicken.« [4]
Von diesem
mystischen Augenblicke an nehmen die Ereigiüsse einen
tragikomischen Verlauf. Trunken durch das überwältigende Erlebnis des
Eintretens in eine vöUig neue Wirklichkeit, möchte
das Quadrat nun die Geheimnisse immer höherer Welten [sic!] erforschen, der Reiche [sic!] von vier, fünf und sechs
Dimensionen. Doch die Kugel will nichts von
diesem
Unsinn wissen: »Ein solches Land gibt es nicht. Die bloße Idee ist völlig undenkbar.« Da das Quadrat aber nicht aufhören will, darauf zu
bestehen, schleudert es die erzürnte Kugel schließlich in die Enge von
Flachland zurück.
An diesem
Punkte wird die Moral der Geschichte sehr realistisch. Das Quadrat sieht sich
vor die glorreiche, dringende Aufgabe gestellt, ganz Flachland zum Evangelium
der drei Dimensionen zu bekehren.
Doch es
fällt ihm nicht nur immer schwerer, die Erinnerung an jene dreidimensionale
Wirklichkeit wach zu rufen, die anfangs so klar und unvergeßlich
schien, sondern es wird sehr rasch vom Flachland-Äquivalent der Inquisition
verhaftet. Statt am Scheiterhaufen zu enden, wird es zu ewiger Verwahrung in
einem Gefängnis verurteilt, das Abbotts erstaunliche Intuition als das
Gegenstück gewisser Irrenanstalten in unseren heutigen Zeiten beschreibt.
Einmal im Jahre kommt der Oberste Kreis, das heißt der Hohepriester, ihn in
seiner Zelle besuchen und erkundigt sich, ob es ihm schon besser geht. Und
jedes Jahr kann das arme Quadrat der Versuchung nicht widerstehen, den
Obersten
Kreis zu überzeugen versuchen, daß es eine dritte
Dimension wirklich gibt - worauf jener den Kopf schüttelt und sich ein weiteres
Jahr lang nicht sehen läßt.
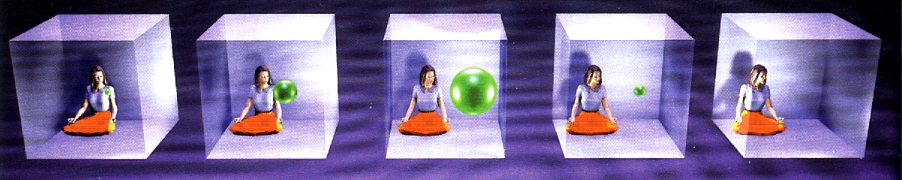
Flachland stellt die Relativität der Wirklichkeit
schlechthin dar, und aus diesem Grunde möchte man wünschen, daß
das Buch von jungen [sic!] Menschen gelesen werde. Die
Geschichte der Menschheit zeigt, daß es kaum eine
mörderischere, despotischere Idee gibt als den Wahn einer »wirklichen«
Wirklichkeit (womit natürlich die eigene Sicht gemeint
ist), mit all den schrecklichen Folgen, die sich aus dieser wahnhaften
Grundannahme dann streng logisch ableiten lassen. Die Fähigkeit, mit relativen
Wahrheiten zu leben, mit Fragen, auf die es keine Antworten gibt, mit dem
Wissen, nichts zu wissen, und mit den paradoxen Ungewißheiten
der Existenz, dürfte dagegen das Wesen
menschlicher
Reife und der daraus folgenden Toleranz für andere sein. Wo diese Fähigkeit
fehlt, werden wir, ohne es zu wissen, uns selbst wiederum der Welt [sic!] des Großinquisitors
ausliefern und das Leben von Schafen leben, dumpf und verantwortungslos und nur gelegentlich
durch den beizenden Rauch eines prächtigen Autodafés oder
der Schlote
von Lagerkrematorien unseres Atems beraubt.“ (Paul Watzlawick, S. 214 ff, verlinkende Hervorhebungen O.G.J.)  [Spätestens Bücherverbrennungen …]
[Spätestens Bücherverbrennungen …]
 Freiheitsdialog – ist gar Wirkliches wirklich (oder nur dadurch/dann wirklich) wenn/wo es
zwingend ist/wird?
Freiheitsdialog – ist gar Wirkliches wirklich (oder nur dadurch/dann wirklich) wenn/wo es
zwingend ist/wird?
«Good morning, Neson College!»
|
Speaker [with a full
curtsy]: «Good
evening Your Grace! This benevolent attention is a great pleasure for us. Some of our gifted
language fans prepared a dialog for you. May © we present our protagonists [both girls bob a
court curtsey, too]
of the smal play about freedom and liberty or
determination! Da ist unsere Alice [diese knickst] die als Freifraulein ups, in der Debatte die Position der Libertas verficht, und die Lady daneben [auch diese ©] ist Dorothy, hier mal in der Rolle der Zofe [Dorothy knixst vor Alice, dann hilft sie ihr sich artig an der Mauer niederzulassen und kauert sich selbst elegant dazu] und Dienerin, brav auf den Determinismus vertrauend! |
|||
|
|
|
|
|
|
|
Das Stilmittel des Zwiegesprächs ist ja weit älter, als die berühmten großen Dialoge antiker Philosophen, mit denen wir uns erst gar nicht vergleichen wollen. Vielmehr werden wir davon bewegt, dass es sogar einen ganzen Buchstaben ups – das semitische Waw - gibt, der ihm gleich zu Gesprächsbeginn sowie von Anfang an gewidmet ist: UND/ABER ... our question is: Are they, both the lady's maid and her mistress ..., is one of the intelectual positions ..., are we or people ... actually trapped - between walls .... perhaps ourselves made ones? They shall test .... at least another kind of social status relationship and some language, for us here. Let's have a look ... © and please!» |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
[Alice und Dorothy erheben sich, wenden sich einander zu und die Freiin beginnt mit einem tiefen Knirr vor ihrer Zofe zu behaupten]: «Es gibt Freiheit!» Dienerin ©: «Ich habe zu sagen: Es gibt keine Freiheit!» Feiin: «Eine von uns - da wir uns widersprechen - behauptet etwas Falsches.» Dienerin: «Beides kann nicht zugleich wahr sein. - © In der Tat!» |
«She, Dorothy does kindly
accept the general logic of only two, it's right or wrong,
... [smiles a bit] ... possibilities - Tertium
non datur - as she has to, by her
mistress's guideline. But, as © you all know, there are indeed alternatives
imaginable to broaden the horizons of the truth. - Well let's accept the
quite usual Socratic to Aristotelic condition and see how far we will
get, for the moment.» |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Feiin: «Auch wenn jemand es nicht nur nach aussen behauptet, sondern es einzusehen meint, hat sie oder er diese Auffassung von etwas Falschem, © Deiner Auffassung nach, zwangsläufig. Der Jemand ups kann nichts dafür, es hängt nicht von seiner Entscheidung ab, er oder sie muss das Falsche für wahr halten.» Dienerin: «Unter den, von © Euch geschilderten Umständen, allerdings.» Freiin: «Und wenn die deterministischen Sätze bestimmt hätten, dass © Du das Falsche behauptest und als wahr zu erkennen glaubst ups, gälte das ebenso für © Dich?» Dienerin © : «Zwangsläufig.» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Freiin: «Da aber eine von uns etwas Falsches behauptet, und unterstellen wir einmal, dass sie nicht lügt, dass sie eben auch selbst für wahr hält, was sie sagt - setzt sich auch die Wahrheit nicht notwendig durch. - Sondern es kann ebenso zwangsläufig aus einer Überlegung oder Diskussion das Falsche herauskommen. Und wir haben, da es uns beiden nach © Deiner Auffassung, auch fälschlich als wahr vorkommen könnte - ohne, dass wir etwas dazu können - von uns aus keine Möglichkeit, dies aus uns Eigenem heraus zu korrigieren und zu steuern.» Dienerin: «Ja - es sei denn © wir seien dazu programmiert.» Freiin: «Weil aber eine von uns © Deiner Auffassung nach, auf etwas Falsches hin programmiert ist, und wir auch beide daraufhin festgelegt sein könnten, wäre auch möglich, dass wir, anstatt das Falsche auf das Wahre hin, in der Diskussion zu verbessern, wir © das Wahre diskutierend gerade zum Falschen hin verbiegen.» Dienerin ©: «Dies vermag ich nicht zu bestreiten.» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Freiin: «Dann aber - und immer wenn ich die Unfreiheit der Diskutanten unterstelle, oder gar nachwiese - ist unsere Diskussion so sinnvoll, wie ein Wortwechsel zwischen Papagaien - oder genauer, nur wie ein Redekampf zwischen zwei Schallplatten / Audio-CDs. - Das heißt doch: Ich kann im Grunde, wenn ich nicht frei bin, nicht Urteilen! Wenn ich Dinge sagen © muss, ohne die freie Möglichkeit Stellung dazu zu nehmen, bin ich überhaupt nicht der Wahrheit fähig.» Dienerin ©: «Ihr zeigt - um überhaupt gültig behaupten zu können: 'Es existiert keine Freiheit', muss man frei sein! Würde eine von uns behaupten: 'Es gibt keine Wahrheit', so widerlegte sie sich durch diese Behauptung ja auch selbst. © Quod erat demonstrandum. - . Doch wenn nun ich © Eure Dienerin sage: 'Alle Dienerinnen lügen immer'? - © Ihr kennt die berühmte biblische, sogenannte Antinomie von jenem Kreter. - Ist uns Freiheit immer nur punktuell, also unter bestimmten Bedingung gegeben, und unter anderen Bedingungen oder Hinsichten nicht? ©» Feiin: «In © Deinem English dictionary steht - sogar gut übersetzbar - der Satz: 'Es regnet.'. Und Du hast ihn mir heute noch ins Japanische zu tragen! [Dorothy © folgsam] Doch, ist es schon deswegen ein schlechtes, gar falsches Buch, da diese Aussage ja gar nicht zutrifft? - Sage ich hingegen: © 'Du bist meine Zofe.' So stehe ich doch in einer gewissen Freiheit hinter diesem Satz, der damit sogar ebenso eine Behauptung ist, wie die Feststellung, dass es hier gerade nicht regnet. Während das 'es regnet' in dem Buch, und sogar in mehren Sprachen, trotzdem und gleichzeitig als grammatisch richtiger Satz vorkommt.» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dienerin: «Obwohl © Ihr zurecht sagt, und schon damit auch ich, als © Eure Dienerin, zu behaupten habe und möchte, dass es hier jetzt mal nicht regnet! - Um dies und überhaupt jrgend etwas behaupten zu können brauche also selbst ich, die © Euch verpflichtete Zofe, so eine ups Art Freiheit, ich muss © persönlich zu der Behauptung, und inhaltlich dahinter, stehen können, und es damit auch verantworten, falls ich, warum auch immer, falsch bzw. - verzeiht © nir bitte die Kühnheit dieser, - for such a naughty maid - abwegigen Vorstellung - richtig läge. [Alice lächelnd © zu Dirothy] Weit mehr als jetzt nur irgendwo den, hoffentlich grammatisch richtigen, japanischen Regen-Satz für © Euch wieder zu finden.» |
|
|
|
|
|
Beide ©: «Konnitiwa! ach 'ame ga futte'imasu' ist es auf Japanisch und vor allem unserseits vielmals [beide Waii mit Knicksen] arigatoogozaimasu rüber nach Asien!» |
|
|||
|
Freiin: «Es gibt also Freiheit, die allerdings spätestens da nicht absolut sein kann, wo ich die Existenz © anderer Wesen anerkenne, an deren vergleichbare Freiheit die meinige damit angrenzen kann. Wenn ich © Dir nun aber vorgelebt, oder gar gleich befohlen, hätte, etwas zu behaupten, respektive sogar auszuführen, von dem eine von uns und/oder wir beide meinen, es sei falsch - hätte ich uns doch beide in arge Bedrängnis gebracht.» Dienerin [kniet rasch vor Alice nieder]: «Und ich habe zumindest Eure Strafe dafür verdient, Euch nicht einmal dann vor einem Fehler bewahrt zu haben, wenn ich unziemlicherweise widersprochen, mich gar - pfui, welch frevelhafter Gedanke - geweigert hätte [Dorithy macht einen Kotai] Euch zu folgen.» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Freiin [kniet nun ebenfalls, vor Dorothy nieder]: «Danke, dass Du das Mögliche versuchst und brav selbst jene Folgen meines Vergehens, für die Du nichts kannst, bereitwillig mit mir teilst - anstatt mich artig zu verlassen. Doch selbst hättest Du mir hingegen, warum auch immer, gehorcht wäre meine Schuld ja nicht - wie vielleicht ein dabei auch noch angerichteter, etwa wirtschaftlicher Schaden - nur irgendwie auf uns verteilt, sondern - wenigstens um das was jede von uns wider besseres Wissen getan hat – größer, und insgesamt nicht nur einer von uns allein zurechenbar, geworden.» Dienerin: «Ich könnte mich, soweit ich es - verzeiht mir bitte [nun senkt Alice ihr Haupt] - besser gewusst und dennoch getan hätte, nicht auf Euren Befehl, oder Eure Bewaffnung, als äussere Zwänge berufen, um selbst weniger schuld zu sein. Ohnehin sind Menschen und Organisationen für, die von ihnen selbst unerwarteten, Folgen ihres Tuns, ja nicht weniger verantwortlich, als für die intendierten Wirkungen. Spätestens infolge der Unvollständigkeit verfügbarer Kenntnisse, zumal des Überblicks, lassen sich nun aber nicht alle Fehler ohne Reste und Spuren vermeiden: Ist also immrthin solches Lernen möglich! Und dabei bzw. damit wäre zumindest eine Art von Vergebung, wo nicht - so allerdings bei Weitem nicht immer allein schon hinreichende - Sühne, nötig. - Doch was Ihr mir befahlt, war ja gar nicht falsch! Ich bitte Euch untertänig [Dorothy macht noch einen Kotau vor der knienenden Alice] aufzustehen, Ihr habt ja noch nicht einmal virtuell etwas Unrechtes getan!» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Freiin [hebt den Kopf]: «Möge es uns erspart bleiben, dass das Gedächtnis sagt: 'Das hast Du getan!' und mein Stolz, mit seiner,noch nicht einmal vorgeblich harmlosen rhetorischen, Frage: 'Das soll ich getan haben?' Sieger bleibt - wie ja bereits Nietzsche formulierte. - Du aber, meine unterwürfige Dienerin hast ja erst recht keine Schuld, an meinen hypothetischen Vergehen. ... Vergib und hilf mir, bitte!» [Alice senkt den Kopf wieder] Dienerin [springt schnell auf, knickst rasch rasch tief vor, eilt zu der knienden Alice und assistiert ihr sorgsam beim Aufstehen]: «Danke, sehr freundlich von © Euch! Ich meinte indes ja schon arrogant, meine Schuld wäre ohnehin viel zu groß um überhaupt ... - © Ihr kennt ja den Patriarchen Kain. Wenn wir nun aber von © jemand anderem wüsten, der oder die etwas Falsches zu tun beabsichtigt, und wir würden bis können es nicht verhindern?» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Freiin: «So ist dieser Misserfolg bestimmt nicht immer leicht zu ertragen und uns hoffentlich, trotz der Enttäuschung, Mitgefühl, ja Verantwortung, für die Opfer möglich! - Doch © Du hasr ganz recht: wer einigermaßen aufmerksam ist wird eine sehr, sehr große Zahl davon bemerken - und sich, die beiden Grundfragen 'wer hilft wenn nicht ich' und 'wann wenn nicht jetzt', zumindest oder eher auf seinen tatsächlichen Einflussbereich beschränkt, stellrn müssen. Was unsere, wie alle übrigen notwendigerweise immer darüber hinausreichenden, Interessenbereiche angeht ist eine benachbarte, respektive subsidarisch eine größere, soziale Figuration, mit Ihren Kapazitäten und gar entsprechenden Experten, gefragt - die allerdings von den Opfern erfahren und in ihrem Tun bzw. Lassen kontrolliert werden müssen.» Dienerin: «Für einen © ordentlichen anstatt fanatischen Umgang mit so hohen Idealen wie 'persönlicher Betroffenheit vom Ergehen Dritter', der 'Vervollkomenung der Welt' etc. gilt, dass es © Euch und mich in erhebliche Schwierigkeiten bringt, sie hier und heute von © anderen und/oder mir aus einzufordern. Denn alle wirklichen Ideale sind definitionsgemäß ein Stück größer als © Menschen - messen wir uns oder gar © andere daran, müssten wir logischerweise scheitern [beide ©] und uns ehrlicherweise [beide knien nieder und legen sich Halsgeigen-Pranger an] schämen, und würden gar auch noch der anderen Scham herum zeigen.» Beide: «Mea
culpa, mea maxima culpa!» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Freiin: «Hier liegen wir nun also beide konsequenterweise von unseren Idealen bedrückt, dabei sind oder wenigstens waren deise doch ein so guter, gar unverzichtbarer Kompass - manche müssen doch regelrecht heilig gehalten werden und bedrücken doch so.» Dienerin: «Also darf eine unwürdige Zofe wie ich schon gar nicht daran denken, Ideale in die Hand zu nehmen, um sie anderen und deren Tun als Mass, im und für das Hier und das Jetzt, anlegen zu wollen, jedenfalls nicht ohne die heiligen Ideale durch dieses Messen zu entwerten.» Freiin: «Nicht einmal eine geweihte Priesterschaft würde mich dadurch heiligen - allenfalls, gar zu recht, bestrafen -, dass sie mir eine geweihte oder sonstige Last auf- oder anlegt. Legen wir also uns, unserern Mitmenschen unserer Gesellschaft Ideale als Hypothek, als Bringschuld auf bzw. als Mühlstein um den Hals, dürfte die zielführende Orientierung an ihnen schwer fallen bis unmöglich werden, wo alle Ideale gleich hohe und schwer rund um uns her erdrücken. - Geben wir sie also einmal versuchsweise, lieber an höherer Stelle, ab!» |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
[Beide erheben sich, einander gegenseitig mühsam stützend, wenden sich dem Flaggenmast zu, knicksen mühsam unter ihren Lasten, lösen diese von ihren Hälsen, hängen sie am Mast ein, um sie ein Stück daran hochzuziehen. Dann knicksen sie befreit gemeinsam Hand in Hand vor dem erhöten Symbolm, lassen sich los, kehren beschwingt zur Mauer zurück und wenden sich wieder einander zu.] |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Dienerin ©: «Begegne ich nun einem unvollkommenen Mitmenschen oder mir selbst, sage und denk ich besser nicht wieder: 'Du hast Mist gebaut!' sondern lieber: © 'Welcome to the club! © Ihr übst auch noch, gell, ich üb auch noch.' Es ist deutlich leichter wohlwollend mit © Menschen und unseren Fehlern umzugehen, zu erkennen: 'Ah das war © nicht perfekt, aber ich denke ich habe etwas gelernt.'» Freiin: «Ja, ich auch [sieht zum Flaggenmast hinüber] schau mal da drüben. [Dorothy © und sieht ebenfalls hin] die ganzen Ideale sind erhalten geblieben. Doch jetzt können wir sie immer gut sehen, uns an ihrer zeitlosen Richtungsvorgabe orientieren, um das Ziel zu finden und uns nicht wieder nur im eigenen Kreis zu drehen. Ihr Anblick vermittelt gar Hoffnung und Kraft, die Aussicht und Wege dahin kommen zu können, Frustrationen zu überwinden und Hindernisse lieber zu umgehen, als auszumessen. Die Ideale haben dadurch, dass sie an geeigneter Stelle aufgehoben werden, an Wirksamkeit gewonnen.» |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dienerin: «Jenes der © Freiheit - von der wir nicht nur reden, sondern die wir haben und nicht vollständig an andere delegieren können - ist also keine Freiheit von allem und jedem, vielmehr eine, in all diesen Entscheidungen, tun zu können was recht und lassen zu dprfen was falsch ist. ... Wir müssen also nicht einmal über zweiwertige Logiken des entweder-oder hinausdenken um bedingte Freiheit des und der Menschen © zu akzeptieren.» Freiin: «Die kreative Freiheit aber, jene die mit Kant darin besteht einen Anfang – henräisch ausgrechenet ReSCHiT – zu machen, kann und braucht also nicht immer nur, und schon gar nicht allein, vollendet werden. - Vielmehr wird es mir, bei allem Bemühen, entschuldigung [beide knicksen synchron sehr formell] gnadenbedürftig an jener Gerechtigkeit, die ich vor [Alice wendet sich zu einem tiefen Knicks ihrer Zofe zu] Dir liebe Dorothy, vor © Ihnen und Euch allen, vor [beide knicksen einander kurz zugewandt 'spiegelbildlich'] mir selbst und vor © G'tt gehabt haben sollte.» |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beide © «Thank you all very much for your precious attention! And, good evening.» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 Dank den beiden Musikerinnen Lady
Dorothy, ihrer Baroness Alice und denen ganzem Colleg
auch für dieses Spiel.
Dank den beiden Musikerinnen Lady
Dorothy, ihrer Baroness Alice und denen ganzem Colleg
auch für dieses Spiel. ![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
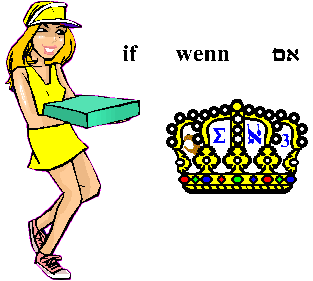 Falls, bis da (Freiheit), in den
Sinnen, wirklich( mitwirkend)e
Wirklichkeiten existieren, dass diese (also
gleich gar deren, bis damit wechselwirkende, Erleben/Erfahren
undװaber
grammatisches/sprachlich-denkerische Repräsentationen) nicht vollständig ausschließlich
allein von uns, bis mir, determinierbar/bestimmt.
Falls, bis da (Freiheit), in den
Sinnen, wirklich( mitwirkend)e
Wirklichkeiten existieren, dass diese (also
gleich gar deren, bis damit wechselwirkende, Erleben/Erfahren
undװaber
grammatisches/sprachlich-denkerische Repräsentationen) nicht vollständig ausschließlich
allein von uns, bis mir, determinierbar/bestimmt. 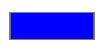 Widrigenfalls wäre/bleibt immerhin
(er)klärungsbedürftig warum/wie/wann das ‚für wirklich Gehaltene‘, dann nicht
besser erdacht / ‚funktioniert‘?
Widrigenfalls wäre/bleibt immerhin
(er)klärungsbedürftig warum/wie/wann das ‚für wirklich Gehaltene‘, dann nicht
besser erdacht / ‚funktioniert‘?
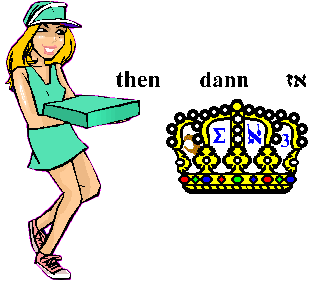 Wenn/Da Wirklichkeiten
(sogenannt ‚erster Ordnung‘ –
gar/immerhin im Plural repräsentabel) existieren, folgt bereits
grammatikalisch aus/gemäß dem Futurum exactum / ‚vollendetem Zukunftstempos‘. dass ‚was nun /
gegenwärtig wirklich ist‘, auch dann ‚(damals)
wirklich gewesen sein wird‘, wenn eine derart andere Gegenwart gegenwärtig,
dass nicht einmal Spuren oder menschliche Zeugen, jenes Wirklichen präsent (vgl. die erhebliche, bis omnipräsente, Irritation gar
nicht ohne Grammatik auszukommen, hier als/in Formen überraumzeitlicher
Bewusstheit/en). Gleich gar mit teils recht erheblichem
Auseinandersetzungsbedarf ‚damit/deswegen‘(vgl.
‚Versöhnungsbedarf mit‘, gar versus ‚Erlösungshoffnungen von‘ bis
‚Auflösungsversprechungen der‘ Realität/en, gar von Anderheit/en).
Wenn/Da Wirklichkeiten
(sogenannt ‚erster Ordnung‘ –
gar/immerhin im Plural repräsentabel) existieren, folgt bereits
grammatikalisch aus/gemäß dem Futurum exactum / ‚vollendetem Zukunftstempos‘. dass ‚was nun /
gegenwärtig wirklich ist‘, auch dann ‚(damals)
wirklich gewesen sein wird‘, wenn eine derart andere Gegenwart gegenwärtig,
dass nicht einmal Spuren oder menschliche Zeugen, jenes Wirklichen präsent (vgl. die erhebliche, bis omnipräsente, Irritation gar
nicht ohne Grammatik auszukommen, hier als/in Formen überraumzeitlicher
Bewusstheit/en). Gleich gar mit teils recht erheblichem
Auseinandersetzungsbedarf ‚damit/deswegen‘(vgl.
‚Versöhnungsbedarf mit‘, gar versus ‚Erlösungshoffnungen von‘ bis
‚Auflösungsversprechungen der‘ Realität/en, gar von Anderheit/en).

 Zumindest, und jedenfalls, haben Dinge,
Ereignisse und sogar ([zumal teilnehmend]
beobachtende) Personen, die Menschen
für wirklich/real halten, verhaltensfaktisch reale/wirkliche Konsequenzen (vgl. ‚Thomas-Theorem‘ als/die Grundeinsicht
gesellschaftswissenschaftlichen Forschens und Erklärens). Ohnehin
gehören sogenannte ‚Abstrakta‘ wie etwa Gedanken/Ideen, der Geldwert einer Münze,
bis einer Banküberweisung, oder der Nutzen/Sinn eines Satzes respektive dieser
Behauptung, nicht weniger konkret zu, gar wichtigen (womöglich intersubjektiv konsensfähigen), jedenfalls oft recht
wirksamen Vorfindlichkeiten, als (zumindest scheinbar) leichter haptisch
/ händisch Fassbares.
Zumindest, und jedenfalls, haben Dinge,
Ereignisse und sogar ([zumal teilnehmend]
beobachtende) Personen, die Menschen
für wirklich/real halten, verhaltensfaktisch reale/wirkliche Konsequenzen (vgl. ‚Thomas-Theorem‘ als/die Grundeinsicht
gesellschaftswissenschaftlichen Forschens und Erklärens). Ohnehin
gehören sogenannte ‚Abstrakta‘ wie etwa Gedanken/Ideen, der Geldwert einer Münze,
bis einer Banküberweisung, oder der Nutzen/Sinn eines Satzes respektive dieser
Behauptung, nicht weniger konkret zu, gar wichtigen (womöglich intersubjektiv konsensfähigen), jedenfalls oft recht
wirksamen Vorfindlichkeiten, als (zumindest scheinbar) leichter haptisch
/ händisch Fassbares.

Und zwar auf/vor den Hintergründen dessen was sie annehmend interessiert unterstellen, wie die Wirklichkeit/en funktioniere/n, respektive wie sie (zumal durch vorbildliche Beiträge) eigentlich besser gestaltet funktionieren würde/sollten.
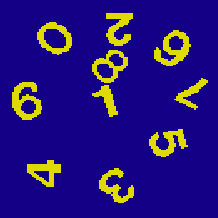 Die basalste Modalität alles (pluralistisch
anstatt; ‚
Die basalste Modalität alles (pluralistisch
anstatt; ‚des‘) überhaupt Wirklichen, die
arithmetisch-algebraische überrascht so manche durch Diskontinuitäten – gleich
gar/immerhin, mehr oder minder deutlich/klar, (doch
erst mittels, gar unterlass- bis änderbarer, Wahrnehmungen – vgl. ästhetische
Modalität) erkennbarer und\aber zudem unterschiedlicher (durchaus vielfältig und vielzahlig
deutungsbedürftiger – vgl. semiotische Modalität) Signale/Zeichen. –
Zumal seitens des indoeuropäischen Verständnisses / Gebrauchs der
Singularentdeckung als (gar blasphemisch-gotteskästerlicher) Verrat empfindbar / skandalös.  [Was
(respektive ob überhaupt) Zahlen bis /otijot/ אותיות sind oder werden, das
wissen wir nicht!
‚Ihre/Unsere‘ Repräsentationen (namentlich
‚Zeichen /taw/ תו wie Ziffer, Buchstabe, Note bis so manche
Signale mehr) erscheinen zwar variabel vereinbar, doch dann/daher
keineswegs vollkommen beliebig/willkürlich zählend zu reproduzieren /
verständlich]
[Was
(respektive ob überhaupt) Zahlen bis /otijot/ אותיות sind oder werden, das
wissen wir nicht!
‚Ihre/Unsere‘ Repräsentationen (namentlich
‚Zeichen /taw/ תו wie Ziffer, Buchstabe, Note bis so manche
Signale mehr) erscheinen zwar variabel vereinbar, doch dann/daher
keineswegs vollkommen beliebig/willkürlich zählend zu reproduzieren /
verständlich]
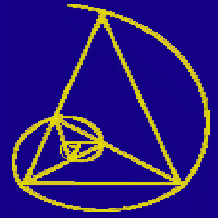 Dass Abstände / Umgebungen / Zusammenhänge,
zumal räumliche und\aber gleich gar (philosophisch
öfters ‚übersehen‘) zeitliche, bestehen, lässt sich – als modale
Bedingung/en der Möglichkeit/en (etwa von רוח
bis רקע)
– kaum wegdenken, ohne resch-quf-ajin ר־ק־ע /reka/ das
jeweilige ‚Firmament‘ zu vergessen / ‚übersehen‘, bis zu verlieren / bestreiten
/ verabsolutieren. Der Verrat am pantheistischen Ideal ‚des ausdehnungslos,
ganz ungeteilt nur bei sich selbst befindlichen Punktes‘ wird topologisch noch
übertroffen: etwa von (‚flachländischen‘)
Schrecken mehrdimensionaler nichteuklidischer Geometrie (wie gekrümmter Direktheit/en oder ontagonal
erscheinender Parallelitäten pp.).
Dass Abstände / Umgebungen / Zusammenhänge,
zumal räumliche und\aber gleich gar (philosophisch
öfters ‚übersehen‘) zeitliche, bestehen, lässt sich – als modale
Bedingung/en der Möglichkeit/en (etwa von רוח
bis רקע)
– kaum wegdenken, ohne resch-quf-ajin ר־ק־ע /reka/ das
jeweilige ‚Firmament‘ zu vergessen / ‚übersehen‘, bis zu verlieren / bestreiten
/ verabsolutieren. Der Verrat am pantheistischen Ideal ‚des ausdehnungslos,
ganz ungeteilt nur bei sich selbst befindlichen Punktes‘ wird topologisch noch
übertroffen: etwa von (‚flachländischen‘)
Schrecken mehrdimensionaler nichteuklidischer Geometrie (wie gekrümmter Direktheit/en oder ontagonal
erscheinender Parallelitäten pp.).
 [Repräsentationen versus Repräsentiertes bis
Lückenmanagement, gar vom sprung des Denkens, bis zu
jenem der Tat]
[Repräsentationen versus Repräsentiertes bis
Lückenmanagement, gar vom sprung des Denkens, bis zu
jenem der Tat]
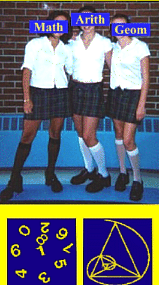
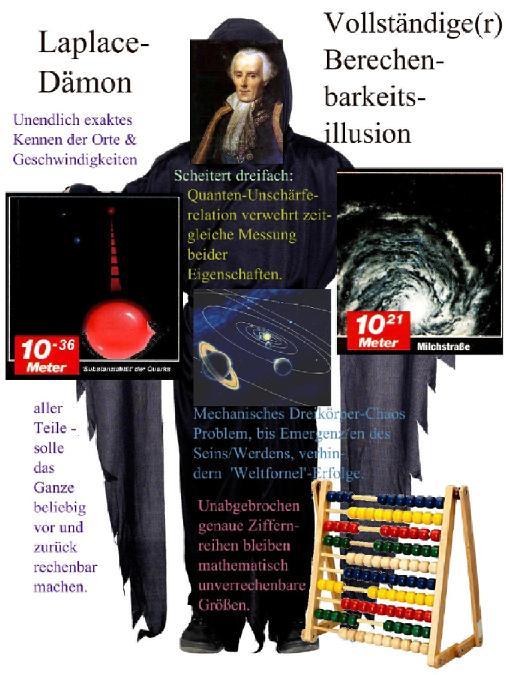 Zwar hat bereits ‚die Geisteswissenschaft
Mathematik‘ den ‚laplace‘schen Dämon vollständiger
Berechenbarkeit‘ auf(hinter)grund des ‚mechanischen Weltbildes‘ (mit dessen Überblicksillusionshöhepunkt schon im 19. Jahrhundert
erhofft / befürchtet) längst, auch als rechnerisch unmöglich /
untaugliche Beschreibung der Dinge, widerlegt, sowie durch (so peinlich erweiterte) Konzepte laplace‘scher Wahrscheinlichkeit/en zur (insbesondere vorhersehenden) Repräsentation
von Ereignissen ersetzt (dass – gleich gar der ‚Gelegenheitenfenster‘ bis ‚schicksalhaft‘-nennbare – Grenzenränder des
überhaupt qualifuziert Wissbaren erkennbar). –
Doch haben dies die wenigsten Leute überhaupt bemerkt, und gleich gar nicht
akzeptiert (oder gar ‚zwischen Null und Eins‘
anstatt ‚
Zwar hat bereits ‚die Geisteswissenschaft
Mathematik‘ den ‚laplace‘schen Dämon vollständiger
Berechenbarkeit‘ auf(hinter)grund des ‚mechanischen Weltbildes‘ (mit dessen Überblicksillusionshöhepunkt schon im 19. Jahrhundert
erhofft / befürchtet) längst, auch als rechnerisch unmöglich /
untaugliche Beschreibung der Dinge, widerlegt, sowie durch (so peinlich erweiterte) Konzepte laplace‘scher Wahrscheinlichkeit/en zur (insbesondere vorhersehenden) Repräsentation
von Ereignissen ersetzt (dass – gleich gar der ‚Gelegenheitenfenster‘ bis ‚schicksalhaft‘-nennbare – Grenzenränder des
überhaupt qualifuziert Wissbaren erkennbar). –
Doch haben dies die wenigsten Leute überhaupt bemerkt, und gleich gar nicht
akzeptiert (oder gar ‚zwischen Null und Eins‘
anstatt ‚entweder-oder‘ zu denken gelernt).
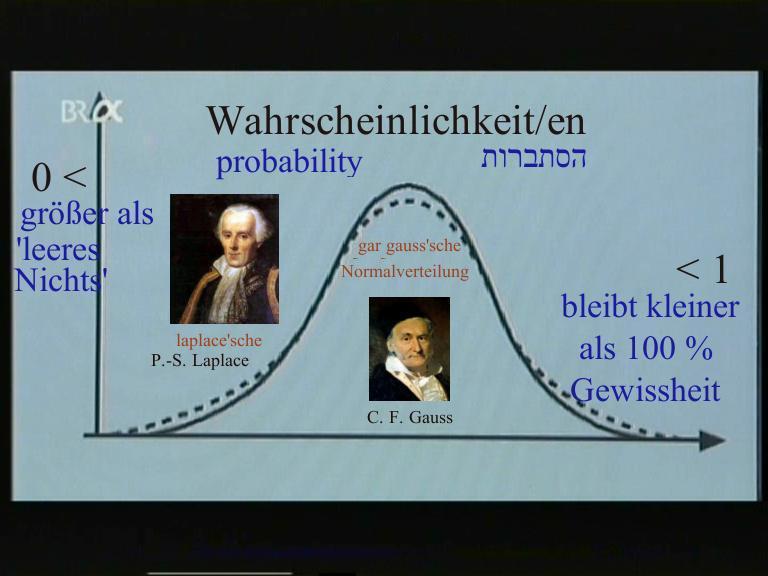
Eher noch weniger wirksam bekannt, dass/wie wissenschaft/en ‚aufhörten‘ / begrenzen zu fragen: ‚Was ist (beispielsweise) der Mensch?‘, da sie/sich darauf (ontologische Problemstellungen) keine (epistemologisch / wissenschaftstheoretisch/ methodisch) hinreichend zuverlässige (und noch wenige hinreichend vollständig umfassende)Antworten finden lassen, sehen sie sich auf die Fragen ‚Was können wir wie (hier gar vom Menschen) wissen?‘ bis immerhin jene ‚Was bedeutet wem, das Wort Mensch, wann?‘ verwiesen.
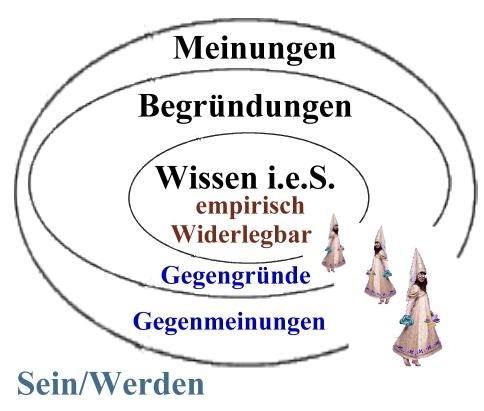 [Im/Zum Raum (des
Seienden und\aber des Werdenden) findet, wer will, ganz erhebliche
Mengen von/an Meinungen (nicht selten bereits
für ‚Wissen‘ gehalten), die Mathemati als eine
– zumal unendlich große – Menge (eben in diesem engeren Sinne)
veranschaulichend zeichnen darf. Bereits und immerhin in der griechischen
Antike war manchen (urkundlich belegt)
klar, dass ‚Wissen‘ nur aus jenem Teil der gigantisch vielen und teils
widersprüchlichen Meinungen folgen kann, die sowohl ernstlich (anstatt ‚launisch‘, oder gar ‚trügerisch‘)
gemeint sind, als auch hinreichend zutreffend / richtig verstanden werden (was mit dem Schlagwort ‚wahre Meinung‘ allenfalls
unzureichend beschreiben), sowie, dass dies für / zum ‚Wissen‘ nicht
genügt. Dazu bedürfe es der Einschränkung, das aus der Menge der ‚wahren
Meinungen‘ nur jene in Frage kommen, die auch begründet / begründbar. Jedoch
ahnte bereits Plato, dass auch die Teilmenge der ‚überzeugt behaupteten und
möglichst Gegengründe widerlegend plausibilisierten Meinungen‘ noch zu groß /
Falsches enthaltend und unzureichend ist. Seit dem / im 20. Jahrhundert hat H.
G. Gadamer gezeigt, dass ‚drittens‘ noch die Einschränkung auf jene Teilmenge
an (‚wahren und begründeten‘) Meinungen
hinzukommen muss, für die es überhaupt eine geeignete Möglichkeit gibt, sie in
/ an Realität/en zu überprüfen, um als ‚Wissen im engeren/eigentlichen Sinne‘
gelten zu können. – Was nicht darüber hinwegtäuschen muss, dass sich darunter /
darin eine ganze Menge bereits widerlegtes, bis noch zu wiederlegendes ‚Wissen‘
befindet; vgl. Falsifikationsprinzip (namentlich
mittels wissenschaftlichen Debatten und empirischen Gegenexperimenten). Zumal
seit das (spätestens von/bei
/kohelet/ warnend
konstatierte – gar exponenzielle) Wachstum zum
(im doppelten
Wortsinnen) ‚unübersehbaren‘
Umfang des verschriftlichen Meines, bis
nachlesbarer Kenntnisse, beiträgt, bedürfen wir Menschen der Wissenschaften,
zur/als entscheidenden Klärung
dieser – zu gerne ignoriten,
doch/da verhaltensfaktisch unausweichlich beantwortet werdenden – Qualitätsfrage]
[Im/Zum Raum (des
Seienden und\aber des Werdenden) findet, wer will, ganz erhebliche
Mengen von/an Meinungen (nicht selten bereits
für ‚Wissen‘ gehalten), die Mathemati als eine
– zumal unendlich große – Menge (eben in diesem engeren Sinne)
veranschaulichend zeichnen darf. Bereits und immerhin in der griechischen
Antike war manchen (urkundlich belegt)
klar, dass ‚Wissen‘ nur aus jenem Teil der gigantisch vielen und teils
widersprüchlichen Meinungen folgen kann, die sowohl ernstlich (anstatt ‚launisch‘, oder gar ‚trügerisch‘)
gemeint sind, als auch hinreichend zutreffend / richtig verstanden werden (was mit dem Schlagwort ‚wahre Meinung‘ allenfalls
unzureichend beschreiben), sowie, dass dies für / zum ‚Wissen‘ nicht
genügt. Dazu bedürfe es der Einschränkung, das aus der Menge der ‚wahren
Meinungen‘ nur jene in Frage kommen, die auch begründet / begründbar. Jedoch
ahnte bereits Plato, dass auch die Teilmenge der ‚überzeugt behaupteten und
möglichst Gegengründe widerlegend plausibilisierten Meinungen‘ noch zu groß /
Falsches enthaltend und unzureichend ist. Seit dem / im 20. Jahrhundert hat H.
G. Gadamer gezeigt, dass ‚drittens‘ noch die Einschränkung auf jene Teilmenge
an (‚wahren und begründeten‘) Meinungen
hinzukommen muss, für die es überhaupt eine geeignete Möglichkeit gibt, sie in
/ an Realität/en zu überprüfen, um als ‚Wissen im engeren/eigentlichen Sinne‘
gelten zu können. – Was nicht darüber hinwegtäuschen muss, dass sich darunter /
darin eine ganze Menge bereits widerlegtes, bis noch zu wiederlegendes ‚Wissen‘
befindet; vgl. Falsifikationsprinzip (namentlich
mittels wissenschaftlichen Debatten und empirischen Gegenexperimenten). Zumal
seit das (spätestens von/bei
/kohelet/ warnend
konstatierte – gar exponenzielle) Wachstum zum
(im doppelten
Wortsinnen) ‚unübersehbaren‘
Umfang des verschriftlichen Meines, bis
nachlesbarer Kenntnisse, beiträgt, bedürfen wir Menschen der Wissenschaften,
zur/als entscheidenden Klärung
dieser – zu gerne ignoriten,
doch/da verhaltensfaktisch unausweichlich beantwortet werdenden – Qualitätsfrage] 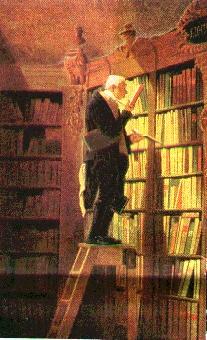
 Stufen(leiter) der schließloch wissenschaftlichen
Erfahrungshandhabungen (weitgehend mit Lord Ralf
Gustav Dahrendorf – Ein ‚schelmischer Narr‘ wer etwas ‚arges‘ dabei denkt):
Stufen(leiter) der schließloch wissenschaftlichen
Erfahrungshandhabungen (weitgehend mit Lord Ralf
Gustav Dahrendorf – Ein ‚schelmischer Narr‘ wer etwas ‚arges‘ dabei denkt):
![]() Für (zumal
„literarische) Dignität“, also ‚die Fülle/n und Farbigkeit/en von Dingen
und Ereignissen bzw. Personen‘ ist nötig: alles überhaut Beobachtbare zu
beobachten (dies ‚eigentlich‘ nicht nur
unterstellend zu behaupten / vermeinen) – erfolgt mittels Primäererfahrungen (wobei
und wozu gerade jene des / der einzelnen nicht genügt).
Für (zumal
„literarische) Dignität“, also ‚die Fülle/n und Farbigkeit/en von Dingen
und Ereignissen bzw. Personen‘ ist nötig: alles überhaut Beobachtbare zu
beobachten (dies ‚eigentlich‘ nicht nur
unterstellend zu behaupten / vermeinen) – erfolgt mittels Primäererfahrungen (wobei
und wozu gerade jene des / der einzelnen nicht genügt). 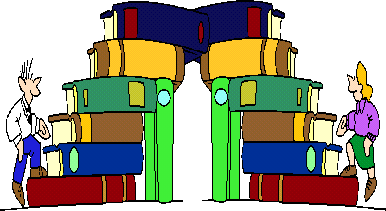
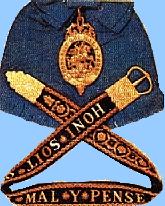 Alle Perspektiven (alle
– verfügbaren und, nicht allein / immerhin prinzipiell, offen für neue / andere
bleibend – Primärerfahrungen) zu einem (sekundären
Erfahrungs-)Ergebnis/Ereignis erhoben. und durchaus um Wiederholungen / Häufigleiten (gar als/zu
deren Wahrscheinlichkeiten) reduzieren, verlangt bereits
wissenschaftlich auswählendes und gewichtendes (gar
talentiertes und mühsames) Vorgehen – gleich gar was experimentelle (Gegen-)Beweise unter möglichst kontrollierten
Bedingungen angeht.
Alle Perspektiven (alle
– verfügbaren und, nicht allein / immerhin prinzipiell, offen für neue / andere
bleibend – Primärerfahrungen) zu einem (sekundären
Erfahrungs-)Ergebnis/Ereignis erhoben. und durchaus um Wiederholungen / Häufigleiten (gar als/zu
deren Wahrscheinlichkeiten) reduzieren, verlangt bereits
wissenschaftlich auswählendes und gewichtendes (gar
talentiertes und mühsames) Vorgehen – gleich gar was experimentelle (Gegen-)Beweise unter möglichst kontrollierten
Bedingungen angeht. 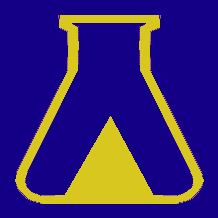
 Nicht mehr auf Einzelereignisse bezogen,
sondern auf allgemeine und strukturelle Zusammenhänge beabsichtigt THEORETISCHE
ERFAHRUNG (theoretisches Modellieren) kein ‚Bild‘, keine ‚Beschreibung‘
oder gar ‚abbildende Darstellung‘ von Aspekten der Wirklichkeit (‚mehr‘) –
sondern bietet Erkenntnis im Hinblick auf gedachte Notwendigkeit (= THEORIE):
Nicht mehr auf Einzelereignisse bezogen,
sondern auf allgemeine und strukturelle Zusammenhänge beabsichtigt THEORETISCHE
ERFAHRUNG (theoretisches Modellieren) kein ‚Bild‘, keine ‚Beschreibung‘
oder gar ‚abbildende Darstellung‘ von Aspekten der Wirklichkeit (‚mehr‘) –
sondern bietet Erkenntnis im Hinblick auf gedachte Notwendigkeit (= THEORIE):  „Wenn wir versuchen unsere Erfahrung/en als (wahrscheinlich/hoffentlich) eben ‚für
notwendigerweise gerade so wie anscheinend (bis
immerhin intersubjektiv konsensfähig)
gemacht, bis zumal wiederholbar‘-gehalten zu verstehen, bis zu erklären, so hat
es den Anschein, dass …“ mit/als diese/r (so,
gar zu selten bemerkten, eingestandenen und gar nicht immer umfassend
berücksichtigten) Einschränkung beginnt jede (eben auch alltägliche, bis
unwissenschaftliche – zudem eben nicht einmal immer so genannte / erkannte)
‚Theorie‘ / Realitätenhandhabungsweisenvorgabe
überhaupt (eben gerade auch – sich selbst
gegenüber – unausformulierte).
„Wenn wir versuchen unsere Erfahrung/en als (wahrscheinlich/hoffentlich) eben ‚für
notwendigerweise gerade so wie anscheinend (bis
immerhin intersubjektiv konsensfähig)
gemacht, bis zumal wiederholbar‘-gehalten zu verstehen, bis zu erklären, so hat
es den Anschein, dass …“ mit/als diese/r (so,
gar zu selten bemerkten, eingestandenen und gar nicht immer umfassend
berücksichtigten) Einschränkung beginnt jede (eben auch alltägliche, bis
unwissenschaftliche – zudem eben nicht einmal immer so genannte / erkannte)
‚Theorie‘ / Realitätenhandhabungsweisenvorgabe
überhaupt (eben gerade auch – sich selbst
gegenüber – unausformulierte). 
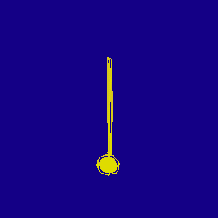 Doch resch-waw-chet ר־ו־ח bedeutet/repräsentiert
ja nicht allein /rewach/ ‚Raum‘ (gar ‚mehr‘ / abderes als
Universum) sondern bekanntlich auch /ruach/
‚Wind‘, die Möglichkeiten der Bewegungen, kinematischer Modalität,
zumal/zumindest darin (diesbezüglich durchaus
zutreffend mit einem Teilbereich der Bedeutungshöfe von ‚Geist‘ übersetzbar verständlich).
Zudem von abendländischen Idealvorstellungen der (allenfalls
trägen) Ruhe-Masse (auch ‚[mikro]kosmisch bis zum unbewegten Erstbeweger[-Uhwerk] b ei 0 K[elvin]
überzogen) verfälscht. Womit sich (uns) Problem bis Fragen der
(minimalen wie maximalen) Geschwindigleiten und iher Konstanzen/Änderungen
stellen (namentlich jener ‚des Lichts‘, respektive deren Messung).
Beeindruckend auch, das/wo Thermodynamik, die Zunahme von Entropie /
‚Unordnung‘ bis ‚des Zerfalls‘ gar nicht die einzige Möglichkeit(keineswegs nur in deren ‚Hauptsätzen‘ gedacht werden
kann/muss).
Doch resch-waw-chet ר־ו־ח bedeutet/repräsentiert
ja nicht allein /rewach/ ‚Raum‘ (gar ‚mehr‘ / abderes als
Universum) sondern bekanntlich auch /ruach/
‚Wind‘, die Möglichkeiten der Bewegungen, kinematischer Modalität,
zumal/zumindest darin (diesbezüglich durchaus
zutreffend mit einem Teilbereich der Bedeutungshöfe von ‚Geist‘ übersetzbar verständlich).
Zudem von abendländischen Idealvorstellungen der (allenfalls
trägen) Ruhe-Masse (auch ‚[mikro]kosmisch bis zum unbewegten Erstbeweger[-Uhwerk] b ei 0 K[elvin]
überzogen) verfälscht. Womit sich (uns) Problem bis Fragen der
(minimalen wie maximalen) Geschwindigleiten und iher Konstanzen/Änderungen
stellen (namentlich jener ‚des Lichts‘, respektive deren Messung).
Beeindruckend auch, das/wo Thermodynamik, die Zunahme von Entropie /
‚Unordnung‘ bis ‚des Zerfalls‘ gar nicht die einzige Möglichkeit(keineswegs nur in deren ‚Hauptsätzen‘ gedacht werden
kann/muss).
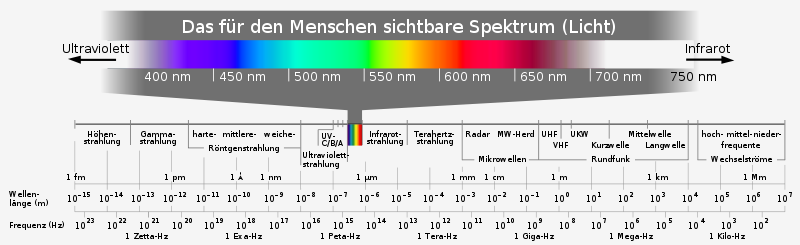 ?
[Elektromagnetisches Strahlungsspektrum ein bekannter, wichtiger Teil des
Rauschens überhaupt: Von einer der kurzwelligsten und damit energiereichsten,
wie der Gammastrahlung, mit Wellenlängen im Bereich von Atomkerndurchmesseren,
bis zu kilometerlangen, niederschwingenden
Funkwellen, technologisch zugängliche/genutzte zumindest Bewegungen (bis gar auch Teilchen). – Spätestens seit/mit
Werner Heisenberg ist zudem die Unschärferelation des Messbaren formuliert, dass
im atomaren, bis subatomaren, Nanobereich nur entwerder
die Geschwindigkeit oder aber der Aufenthaltsort eines/der ‚Teilchen/s‘ hinreichend genau bestimmbar werden, also nur
Aufenthaltswahrscheinlichkeitswolken, namentlich von Elektron/en bestimmbar sind.
Alphahoch minus eins = 137(,000….) how little we know]
?
[Elektromagnetisches Strahlungsspektrum ein bekannter, wichtiger Teil des
Rauschens überhaupt: Von einer der kurzwelligsten und damit energiereichsten,
wie der Gammastrahlung, mit Wellenlängen im Bereich von Atomkerndurchmesseren,
bis zu kilometerlangen, niederschwingenden
Funkwellen, technologisch zugängliche/genutzte zumindest Bewegungen (bis gar auch Teilchen). – Spätestens seit/mit
Werner Heisenberg ist zudem die Unschärferelation des Messbaren formuliert, dass
im atomaren, bis subatomaren, Nanobereich nur entwerder
die Geschwindigkeit oder aber der Aufenthaltsort eines/der ‚Teilchen/s‘ hinreichend genau bestimmbar werden, also nur
Aufenthaltswahrscheinlichkeitswolken, namentlich von Elektron/en bestimmbar sind.
Alphahoch minus eins = 137(,000….) how little we know]
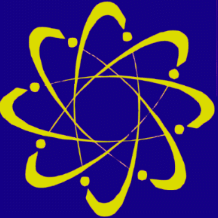 Auch die – häufig ‚stofflich‘ reduzierte
und ‚substanziell/materiell‘ wider ‚Formen‘ oder ‚Geist‘ ausspielbare – physikalische
Modalität wird nur zu gerne als verzichtbar, bis zu überwinden/besiegen,
missdeutet, wohl da Menschen auch solche Aspekte teils (zumal reproduzierbar) zu beeinflussen vermögen. Weises, über
buntes, bis schwarzes Rauschen, namentlich als vier (temperaturkorrelierte – ‚gasförmig‘, ‚flüssig‘, ‚fest‘ oder ‚plasmatisch‘) Aggregatzustände (teils des Selben – meist molekularen, – Verbundes von
Atomen) bekannt. Bereits durchaus beeindruckend, was Entdeckungen eines
Ordnungsschemas chemischer Eigenschaften von Reinstoffen (‚PSE – Periodensystem der Elemente‘ genannt),
zum Nachweis noch unbekannter, der uns inzwischen über einhundert bekannten
‚natürlich vorkommenden‘ (in ‚Labor und Technik‘
noch einige mehr) verschiedenen Atomarten beitragen: gar eher noch
erstaunlicher, dass und wie quantenphysiklaische
Einsichten, viele dieser Eigenschaften erklären bis ausnützen können.
Vielleicht fällt sogar auf, wie nach/mit
der Entdeckung, dass (doch/überhaupt)
elementare Atome (vorhanden, und diese
schließlich) gar nicht unteilbar, ein, der physiklaische,
‚Element/ar‘-Begriff verschoben, bis seinerseits
weiter vermehrt, wurde (eben und allerdings ohne
solche Ausdrücke aus anderen Zusammenhängen, bis ‚Bezugssystemen‘, zu entfernen
oder diskreditieren zu dürfen). So richtig explosionsartik
wächsrm der Vielfalten Vielzahlen bekanntlich
zumindest in der quasi ‚Gegenrichtung‘ möglicher molakularer
Verbindungen unterschiedlicher atome zu aus deren
jeweiligen Eigenschaften zusammengenommen, allein ebenfalls nicht vollständig
zu erklärenden (emergenten)
Verwendungsmöglichkeiten an. Auch diese Wissenschaft(en) befasst(/beschäftigen)
sich mit Bereichen, wo der (mit/als ‚gesund‘ ja
kaum zureichend fair beschriebene) ‚mezzo-kosmisch‘/lokal
orientiert, erfahrene Menschenverstand ins Trudeln gerät: Etwa weil Atome
‚leichter‘ (masseärmer) sind als
die Summe ihrer getrennten Teilchenmassen – Bindungsenergie zu- respektive
abgegeben werden. Oder sich mache ‚Felder‘ gar nicht messen, nur in ihren
Auswirkungswellen beobachten lassen, so dass zumal Lichtwellen paradoxerweise
Schwingungen / Rauschen von Nichts zu sein scheinen (jedenfalls von nichts Messbarem). Wobei ja spätestens das Buch,
mit/von einem Roman oder Gedanken (na klar,
mechanischer – der ‚Dynamik‘ äh ‚Statik‘), nicht allein physikalisch vorfindlicher Stoff, und kaum
ernsthaft bestritten (auch nichtatomarer) Gegenstand.
Auch die – häufig ‚stofflich‘ reduzierte
und ‚substanziell/materiell‘ wider ‚Formen‘ oder ‚Geist‘ ausspielbare – physikalische
Modalität wird nur zu gerne als verzichtbar, bis zu überwinden/besiegen,
missdeutet, wohl da Menschen auch solche Aspekte teils (zumal reproduzierbar) zu beeinflussen vermögen. Weises, über
buntes, bis schwarzes Rauschen, namentlich als vier (temperaturkorrelierte – ‚gasförmig‘, ‚flüssig‘, ‚fest‘ oder ‚plasmatisch‘) Aggregatzustände (teils des Selben – meist molekularen, – Verbundes von
Atomen) bekannt. Bereits durchaus beeindruckend, was Entdeckungen eines
Ordnungsschemas chemischer Eigenschaften von Reinstoffen (‚PSE – Periodensystem der Elemente‘ genannt),
zum Nachweis noch unbekannter, der uns inzwischen über einhundert bekannten
‚natürlich vorkommenden‘ (in ‚Labor und Technik‘
noch einige mehr) verschiedenen Atomarten beitragen: gar eher noch
erstaunlicher, dass und wie quantenphysiklaische
Einsichten, viele dieser Eigenschaften erklären bis ausnützen können.
Vielleicht fällt sogar auf, wie nach/mit
der Entdeckung, dass (doch/überhaupt)
elementare Atome (vorhanden, und diese
schließlich) gar nicht unteilbar, ein, der physiklaische,
‚Element/ar‘-Begriff verschoben, bis seinerseits
weiter vermehrt, wurde (eben und allerdings ohne
solche Ausdrücke aus anderen Zusammenhängen, bis ‚Bezugssystemen‘, zu entfernen
oder diskreditieren zu dürfen). So richtig explosionsartik
wächsrm der Vielfalten Vielzahlen bekanntlich
zumindest in der quasi ‚Gegenrichtung‘ möglicher molakularer
Verbindungen unterschiedlicher atome zu aus deren
jeweiligen Eigenschaften zusammengenommen, allein ebenfalls nicht vollständig
zu erklärenden (emergenten)
Verwendungsmöglichkeiten an. Auch diese Wissenschaft(en) befasst(/beschäftigen)
sich mit Bereichen, wo der (mit/als ‚gesund‘ ja
kaum zureichend fair beschriebene) ‚mezzo-kosmisch‘/lokal
orientiert, erfahrene Menschenverstand ins Trudeln gerät: Etwa weil Atome
‚leichter‘ (masseärmer) sind als
die Summe ihrer getrennten Teilchenmassen – Bindungsenergie zu- respektive
abgegeben werden. Oder sich mache ‚Felder‘ gar nicht messen, nur in ihren
Auswirkungswellen beobachten lassen, so dass zumal Lichtwellen paradoxerweise
Schwingungen / Rauschen von Nichts zu sein scheinen (jedenfalls von nichts Messbarem). Wobei ja spätestens das Buch,
mit/von einem Roman oder Gedanken (na klar,
mechanischer – der ‚Dynamik‘ äh ‚Statik‘), nicht allein physikalisch vorfindlicher Stoff, und kaum
ernsthaft bestritten (auch nichtatomarer) Gegenstand.
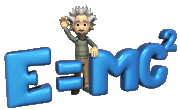 [Was Materie, wissen wir ebenso wenig wie was
deren immerhin physikalisches Äquivalent Energie, ist1 (Gleich gar nicht
‚so etwas wie Sand, nur sehr viel feiner‘ was zu viele gebildte
Leute vermeinen.) Dass es sich dabei um Gegner, Voraussetzung und/oder
Folge welches wie auch immer verstandenen/verwendeten ‚Geistes‘ handele, hat Menschenheit
immerhin erhebliche (zumal erkenntnistheoretisch
gar unnötige) Schwierigkeiten eingebracht – wo / falls / da beobachtende
Aktionszentren jenem Empirischen ‚gegenüberstehen‘ /ezer kenegdo/ עזר כנגדו den sie / ‚diese
durchaus Mächte‘ wechselwirkend (zumindest
teilweise) durchaus zugehören. – Zumal / So dass gerade auch die Physik
nicht als einzige Forschungsdisziplin allgemeingültige Aussagen etwa über/mit
‚Strahlung‘, ‚Wellen‘, ‚Teilbarkeit‘ äh ‚Atome‘, ‚Energie‘, ‚Druck‘, ‚Materie‘, ‚Massen‘,
‚Kräften‘, ‚Impuls‘, ‚Temperatur‘, ‚Ladung‘, ‚Spannungen‘, ‚Reibung‘,
‚Widerstand‘, ‚Potenziale‘, ‚Strom‘, ‚Felder‘ und/oder ‚‘Wechselwirkungen‘ pp.
machen kann & darf, da diese auch zu ‚ihren Grundbegriffen‘ gehören mögen –
gleich gar nicht und nicht einmal was damit bezeichnete, bis modellierbare,
‚Natur‘ (oderder gemeinten
Dinge und Ereignisse ‚natürlich‘ genanntes Vorkommen) angeht]
[Was Materie, wissen wir ebenso wenig wie was
deren immerhin physikalisches Äquivalent Energie, ist1 (Gleich gar nicht
‚so etwas wie Sand, nur sehr viel feiner‘ was zu viele gebildte
Leute vermeinen.) Dass es sich dabei um Gegner, Voraussetzung und/oder
Folge welches wie auch immer verstandenen/verwendeten ‚Geistes‘ handele, hat Menschenheit
immerhin erhebliche (zumal erkenntnistheoretisch
gar unnötige) Schwierigkeiten eingebracht – wo / falls / da beobachtende
Aktionszentren jenem Empirischen ‚gegenüberstehen‘ /ezer kenegdo/ עזר כנגדו den sie / ‚diese
durchaus Mächte‘ wechselwirkend (zumindest
teilweise) durchaus zugehören. – Zumal / So dass gerade auch die Physik
nicht als einzige Forschungsdisziplin allgemeingültige Aussagen etwa über/mit
‚Strahlung‘, ‚Wellen‘, ‚Teilbarkeit‘ äh ‚Atome‘, ‚Energie‘, ‚Druck‘, ‚Materie‘, ‚Massen‘,
‚Kräften‘, ‚Impuls‘, ‚Temperatur‘, ‚Ladung‘, ‚Spannungen‘, ‚Reibung‘,
‚Widerstand‘, ‚Potenziale‘, ‚Strom‘, ‚Felder‘ und/oder ‚‘Wechselwirkungen‘ pp.
machen kann & darf, da diese auch zu ‚ihren Grundbegriffen‘ gehören mögen –
gleich gar nicht und nicht einmal was damit bezeichnete, bis modellierbare,
‚Natur‘ (oderder gemeinten
Dinge und Ereignisse ‚natürlich‘ genanntes Vorkommen) angeht]
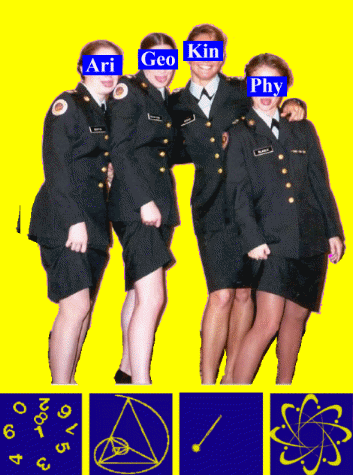 Griechischen Denkens Vorstellungskonzept von/der ‚Physis‘ also ‚Natur‘ (wieweit auch immer es Mathematik einbeziehen,
respektive zur Beschreibung, Repräsentation oder ‚Teleologie‘/Zielvorgabe
verwenden, mag) kommt zwar nicht raumlos aus, gesteht sich/anderen
diesbezügliches Unwissen allerdings selten (und
gleich gar nicht immer hinreichend) ein. …
Griechischen Denkens Vorstellungskonzept von/der ‚Physis‘ also ‚Natur‘ (wieweit auch immer es Mathematik einbeziehen,
respektive zur Beschreibung, Repräsentation oder ‚Teleologie‘/Zielvorgabe
verwenden, mag) kommt zwar nicht raumlos aus, gesteht sich/anderen
diesbezügliches Unwissen allerdings selten (und
gleich gar nicht immer hinreichend) ein. …
Die sogenannten
‚Naturgesetze‘ sind gar nicht jene der Natur, sondern (mehr oder minder
wahrscheinlich – also längst nicht ausnahmslos immer) reproduzierbare
Regelmäßigkeiten, die der Menschliche Verand in/an
dem entdeckte was wir ‚Natur‘ nennen. Die Geheimnisse der ‚Natur‘ werden wir
wohl nie verstehen. Auch daher ist die Gescichte der
Naturwissenschaft hautsächlich eine ihrer Irrtümer und deren (immerhin und soweit bereits bemerkten)
Selbstkorrekturen (wenn auch zumeist andere
Forschende, gar einer spätern Generation). Die
Lehren, bis medial hyperrealen Überzeugungen, ‚die Geheimnisse ![]() der Natur sein (demnächst)
vollständig entschlüsselt‘ oder ‚der Mensch sei ein verbesserungsfähiger
/ verbesserungsbedürftiger Computer‘ pp.
entspringen mancher Mischung aus Hybris/Größenwahn menschlichem
Leichtsinn. –
der Natur sein (demnächst)
vollständig entschlüsselt‘ oder ‚der Mensch sei ein verbesserungsfähiger
/ verbesserungsbedürftiger Computer‘ pp.
entspringen mancher Mischung aus Hybris/Größenwahn menschlichem
Leichtsinn. – ![]() Vielleicht erklärt uns stattdessen irgendwann
einmal ‚eben die Professoressa‘
(bekanntlich findet diese Begrifflichkeit im Italjenischen bei sämtlichen ‚Schularten‘ Verwendung),
welche die Theorie/n und ihre (technologischen bis politologischen) Anwendungen vorstellt/e – nicht erst manch Promovierenden – wo diese (bereits bekanntermaßen) wann (gar auch ‚warum‘ – so gibt es z.B. ökonomische Fälle
in denen sich zwar Richtungen mehrerer gegenläufiger Effekte vorhersagen, deren
tatsächlich resultierende Größen sich aber nur nachträglich, wenn die Folgen
der wirtschaftspolitischen Massnahme bereits
eingetreten, messen lassen) nicht ‚funktionieren‘.
Vielleicht erklärt uns stattdessen irgendwann
einmal ‚eben die Professoressa‘
(bekanntlich findet diese Begrifflichkeit im Italjenischen bei sämtlichen ‚Schularten‘ Verwendung),
welche die Theorie/n und ihre (technologischen bis politologischen) Anwendungen vorstellt/e – nicht erst manch Promovierenden – wo diese (bereits bekanntermaßen) wann (gar auch ‚warum‘ – so gibt es z.B. ökonomische Fälle
in denen sich zwar Richtungen mehrerer gegenläufiger Effekte vorhersagen, deren
tatsächlich resultierende Größen sich aber nur nachträglich, wenn die Folgen
der wirtschaftspolitischen Massnahme bereits
eingetreten, messen lassen) nicht ‚funktionieren‘.
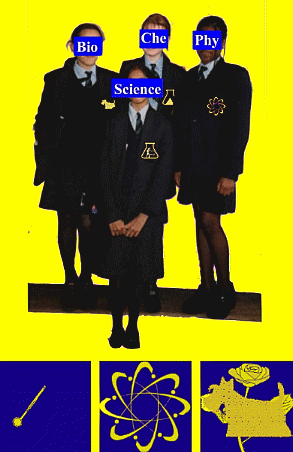 [Gar eher noch wesentlicher am und für das
Verhältnis von Natur und Kultur / Zivilisation(skrankheiten), sind/werden allerdings wertend dichotomisierende, bis konfrontativ( summenverteilungsparadigmatisch)e entweder-oder
Forder- äh
Vorstellungen, die (zumal idealisierend)
über die engen Verflochtenheiten und Untrennbarkeiten hinwegtäuschen s/wollen]
[Gar eher noch wesentlicher am und für das
Verhältnis von Natur und Kultur / Zivilisation(skrankheiten), sind/werden allerdings wertend dichotomisierende, bis konfrontativ( summenverteilungsparadigmatisch)e entweder-oder
Forder- äh
Vorstellungen, die (zumal idealisierend)
über die engen Verflochtenheiten und Untrennbarkeiten hinwegtäuschen s/wollen] 
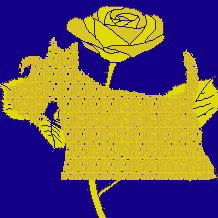 Dass
Systematisieren – mittels vereindeutigender (lateinisch erscheinender)
Begrifflichkeiten (immer wieder werden ‚Arten‘
entdeckt, die noch nicht beschrieben/bekannt sind) – findet in Botanik
und Zoologie einen seiner Höhepunkte an Komplexitätsreduzierungen der
Vielfalten Vielzahlen des Vorfindlichen auf fünf naturwissenschaftlich
erforderlichen / axiomatischen Definitionsmerkmalen für/von ‚Leben‘: Reiz- bzw.
Affizierbarkeiten; Stoffwechselvorgänge (zumal
Atmung und Verdauung); Bewegungsfähigkeiten von sich aus;
Wachstumsprozesse und insbesondere Fortpflanzungsfähigkeiten. Doch paradoxerweise besonders erstaunlich / unwahrscheinlich, dass
überhaupt Leben existiert.
Dass
Systematisieren – mittels vereindeutigender (lateinisch erscheinender)
Begrifflichkeiten (immer wieder werden ‚Arten‘
entdeckt, die noch nicht beschrieben/bekannt sind) – findet in Botanik
und Zoologie einen seiner Höhepunkte an Komplexitätsreduzierungen der
Vielfalten Vielzahlen des Vorfindlichen auf fünf naturwissenschaftlich
erforderlichen / axiomatischen Definitionsmerkmalen für/von ‚Leben‘: Reiz- bzw.
Affizierbarkeiten; Stoffwechselvorgänge (zumal
Atmung und Verdauung); Bewegungsfähigkeiten von sich aus;
Wachstumsprozesse und insbesondere Fortpflanzungsfähigkeiten. Doch paradoxerweise besonders erstaunlich / unwahrscheinlich, dass
überhaupt Leben existiert.  [«‚Das Leben ist schön‘ – von ‚einfach‘
(bis ‚angenehm‘) war nicht die Rede»:
Nicht einmal die Metamorphose der Raupe in den Schmetterling ist verstanden
weil/wo das Hormon isoliert/bekannt, das ‚auslösend‘ dabei beteiligt,
jedenfalls anscheinend damit korreliert vorkommt. Oder jenes, das ihr ‚den
Frosch‘ als ‚Prinzen‘ … Sie wissen schon. – Gerade die Biologie ist keineswegs die
einzige יחיד /jaxid/ Einzelwissenschaft, die alleine gültige
Wahrheitsaussagen über das Leben machen (oder
auch ‚nur‘ wesentliche Fragen / Probleme von und zu ‚im Herbst braun werdenden
Blättern‘ stellen) kann, darf oder muss]
[«‚Das Leben ist schön‘ – von ‚einfach‘
(bis ‚angenehm‘) war nicht die Rede»:
Nicht einmal die Metamorphose der Raupe in den Schmetterling ist verstanden
weil/wo das Hormon isoliert/bekannt, das ‚auslösend‘ dabei beteiligt,
jedenfalls anscheinend damit korreliert vorkommt. Oder jenes, das ihr ‚den
Frosch‘ als ‚Prinzen‘ … Sie wissen schon. – Gerade die Biologie ist keineswegs die
einzige יחיד /jaxid/ Einzelwissenschaft, die alleine gültige
Wahrheitsaussagen über das Leben machen (oder
auch ‚nur‘ wesentliche Fragen / Probleme von und zu ‚im Herbst braun werdenden
Blättern‘ stellen) kann, darf oder muss]
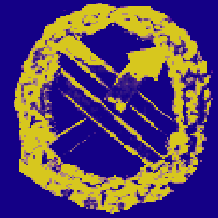 Zwar weiter umstritten wer/was sich. gar als ‚ich‘, zu empfinden vermag (zumal so manche ‚Spiegelbildtests‘ – gleich gar an
Wirbeltieren – eher Intelligenzen messen/abbilden mögen), gilt
spätestens derartige ‚Bewusstheit‘ (auch ‚vor-
oder postsprachlich‘ genannten Zuständen kaum völlig abgesprochen) als
hinreichend für ein Subjekt, bis gar Individualität/en. Der griechische Name
der ‚psychischen‘ Modalität, insbesondere wegen dessen ‚Leichtigkeit‘, bis eher
Flüchtigkeit / ‚Funkenartigkeit‘ und schreckhafter Scheu/en, von der
Bezeichnung für einen ‚zerbrechlichen Schmetterling‘ abgeleitet und mit
‚Seele‘, als ‚etwas‘ vom Belebten / Lebendigen verschiedenes, nämlich zumal
Unsterbliches (gar vorgeblich ‚im Materiellen
gefangen Gehaltenes‘ wie Gnostiker lehren/vermeinen), gleichgesetzt (wogegen
etwa die hebräischen Begrifflichkeiten für ‚beides‘ alle immer immer beides mitabdecken).
Zwar weiter umstritten wer/was sich. gar als ‚ich‘, zu empfinden vermag (zumal so manche ‚Spiegelbildtests‘ – gleich gar an
Wirbeltieren – eher Intelligenzen messen/abbilden mögen), gilt
spätestens derartige ‚Bewusstheit‘ (auch ‚vor-
oder postsprachlich‘ genannten Zuständen kaum völlig abgesprochen) als
hinreichend für ein Subjekt, bis gar Individualität/en. Der griechische Name
der ‚psychischen‘ Modalität, insbesondere wegen dessen ‚Leichtigkeit‘, bis eher
Flüchtigkeit / ‚Funkenartigkeit‘ und schreckhafter Scheu/en, von der
Bezeichnung für einen ‚zerbrechlichen Schmetterling‘ abgeleitet und mit
‚Seele‘, als ‚etwas‘ vom Belebten / Lebendigen verschiedenes, nämlich zumal
Unsterbliches (gar vorgeblich ‚im Materiellen
gefangen Gehaltenes‘ wie Gnostiker lehren/vermeinen), gleichgesetzt (wogegen
etwa die hebräischen Begrifflichkeiten für ‚beides‘ alle immer immer beides mitabdecken).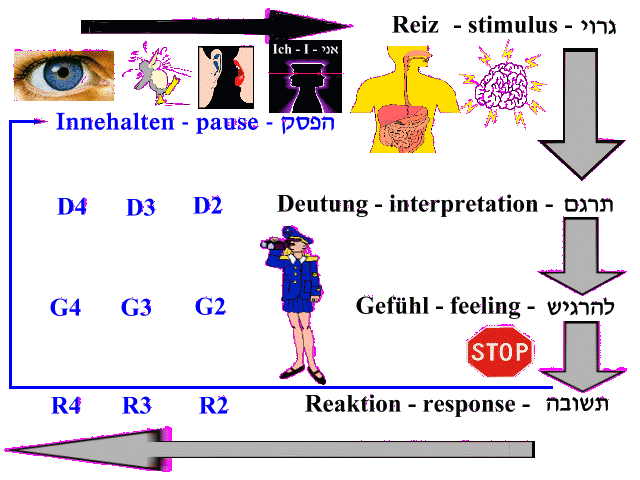 [Zu den basalsten
Irrtümern (des [skinerschenreinen]
Behaviorismus) gehört, dass jeder
(innere oder äußere) Reiz (auch) beim Menschen ein bestimmtes
dementsprechendes Gefühl (als solche/s ja
durchaus wesentliche Lebensäußerung) hervorrufe. Dass dazwischen
Deutungen erfolgen, die zudem keineswegs alternativlos sind,
ignorieren/bestreiten viele Leute. Eher noch weniger haben die Gelassenheit
entdeckt, bis erlernt, sich ‚an solchen Stopp-Stellen, zumal wohlwollend (anstatt;
‚
[Zu den basalsten
Irrtümern (des [skinerschenreinen]
Behaviorismus) gehört, dass jeder
(innere oder äußere) Reiz (auch) beim Menschen ein bestimmtes
dementsprechendes Gefühl (als solche/s ja
durchaus wesentliche Lebensäußerung) hervorrufe. Dass dazwischen
Deutungen erfolgen, die zudem keineswegs alternativlos sind,
ignorieren/bestreiten viele Leute. Eher noch weniger haben die Gelassenheit
entdeckt, bis erlernt, sich ‚an solchen Stopp-Stellen, zumal wohlwollend (anstatt;
‚distanz- und kritiklos‘), selbstbeobachtend auf ihre ‚innere
Gartenbank zu setzen‘ um – zumal mit zunehmender
Übung / Kontemplation, gar in ‚äußerlichen‘ Sekundenbruchteilen –
treffsicher zu entscheiden/wählen welche Deutungen (mit,
gar individuell, ‚demensprechend‘ aufkommenden Gefühlen) sie haben, bis
welche Reaktionen sie zeigen, können und wollen. – nicht einmal jede
Affektkontrolle / Höflichkeit ist gleich unaufrichtig trügerische /
erzieherisch-zivilisatorisch unaufrichtige, wiedernatürliche Reserviertheit /
Vorbehaltsdistanz. – Schwierigkeiten die uns abendländische
Singularitätsvorstellungen als Gleichheiterwartungen einbringen lassen sich
zudem spätestens hier an den geradezu klassisch (mindestens
– zumal asiatisch eher nocht weitaus mehr)
viererlei charakterlichen bis Persönlichkeitstypologien erahnen lassen, die gar
noch selten(er als geschlechtsspezifische)
in reinen Ausschließlichkeiten auftreten – sonderen in ihren diversen Mischungsverhältnissen geradezu
individuell sein/werden können. Ned Herrmanns Analogie-Modell nimmt z.B. die viereintelung der beiden Großhirnhälften plus das lymbische System der Anatomie / Neurologie als Anhalt / zur
Raumorientierung seiner vier ich-Aspekte, (gar
eher) von Menschen(, als ‚jedes
Gehirns‘)] 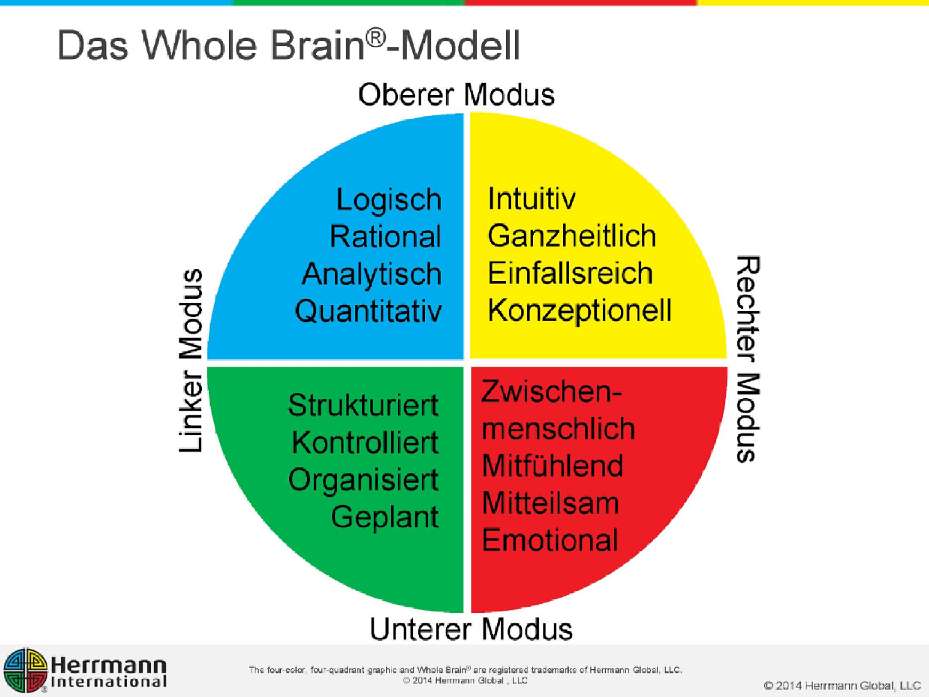
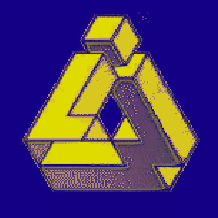 Die analytische Modalität beschränkt sich
nicht selbst / als solche (ja ohnehin kein
Singular) reduktionistisch, etwa auf chemische (metallurgische) oder gar biochemische
Zerlegungen in ‚reinstoffliche‘ Bestand- oder Bauteile (etwa Moleküle oder gar physikalisch [zumindest energie]aufwendiger
in Atome mit Isotopen, bis deren dennoch Teile). Spätestens hier
zeigen sich / erkennen wir (auch ‚materielle‘)
Phänomene der Emergenz darin/daran, dass ‚Ganzes‘ (nicht
etwa allein / ‚erst‘ geisteswissenschaftlich, oder nur in / als Einzahl)
andere Eigenschaften haben/bekommen können kann, als sich aus den Summen bzw.
Produkten der Einzelheiten ergeben. Auch müssen wir nicht darauf beschränkt
bleiben / werden, aus These und Antithese (äh
aus füt ‚natürlich‘-gehaltenen-Gegebenheiten) ‚die‘
/ eine Synthese zu machen, von der Negation der Negation zur Position pp. zu
gelangen. …
Die analytische Modalität beschränkt sich
nicht selbst / als solche (ja ohnehin kein
Singular) reduktionistisch, etwa auf chemische (metallurgische) oder gar biochemische
Zerlegungen in ‚reinstoffliche‘ Bestand- oder Bauteile (etwa Moleküle oder gar physikalisch [zumindest energie]aufwendiger
in Atome mit Isotopen, bis deren dennoch Teile). Spätestens hier
zeigen sich / erkennen wir (auch ‚materielle‘)
Phänomene der Emergenz darin/daran, dass ‚Ganzes‘ (nicht
etwa allein / ‚erst‘ geisteswissenschaftlich, oder nur in / als Einzahl)
andere Eigenschaften haben/bekommen können kann, als sich aus den Summen bzw.
Produkten der Einzelheiten ergeben. Auch müssen wir nicht darauf beschränkt
bleiben / werden, aus These und Antithese (äh
aus füt ‚natürlich‘-gehaltenen-Gegebenheiten) ‚die‘
/ eine Synthese zu machen, von der Negation der Negation zur Position pp. zu
gelangen. …
[Abb. Abby‘s
Major Massensektrimeter mit PSE] [Menschen
erweisen sich allzu meist (auch noch
Korrelationen, oder bloße Zeichen, für-ursächlich-haltend) als
Kausalitätsfanatiker (Aristoteles unterschied /
[‚sein Rasiermesser‘] bemerkte immerhin: Form-, Stoff-, Wirk- und
Zielursache – im Anschluss an Kants Weiterentwicklung immerhin prinzipiell zwölferlei basaler
Denkformen der/in Quantitäten [Einheit, Vielheit, Allheit], Qualitäten [Realität, Negation, Limitation],
Relationen [Inhärenz/Subsistenz, Kausalität/Dependenz, gemeinwesentlichen
Wechselwirkungen] und Modalitäten des Seins/Werdens [Möglichkeit? Existenz?
Notwendigkeit und/oder zufallende Kontingenz?] fassend/repräsentierend);
indoeuropäisch zudem / ‚inzwischen‘ unter / an ‚Morbus monokausalitis‘
(der [Suche nach
Zuweisung der] einen / einzigen
Wirkursächlichkeit) leidend. Dabei / Dagegen ist, bis wäre, die
Sichtweise mittels / in ‚Ursache/n und Wirkung/en‘ längst nicht die einzig
wirksame oder allein richtige; auch
‚Einfühlungsvermögen und Mitgefühl‘ funktionieren durchaus, und\aber ‚vermittels
der Sichtweisen (Vielfalten Vielzahlen / Mengen
als solchen auszugsweise) vorzugehen‘ gilt –
gar zurecht (![]() im Laufe der Zeit / Geschichten hinzu- bis
hinweggekommene Theorien / Vorstellungsfirmamente (namentlich ‚Menschenbilder‘) sind/werden allerdings sozialpsycho-logischerweise nicht etwa deshalb weniger
wirkmächtig verbreitet, weil sie empirisch widerlegt wurden, oder
menschenfeindlich sind) – als das wesentlichste Geheimnis
im Laufe der Zeit / Geschichten hinzu- bis
hinweggekommene Theorien / Vorstellungsfirmamente (namentlich ‚Menschenbilder‘) sind/werden allerdings sozialpsycho-logischerweise nicht etwa deshalb weniger
wirkmächtig verbreitet, weil sie empirisch widerlegt wurden, oder
menschenfeindlich sind) – als das wesentlichste Geheimnis ![]() ]
]
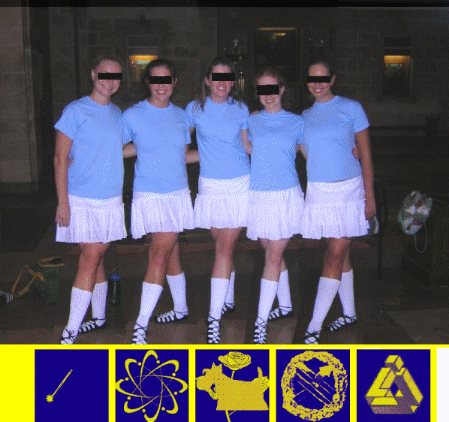 ‚Merkwürdigerweise‘ so bemerkte
bereits/immerhin Ludwig Wittgenstein, dass es zu den philosophisch
gefährlichsten Voraussetzungen gehört, ‚anzunehmen wir würden mit dem, oder im,
Kopf denken.‘
‚Merkwürdigerweise‘ so bemerkte
bereits/immerhin Ludwig Wittgenstein, dass es zu den philosophisch
gefährlichsten Voraussetzungen gehört, ‚anzunehmen wir würden mit dem, oder im,
Kopf denken.‘  [… gleich gar alle Menschen stets
übereinstimmend genau das Deckungsgleiche empfindend] – Gar eher noch
erschreckender (indoeuropäisches Selbstempfinden,
geradezu blasphemisch horrormäßig,
verstörend – als die Existenz, bis eben Aus- umd
Einwirkungen, von Beobachtenden [anstatt:
[… gleich gar alle Menschen stets
übereinstimmend genau das Deckungsgleiche empfindend] – Gar eher noch
erschreckender (indoeuropäisches Selbstempfinden,
geradezu blasphemisch horrormäßig,
verstörend – als die Existenz, bis eben Aus- umd
Einwirkungen, von Beobachtenden [anstatt: ihrer / als ihre Anatomie / Lolalisationen]), dass/wo gar nicht ‚nur‘ vier (Wasser, Erde, Feuer, Luft – chinesisch: Feuer,
Erde, Metall, Wasser und Holz), bis fünf (vgl.
auch griechische ‚quinta-essencia‘ zumal als
‚Quintessenz‘ bis vereinzahligtes
Universalallheilmittel z.B. ‚Ambrosia‘ oder ‚Stein der Weisen‘ pp. genannte
Alleserklärungsvariable), Reinstoffe zu unterschieden vorliegen – und
gleich gar nicht nur zweierlei Variable umgebungslos / trägerfrei
allgegenwärtiger Digitalität/(Wahrheit)en maximaler Kontrastklarheit (nur allzu gern mit vorgeblich Eindeutigkeiten von/wie messbarem ‚eöektrischem Strom versus Nichtstrom‘, oder
‚Sauerstoffverbrauch‘, äh
logisch-boolschem ‚Ja oder Nein‘ vertauschend
verwechselt). 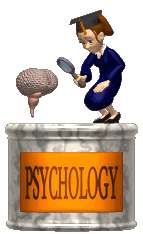 Gehirne,
zumal menschliche, immerhin bisher als ‚das
komplexeste Stück Materie (im
Universum)‘ bekannt (vgl.
allerdings auch/gerade wie ‚zäh und wirksam‘ geradezu ‚gegenteilige‘, etwa manche
Insekten, ‚funktionsfähig überdauern ‘), lassen sich immerhin (durchaus / eher erwartungsgemäß) als bei / an
Denkprozessen, Gefühlen und insbesondere (bereits
abrufbaren, bis zu entwickelnden / erlernenden) Fähigkeiten des
jeweiligen Lebewesens aktiv beteiligt erkennen, respektive (wenigstens bedingt – etwa ‚zuvor‘, ‚während‘ und
‚danach‘ – anstatt:
Gehirne,
zumal menschliche, immerhin bisher als ‚das
komplexeste Stück Materie (im
Universum)‘ bekannt (vgl.
allerdings auch/gerade wie ‚zäh und wirksam‘ geradezu ‚gegenteilige‘, etwa manche
Insekten, ‚funktionsfähig überdauern ‘), lassen sich immerhin (durchaus / eher erwartungsgemäß) als bei / an
Denkprozessen, Gefühlen und insbesondere (bereits
abrufbaren, bis zu entwickelnden / erlernenden) Fähigkeiten des
jeweiligen Lebewesens aktiv beteiligt erkennen, respektive (wenigstens bedingt – etwa ‚zuvor‘, ‚während‘ und
‚danach‘ – anstatt: nur vergleichend) veränderlich messen. Menschen sind an weitaus mehr / anderen
Aspekten orientiert und/oder interessiert, als an zweiwertigen – gar bedingt/gebunden
rational, und mehr oder minder experimentierfreudig, plus unterschiedlich
‚organisiert‘, sowie nicht rein gefühlsfrei oder bur
rein gefühlslastig – vor Gleichgewichtshoffnungen
wird gewarnt, so manches liegt zwar zwischen den Extremen, doch so gut wie nie
exakt in welcher ‚Mitte‘ auch immer.
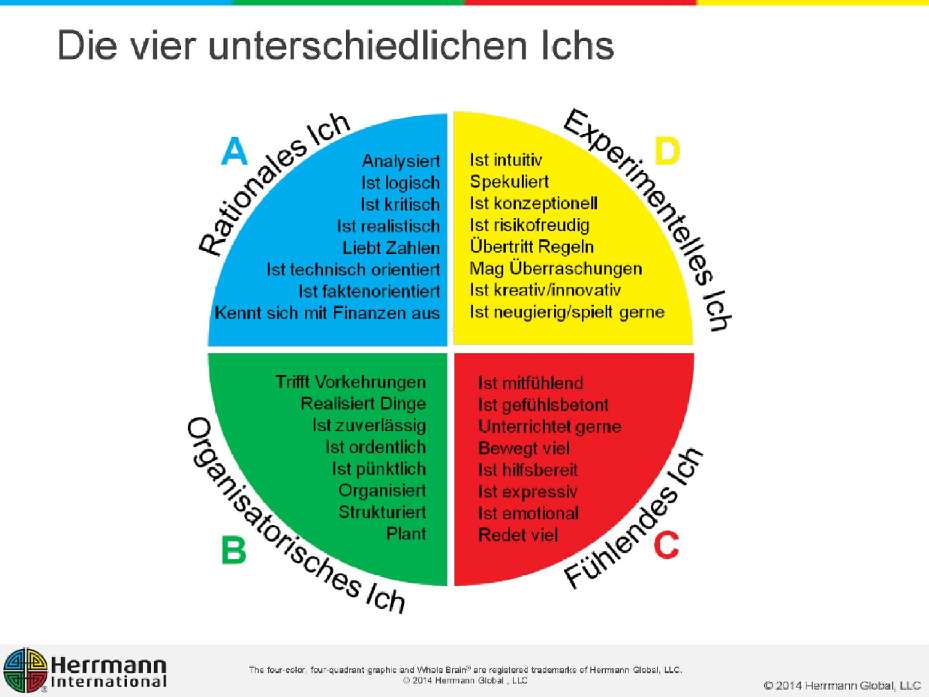 [Ohne deswegen an einer pathologisch
gespaltenen Persönlichkeit / Identitätsstörung leiden zu müssen, weil sich – gar mehrere (typisierbare, bis sozialpsychologischerweise
auch zwischenmenschliche Konflikte und [zumal arbeitsteilige]
Ergänzungsmöglichkeiten befördernde) –
chet-beinahe-Zerrissenheiten
/ Spannungen-
[Ohne deswegen an einer pathologisch
gespaltenen Persönlichkeit / Identitätsstörung leiden zu müssen, weil sich – gar mehrere (typisierbare, bis sozialpsychologischerweise
auch zwischenmenschliche Konflikte und [zumal arbeitsteilige]
Ergänzungsmöglichkeiten befördernde) –
chet-beinahe-Zerrissenheiten
/ Spannungen-![]() auch beim/am/vom einzelnen Menschen
konstatieren / analysieren lassen]
auch beim/am/vom einzelnen Menschen
konstatieren / analysieren lassen]
[Kaum eine Grenze wird, gebauer besehen, so scharf (zumal
vom sogenannten ‚Über-ich‘ / durch jeden selbst)
bewacht, wie jene des (zumal eigenen/fremden,
sowohl individuellen wie kollektiv-kulturelen, bis kulturallistischen) Denk- und Empfindungsvermögens
…]  Grenzrand-Regime des (maximalen) Reduktionismus (mehr als rein zweiwertiger Logik/en des
gnostisch-pantheistischen Dualismus-Syndroms): Spätestens / Immerhin die
analytische Modalität sollte den Rand des Prinzips (hier
in der / für die Wissenschaft/en zwischen ‚nötigen und ‚unnötigen‘ Annahmen /
‚[unabhängigen] Variablen‘ zu unterscheiden) enthüllend, bloßstellen,
dass es (auch ‚inhaltlich‘) nicht, bis
nie, nur zwei (‚wahre‘ / authentisch)
dichotome (entweder-oder)
Antwortoptionen gibt – wieder die so trügerischen Hoffnungen (des Denkens / dichotomer Repräsentationen) vom
/ des / im / mit abgeblich ausgeschlossenen Dritten.
Grenzrand-Regime des (maximalen) Reduktionismus (mehr als rein zweiwertiger Logik/en des
gnostisch-pantheistischen Dualismus-Syndroms): Spätestens / Immerhin die
analytische Modalität sollte den Rand des Prinzips (hier
in der / für die Wissenschaft/en zwischen ‚nötigen und ‚unnötigen‘ Annahmen /
‚[unabhängigen] Variablen‘ zu unterscheiden) enthüllend, bloßstellen,
dass es (auch ‚inhaltlich‘) nicht, bis
nie, nur zwei (‚wahre‘ / authentisch)
dichotome (entweder-oder)
Antwortoptionen gibt – wieder die so trügerischen Hoffnungen (des Denkens / dichotomer Repräsentationen) vom
/ des / im / mit abgeblich ausgeschlossenen Dritten.
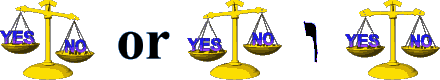 [Gerade für / an / bei zweiwertige/n
Wahlentscheidungen erwieen sich ‚noch nicht
Entscheidbarkeiten‘, ‚falsche Fragestellung(sgestaltung)en‘,
‚irrige oder täuschende Alternativenkonfrontationen‘,
sowie ‚gar Nichtentscheibarkeiten‘ (und teils sogar schon ‚Entscheidungsunwilligkeiten,
bis persönliche Freiheitrechte) als omnipräsent( gar je ignorierter desto wirkmächtige weiter)e dritte / ‚umgebende‘ Kategorienart des jeweiligen Vorstellungenbezugsfirmaments]
[Gerade für / an / bei zweiwertige/n
Wahlentscheidungen erwieen sich ‚noch nicht
Entscheidbarkeiten‘, ‚falsche Fragestellung(sgestaltung)en‘,
‚irrige oder täuschende Alternativenkonfrontationen‘,
sowie ‚gar Nichtentscheibarkeiten‘ (und teils sogar schon ‚Entscheidungsunwilligkeiten,
bis persönliche Freiheitrechte) als omnipräsent( gar je ignorierter desto wirkmächtige weiter)e dritte / ‚umgebende‘ Kategorienart des jeweiligen Vorstellungenbezugsfirmaments]
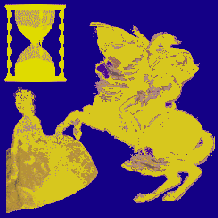 Die
historische Modalität zumal des Wandels (immerhin, wenn
auch häufig zu bestreiten / bekämpfen versuchte, Kpntinentalmetrople
menschlicher Erlebniswelten), zumal als/das Versuchslabor für/der Ideen(bewähung), um der Zukubften (bis sogar gegenwärtiger Orientierungen)
wollen. …
Die
historische Modalität zumal des Wandels (immerhin, wenn
auch häufig zu bestreiten / bekämpfen versuchte, Kpntinentalmetrople
menschlicher Erlebniswelten), zumal als/das Versuchslabor für/der Ideen(bewähung), um der Zukubften (bis sogar gegenwärtiger Orientierungen)
wollen. … 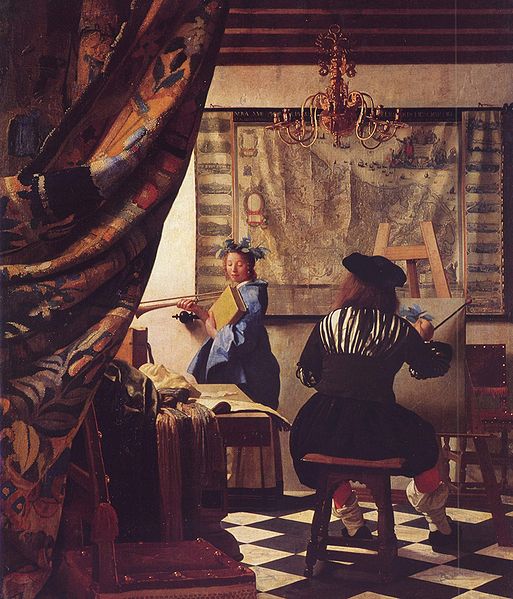 [Vergangenheit vergeht nich1 Zu vergessen was
war ist/wird wiederholungsgefährlich]
[Vergangenheit vergeht nich1 Zu vergessen was
war ist/wird wiederholungsgefährlich]
 Semiotische, häufig auch nur/immerhin als
linguistische bemerkte, Modalität – ‚längst‘ als wesentlicher
Forschungsgegenstand der Philosophie ‚geoutet‘, bis zu omnipräsenten
Projektionsverdächtigungen-Thesen reichend: Dass allein/wirklich Grammatika (nur die
Repräsentationen, allenfalls bis auf dren somatische
‚wiederspiegelungen‘,
nichts Repräsentiertes) existieren würden/könnten/dürften. … ‚Schattiges
bei dem Baume.‘ Nicht jede Sprache / Denkweise bedarf stets des Täters
(passiven bis aktive Genus verbi). ‚die Frau spende
Geld/Schatten.‘ und/oder ‚Öffnen Sie die Hand – wo ist
Ihre Fraust geblieben?‘ (vgl. V.F.B.) …
Semiotische, häufig auch nur/immerhin als
linguistische bemerkte, Modalität – ‚längst‘ als wesentlicher
Forschungsgegenstand der Philosophie ‚geoutet‘, bis zu omnipräsenten
Projektionsverdächtigungen-Thesen reichend: Dass allein/wirklich Grammatika (nur die
Repräsentationen, allenfalls bis auf dren somatische
‚wiederspiegelungen‘,
nichts Repräsentiertes) existieren würden/könnten/dürften. … ‚Schattiges
bei dem Baume.‘ Nicht jede Sprache / Denkweise bedarf stets des Täters
(passiven bis aktive Genus verbi). ‚die Frau spende
Geld/Schatten.‘ und/oder ‚Öffnen Sie die Hand – wo ist
Ihre Fraust geblieben?‘ (vgl. V.F.B.) …  [Gar geöffn te Fenster des semiotischen Ahnensaals im nicht allein
Luftschloss menschenheitlichen Wissens und Könnens,
übern arithmetisch-algebraischen
Aufstiegsgewölbe, den topologischen sogar Innenhof ‚sehend‘.
Umgeben von der Komplexitäten ‚Küche‘ unterm Geschehen(sspeisesahl der Geschichte), dem
Ostflügel der Physis bis Psyche und sozialpsyvhologisch
bis kulturalistisch synchronisierend grauer Alltagsterasse über des Habens Jagdriohäenhalle
mit Portugierischer Gallerie
(gar Kohelets):
[Gar geöffn te Fenster des semiotischen Ahnensaals im nicht allein
Luftschloss menschenheitlichen Wissens und Könnens,
übern arithmetisch-algebraischen
Aufstiegsgewölbe, den topologischen sogar Innenhof ‚sehend‘.
Umgeben von der Komplexitäten ‚Küche‘ unterm Geschehen(sspeisesahl der Geschichte), dem
Ostflügel der Physis bis Psyche und sozialpsyvhologisch
bis kulturalistisch synchronisierend grauer Alltagsterasse über des Habens Jagdriohäenhalle
mit Portugierischer Gallerie
(gar Kohelets):  Was Namen sind wissen wir nicht1 Was Ausdrücke
bedeuten läßt sich auch dekretieren, sondern wird von
jenen bestimmt die sie in dieser Sprache so/dafür verwenden wie sie es
überwiegend tun. Beeinflussungsversuchungen, Irritationen bis gar
Änderungsversuche, (Herausforderungen der
Deutungshoheit) dessen was Ausdrücke Bedeuten (also namentlich der basalen denkerischen Kategorien selbst)
verlaufen/wirken besonders heftig: ‚Du magst zwar eine wichtige abweichende
Bedeutung im Sinn haben, verwende dafür jedoch bitte/gefälligst ein anders wirt!‘
Was Namen sind wissen wir nicht1 Was Ausdrücke
bedeuten läßt sich auch dekretieren, sondern wird von
jenen bestimmt die sie in dieser Sprache so/dafür verwenden wie sie es
überwiegend tun. Beeinflussungsversuchungen, Irritationen bis gar
Änderungsversuche, (Herausforderungen der
Deutungshoheit) dessen was Ausdrücke Bedeuten (also namentlich der basalen denkerischen Kategorien selbst)
verlaufen/wirken besonders heftig: ‚Du magst zwar eine wichtige abweichende
Bedeutung im Sinn haben, verwende dafür jedoch bitte/gefälligst ein anders wirt!‘ ![]() Und/Aber entgegen etwa dem (deutschsprachigen Miss)Verständnis von /koxma/ חכמה ‘wisdom/intelligence‘
kommt ‚Weisheit‘ weder von mehr, noch von besserem Wissen / Kenntnissen, und
steht auch nicht notwendigerweise in Konflikten mit Klugheit: Nur findet die
weise Person, dank der Weisheit aus Situationen wieder heraus, in die der kluge
Mensch, dank seiner (gar durchaus eigen
angeeigneten) Klugheit, gar nicht erst hineingeraten wäre. Denn mit
Marie v. Ebner-Eschenbach begründet das Nachgeben reiner Klugheit (gar ‚die Goldene Regel‘ bis soweit ‚unterlassend‘
auch der ,Kategorische Imperativ‘) die
Vorherrschaft / den Fortbestand der Dummheit/en (jenes
Respekt[miss]verständnisses, das den/die Anderen
zumindest machen läßt, bis sich den anderen Willen
vorbehaltlos unterstützend aneignet)]
Und/Aber entgegen etwa dem (deutschsprachigen Miss)Verständnis von /koxma/ חכמה ‘wisdom/intelligence‘
kommt ‚Weisheit‘ weder von mehr, noch von besserem Wissen / Kenntnissen, und
steht auch nicht notwendigerweise in Konflikten mit Klugheit: Nur findet die
weise Person, dank der Weisheit aus Situationen wieder heraus, in die der kluge
Mensch, dank seiner (gar durchaus eigen
angeeigneten) Klugheit, gar nicht erst hineingeraten wäre. Denn mit
Marie v. Ebner-Eschenbach begründet das Nachgeben reiner Klugheit (gar ‚die Goldene Regel‘ bis soweit ‚unterlassend‘
auch der ,Kategorische Imperativ‘) die
Vorherrschaft / den Fortbestand der Dummheit/en (jenes
Respekt[miss]verständnisses, das den/die Anderen
zumindest machen läßt, bis sich den anderen Willen
vorbehaltlos unterstützend aneignet)]
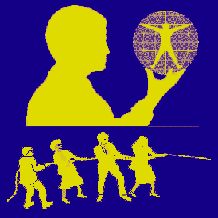 Auch abgesehen von / angesichts der Dreistigkeit(en ‚Soziologie‘ sei das, was jene, die ‚SoziologInnen‘ genannt, bis sich dafür hielten, täten wenn
sie das betreiben, was sie dafür halten) geht es bei Einblicken der sozialen
Modalität in die Gesellschaft/en (ihrer
Strukturen – gleich gar jene mit gegenüber gemeinschaftlichen
Erwartungsüberziehungen, mit nicht nur arbeitsteilig beschränkter Haftung)
um zwischenmenschliche Beziehungsrealtionen des und
der Menschen mit den jeweiligen, wie auch immer figurierten, bis
der Gemeinwesen/s überhaupt, namentlich (‚auch
um‘ anstatt: ‚
Auch abgesehen von / angesichts der Dreistigkeit(en ‚Soziologie‘ sei das, was jene, die ‚SoziologInnen‘ genannt, bis sich dafür hielten, täten wenn
sie das betreiben, was sie dafür halten) geht es bei Einblicken der sozialen
Modalität in die Gesellschaft/en (ihrer
Strukturen – gleich gar jene mit gegenüber gemeinschaftlichen
Erwartungsüberziehungen, mit nicht nur arbeitsteilig beschränkter Haftung)
um zwischenmenschliche Beziehungsrealtionen des und
der Menschen mit den jeweiligen, wie auch immer figurierten, bis
der Gemeinwesen/s überhaupt, namentlich (‚auch
um‘ anstatt: ‚nur um‘ – vgl. auch politikwissenschaftliche
Fragestellungen aus/mittels aller fünfzehn Einzeldisziplinen)
Herrschaftsausübungen – gleich gar wo Individuen und (‚natürlich‘ bis ‚juristisch‘ nennbare)
Personen
vorgeblicher, bis tatsächlicher, Koordination / Synchronisierung bedürfen (wozu besonders gerne Normatives
gegen Narratives ausgespielt wird).
Dass/Wie es vereinzelt, allenfalls minderheitlich, bleibt ‚etwas
Besonderes‘ / diskriminiert (gleich
gar ‚begabt‘ oder ‚berufen/beauftragt‘ – respektive verrandet/verachtet)
zu sein/werden. steht in – allerdings nicht
alle überraschenden – Spannungsverhältnissen damit, dass, wo, was
und wieviel, Gruppierungen bis Gruppen und Institutionen, gerade aus
Individuen/Subjekten, gemeinsam haben (auch
sollen bis wollen), respektive der Fragen diesbezüglicher Abweichungstoleranz/en und
Verhaltensantriebe. Mit zu den heftigsten / ungern bemerkten Einsichten gerade der Sozio-logie gehört wohl, dass die (‚bösen‘
–vgl. רע) Anderen (und zwar
durchaus unausweichlich) all das was mir gelungen (aber auch misslungen), bis zugefallen – warum auch immer – zumindest nicht
verhinderten – so vieles davon sogar
erst ermöglicht haben.  [Ungleichheitsforschung (E.R.W.): Die gar ungeheuerlichsten der
Anderheiten, ‚seinesgleichen‘ sind nämlich kaum (eigenes
Selbst gar überhaupt nicht) los zu werden. – In einem Ergebnis sind und
werden bereits die dyadischen Beziehungsrelationen zwischen zwei, gleich gar (altersmäßig und/oder sexuell)
geschlechtsverschiedenen, respektive diesbezüglich gleichen, Menschen
komplexer, als was eine Seite davon für und mit sich alleine, zu fassen vermag (zumal ohne dies bemerken, oder gar einsehen, zu
müssen/wollen). Mit/Bei zunehmender Gruppengröße wird der tatsächliche
und gleich gar der scheinbare Reduktionsbedarf an Komplexitäten (vgl. insbesondere Niklas Luhmanns Systemthorie,
makrosoziologisch), etwa auf/an Sitten, Gebräuchen und Moden, dialekten oder Themen/Gemurmel, kaum
geringer, erscheint allenfalls deligierbarer (verborgen)]
[Ungleichheitsforschung (E.R.W.): Die gar ungeheuerlichsten der
Anderheiten, ‚seinesgleichen‘ sind nämlich kaum (eigenes
Selbst gar überhaupt nicht) los zu werden. – In einem Ergebnis sind und
werden bereits die dyadischen Beziehungsrelationen zwischen zwei, gleich gar (altersmäßig und/oder sexuell)
geschlechtsverschiedenen, respektive diesbezüglich gleichen, Menschen
komplexer, als was eine Seite davon für und mit sich alleine, zu fassen vermag (zumal ohne dies bemerken, oder gar einsehen, zu
müssen/wollen). Mit/Bei zunehmender Gruppengröße wird der tatsächliche
und gleich gar der scheinbare Reduktionsbedarf an Komplexitäten (vgl. insbesondere Niklas Luhmanns Systemthorie,
makrosoziologisch), etwa auf/an Sitten, Gebräuchen und Moden, dialekten oder Themen/Gemurmel, kaum
geringer, erscheint allenfalls deligierbarer (verborgen)]
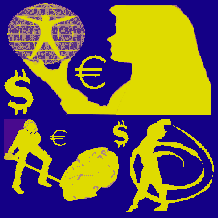 Knappheit/Füllen stellen vor
Allokationsfragen (Verteilungsproblematiken),
dass / falls die Produktivität bei Ungleichheit
höher als bei Gleichverteilung, empört die ökonomische Modalität nicht nur
viele Leuze, sondern läßt (namentlich John Rawles etal)
Verteilungsgrechtigkeit dadzrch/dahin definieren, dass insbedondere die
schlechter gestellten Menschen, mehr haben / bekommen, als sie bei
Gleichverteilung des des kleineren Gesamtproduktes hätten. Gesellschaften
können nicht darauf warten, bis alle oder wenigstens hinreichend viele
‚ihrer‘/der Menschen geeignet – gae ‚weise genug‘ – sind/werden um
verantwortlich darin/dafür zu handeln, sondern haben abweichendes, bis
falsches, Verhalten einzukalkulierend/kontrollierend zu handhaben. Die Unvermeidlichkeiten von / an
Vollzugsdefizitten, das Lückenmanagement, erschreckt viele eher noch mehr als,
dass Steuern etc. (keine
‚Umverteilung‘ – wie ein gängiges, sich gerne ‚liberal‘ gebendes, bis
‚staatsgeindliches‘, Gemurmel öffentlich rauscht, sondern) Vorkosten sind, deren (zumal infrastrukturell, sozial und
‚gesellschaftsvertrags-‘ bis
verfassimgsgemäß korrekte) Verwendung es ermöglichen ein ‚Brutto‘ zu
erwirtschaften, von dem eben (‚nur‘ / ‚immerhin‘) ein ‚Netto‘
verfügbar verbleibt.
Knappheit/Füllen stellen vor
Allokationsfragen (Verteilungsproblematiken),
dass / falls die Produktivität bei Ungleichheit
höher als bei Gleichverteilung, empört die ökonomische Modalität nicht nur
viele Leuze, sondern läßt (namentlich John Rawles etal)
Verteilungsgrechtigkeit dadzrch/dahin definieren, dass insbedondere die
schlechter gestellten Menschen, mehr haben / bekommen, als sie bei
Gleichverteilung des des kleineren Gesamtproduktes hätten. Gesellschaften
können nicht darauf warten, bis alle oder wenigstens hinreichend viele
‚ihrer‘/der Menschen geeignet – gae ‚weise genug‘ – sind/werden um
verantwortlich darin/dafür zu handeln, sondern haben abweichendes, bis
falsches, Verhalten einzukalkulierend/kontrollierend zu handhaben. Die Unvermeidlichkeiten von / an
Vollzugsdefizitten, das Lückenmanagement, erschreckt viele eher noch mehr als,
dass Steuern etc. (keine
‚Umverteilung‘ – wie ein gängiges, sich gerne ‚liberal‘ gebendes, bis
‚staatsgeindliches‘, Gemurmel öffentlich rauscht, sondern) Vorkosten sind, deren (zumal infrastrukturell, sozial und
‚gesellschaftsvertrags-‘ bis
verfassimgsgemäß korrekte) Verwendung es ermöglichen ein ‚Brutto‘ zu
erwirtschaften, von dem eben (‚nur‘ / ‚immerhin‘) ein ‚Netto‘
verfügbar verbleibt.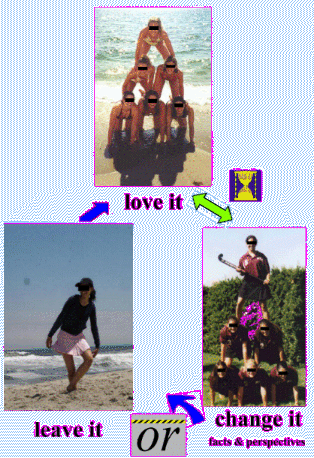 [Es entweder zu lieben oder aber die
Gegebenheiten respektive deren Deutungen zu ändern empfielt
sich zumeist durchaus. Wo/Wenn das nicht genügt / misslingt ist / bleibt ‘leave it‘ um ein neues ‘love it‘ zu finden nicht
notwendigerweise verbaut / vermauert sondern mit Schrecken vor (gar wegweisenden) Ängsten besetzt. – Die ‚Vita
aktiva‘ auch als Anwendung der professionellen einsichten / Notwendigkeiten des beruflichen Lebens, gerade
im gar ‚privat‘ genannten, der näheren Familie, bis Freizeit verbieten sich
keineswegs. Und erfolgen gar nicht notwendigerweise verteilungspardigmatisch
zu Lasten der Kontemplation, Schönheit / Ekeganz,
Liebe oder anderer ‚Großzügigkeiten‘ überhaupt]
[Es entweder zu lieben oder aber die
Gegebenheiten respektive deren Deutungen zu ändern empfielt
sich zumeist durchaus. Wo/Wenn das nicht genügt / misslingt ist / bleibt ‘leave it‘ um ein neues ‘love it‘ zu finden nicht
notwendigerweise verbaut / vermauert sondern mit Schrecken vor (gar wegweisenden) Ängsten besetzt. – Die ‚Vita
aktiva‘ auch als Anwendung der professionellen einsichten / Notwendigkeiten des beruflichen Lebens, gerade
im gar ‚privat‘ genannten, der näheren Familie, bis Freizeit verbieten sich
keineswegs. Und erfolgen gar nicht notwendigerweise verteilungspardigmatisch
zu Lasten der Kontemplation, Schönheit / Ekeganz,
Liebe oder anderer ‚Großzügigkeiten‘ überhaupt]
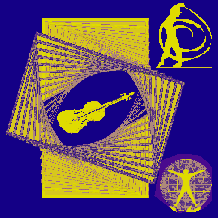 Ästhetische Modalität beschränk sich weder auf
irgendwelche Harmoniemaße, öh Schönheitsideal-
oder Symetriebrechenungsgrade – wo immerhin klar
werden könnte, dass/wie etwa ‚konvexe‘ und dem entsprechend kompatible ‚konkave‘
Kreativität/en für Resonanzen zusammenpassen sollten: Das Gegenüber ist, bzw.
ich bin, nicht deswegen ‚blöd‘ / ‚schwer von Begriff‘, oder ‚schlecht im
Erklären‘, weil/wenn einer der Seiten ausgerechnet jener eine, oder andere,
‚Fadem‘ im aktuell verfügbaren ‚Kenntnisnsnetz(werk)‘ fehlt, an dem gerade angeknüpft werden
soll. – Vielmehr erlauben ‚künstlerische‘ Distanzen zu und Darstellungen von
‚Erfahrungskernen‘, bis (andere, nwuw, neherlei)
Darstellungen, ‚deren‘ Konsequenzen, zu erkennen, die (einzelne, bis etwa systematisierte) Erlebnisse so/an sich gar
nicht haben / beinhalten – sondern die von den (zumal
teilnehmend) Beobachtenden erachtend ‚gemacht‘ / ‚erdacht‘ werden: So
war beispielsweise ‚das Alte‘ lange ‚dem Neuen‘ vorgezogen worden. Die Abendländische
Wende vor der Vorstellung bis Argumentationsnotwendigkeit: ‚alles nun
Beabsichtigte / Getane sei (eigentlich) bereits längt bekannt;
(auch Entdeckungen) allenfalls ein Kommentar zur Tradition der Vorfahren (lasse sich zumindest bereits an in der Bibel / Tora Stehendem anknüpfen/belegen)‘ zur heutigen, als
solche meist geradezu unbemerkbar verselbstvaerständlichten Haltungswahl:
‚alles Gute müsse, (eigentlich) völlig neuer, so noch
nie dagewesener, Fortschritt, respektive dessen (mehr
oder minder unausweichliches – besseres den jemals) Ergebnis, sein‘ –
charakterisiert, bis datiert das Buch ‚Novum oganoum‘
von Sir Francies Beakon um
1605/1629. Wo / Als sich viele grundlegend ‚barock‘ prägende Entscheidungen für
/ unter / aus Utopien und
Regelungsidealen – zumal eindrücklich in
Sachen Geschlechterverungleichungen / ‚doing gender‘ – finden/nachweisen lassen, die psychischen
Verfasstheiten heutiger Menschen als ‚in gerade
und nur dieser Art und Weise ursprünglich natürliche
Vorgegebenheit‘ (bis sträflich kulturell
‚überformt‘ oder endlich, respektive eben doch nicht, zivilisatorisch
‚überformbar‘) erscheinen.
Ästhetische Modalität beschränk sich weder auf
irgendwelche Harmoniemaße, öh Schönheitsideal-
oder Symetriebrechenungsgrade – wo immerhin klar
werden könnte, dass/wie etwa ‚konvexe‘ und dem entsprechend kompatible ‚konkave‘
Kreativität/en für Resonanzen zusammenpassen sollten: Das Gegenüber ist, bzw.
ich bin, nicht deswegen ‚blöd‘ / ‚schwer von Begriff‘, oder ‚schlecht im
Erklären‘, weil/wenn einer der Seiten ausgerechnet jener eine, oder andere,
‚Fadem‘ im aktuell verfügbaren ‚Kenntnisnsnetz(werk)‘ fehlt, an dem gerade angeknüpft werden
soll. – Vielmehr erlauben ‚künstlerische‘ Distanzen zu und Darstellungen von
‚Erfahrungskernen‘, bis (andere, nwuw, neherlei)
Darstellungen, ‚deren‘ Konsequenzen, zu erkennen, die (einzelne, bis etwa systematisierte) Erlebnisse so/an sich gar
nicht haben / beinhalten – sondern die von den (zumal
teilnehmend) Beobachtenden erachtend ‚gemacht‘ / ‚erdacht‘ werden: So
war beispielsweise ‚das Alte‘ lange ‚dem Neuen‘ vorgezogen worden. Die Abendländische
Wende vor der Vorstellung bis Argumentationsnotwendigkeit: ‚alles nun
Beabsichtigte / Getane sei (eigentlich) bereits längt bekannt;
(auch Entdeckungen) allenfalls ein Kommentar zur Tradition der Vorfahren (lasse sich zumindest bereits an in der Bibel / Tora Stehendem anknüpfen/belegen)‘ zur heutigen, als
solche meist geradezu unbemerkbar verselbstvaerständlichten Haltungswahl:
‚alles Gute müsse, (eigentlich) völlig neuer, so noch
nie dagewesener, Fortschritt, respektive dessen (mehr
oder minder unausweichliches – besseres den jemals) Ergebnis, sein‘ –
charakterisiert, bis datiert das Buch ‚Novum oganoum‘
von Sir Francies Beakon um
1605/1629. Wo / Als sich viele grundlegend ‚barock‘ prägende Entscheidungen für
/ unter / aus Utopien und
Regelungsidealen – zumal eindrücklich in
Sachen Geschlechterverungleichungen / ‚doing gender‘ – finden/nachweisen lassen, die psychischen
Verfasstheiten heutiger Menschen als ‚in gerade
und nur dieser Art und Weise ursprünglich natürliche
Vorgegebenheit‘ (bis sträflich kulturell
‚überformt‘ oder endlich, respektive eben doch nicht, zivilisatorisch
‚überformbar‘) erscheinen. 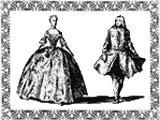 [Wahrnehmung gar überraumzeitliche /
theoretische, bis außerraumzeitlich intuitiv / inspirativ. – Kleine, vielleicht
sogar / immerhin für Newton bis Goethe akzeptabel resonanzfähige, Summe /
Grundlagen der Erlebnisqualitäten ‚Farbe‘: Blaues (‚des
Westens‘ / ‚dkonditional möglicher Tempora‘)
‚zu hören‘ erleichtert das Erkennen der/von Zusammenhängen; Rotes (‚den Norden‘ / ‚das Präteritum‘) ‚zu riechen‘
hilft bei der Fehlerfandung; und\aber Gelbes (‚gar
‚des Präsenz‘) ‚zu fühlen‘ deckt eher, während an dieser ‚dritten
Stelle‘(‚des/um Osten/s‘)
Grünes (bis ‚des Zentrums‘ / ‚des Futurum‘) transparent offen, zumal auf
monekular-atomar dünner ‚Ebene‘ gar/gerade ‚Gold‘,
durchleuchtet]
[Wahrnehmung gar überraumzeitliche /
theoretische, bis außerraumzeitlich intuitiv / inspirativ. – Kleine, vielleicht
sogar / immerhin für Newton bis Goethe akzeptabel resonanzfähige, Summe /
Grundlagen der Erlebnisqualitäten ‚Farbe‘: Blaues (‚des
Westens‘ / ‚dkonditional möglicher Tempora‘)
‚zu hören‘ erleichtert das Erkennen der/von Zusammenhängen; Rotes (‚den Norden‘ / ‚das Präteritum‘) ‚zu riechen‘
hilft bei der Fehlerfandung; und\aber Gelbes (‚gar
‚des Präsenz‘) ‚zu fühlen‘ deckt eher, während an dieser ‚dritten
Stelle‘(‚des/um Osten/s‘)
Grünes (bis ‚des Zentrums‘ / ‚des Futurum‘) transparent offen, zumal auf
monekular-atomar dünner ‚Ebene‘ gar/gerade ‚Gold‘,
durchleuchtet]
Abb. Der Modalitäten von
Historie bis Ästhetik: Na klar gehe ich von mir ‚selber‘ (gar meinem gegenwärtigen Standort – QTH?) aus!
![]() Ups Menschen
können nämlich (auch/gerade ‚abstrahierend‘)
gar nicht anders – gegenteiliges zu vermeinen / behaupten / verlangen
unterstellt (im Zweifel / Konflikt gar ‚besser
als diese‘) zu wissen / fühlen was in dem / der / den Anderen wie
vorgeht – unterstellt jene hochgefährlich über äußerliche Uniformitäten
hinausgehende/n Identitäts-Gleichheit/en (‚
Ups Menschen
können nämlich (auch/gerade ‚abstrahierend‘)
gar nicht anders – gegenteiliges zu vermeinen / behaupten / verlangen
unterstellt (im Zweifel / Konflikt gar ‚besser
als diese‘) zu wissen / fühlen was in dem / der / den Anderen wie
vorgeht – unterstellt jene hochgefährlich über äußerliche Uniformitäten
hinausgehende/n Identitäts-Gleichheit/en (‚der
andere Mensch denkt genau wie ich‘,
‚alle Leute fühlen gerade was ich fühle‘, ‚jene Person will was ich
jetzt, oder an ihrer Stelle, wollte‘ usw. und so fort) die
keineswegs (und gleich gar nicht
notwendigerweise so umfassend oder häufig, wie ich dies erwarte und empfinde)
gegeben.  [Ganz dünnes, brüchiges und tückisches Schneeris – darauf verwiesen zu sein/werden von sich auf
zumal Seinesgleichen (die/den ‚Nächsten‘ –vgl. ebenso רע) zu schließen]
[Ganz dünnes, brüchiges und tückisches Schneeris – darauf verwiesen zu sein/werden von sich auf
zumal Seinesgleichen (die/den ‚Nächsten‘ –vgl. ebenso רע) zu schließen]
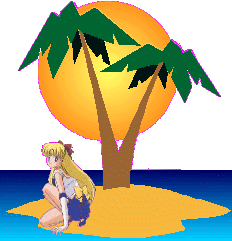 [Zudem gestehe ich durchaus ein, ‚meine‘
/ die Umgebungen, bis Umgebende/n, beeinflussem zu
wollen (bis gar zu ‚sollen‘) – aber ich
muss (zumal dazu) nicht wollen, dass
S/sie sich von mir manipuliert, äh beeinflusst. fühlen / beherrscht vorkommen (vgl. Martin Buber, zumal bereit – jene die dies,
durch ihn ernsthaft riskieren, wollten – zum ‚empirischen Fenster‘ zu führen,
es zu öffnen und, seines Erachtens zu wenig gesehene, Wirklickeitsaspekte
zu zeigen)] Von mir selbst (gleich gar ‚meiner einsamen Insel‘ / ‚Rückzugswelt‘ /
‚Traum-‚ äh meinen Realitätenvorstellungen) ausgehen zu dürfen,
bis zu ‚müssen‘ (es unausweichlich, gerade bei /
trotz anderen Absichten, zu tun), bedeutet weder ‚kein Mitgefühl oder
keine Rücksichtnahmen entwickeln / haben zu können / brauchen‘, noch verlangt
es: ‚Bei mir selbst stehen bleiben, um mich (zumal
ausschließlich) mit mir selbst befassen zu müssen‘. [Die Kenntnismenge,
des einem/mir vertraut Vorkommenden, als Kreis vor- bis dargestellt,
repräsentiert dessen Umfang, die Linie der Fragezeichen, die Berührungen mit
dem (zumindest ‚noch‘) Unbekannten. –
Nimmt die ‚Fläche‘ der / an Erfahrungen / Erkenntnissen zu (oder ab), wird auch ihr Umfang …; vgl. bereits Sokrates]
[Zudem gestehe ich durchaus ein, ‚meine‘
/ die Umgebungen, bis Umgebende/n, beeinflussem zu
wollen (bis gar zu ‚sollen‘) – aber ich
muss (zumal dazu) nicht wollen, dass
S/sie sich von mir manipuliert, äh beeinflusst. fühlen / beherrscht vorkommen (vgl. Martin Buber, zumal bereit – jene die dies,
durch ihn ernsthaft riskieren, wollten – zum ‚empirischen Fenster‘ zu führen,
es zu öffnen und, seines Erachtens zu wenig gesehene, Wirklickeitsaspekte
zu zeigen)] Von mir selbst (gleich gar ‚meiner einsamen Insel‘ / ‚Rückzugswelt‘ /
‚Traum-‚ äh meinen Realitätenvorstellungen) ausgehen zu dürfen,
bis zu ‚müssen‘ (es unausweichlich, gerade bei /
trotz anderen Absichten, zu tun), bedeutet weder ‚kein Mitgefühl oder
keine Rücksichtnahmen entwickeln / haben zu können / brauchen‘, noch verlangt
es: ‚Bei mir selbst stehen bleiben, um mich (zumal
ausschließlich) mit mir selbst befassen zu müssen‘. [Die Kenntnismenge,
des einem/mir vertraut Vorkommenden, als Kreis vor- bis dargestellt,
repräsentiert dessen Umfang, die Linie der Fragezeichen, die Berührungen mit
dem (zumindest ‚noch‘) Unbekannten. –
Nimmt die ‚Fläche‘ der / an Erfahrungen / Erkenntnissen zu (oder ab), wird auch ihr Umfang …; vgl. bereits Sokrates]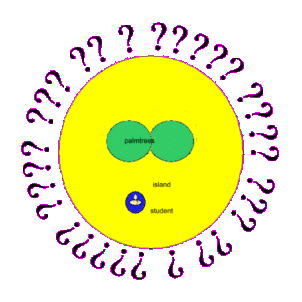
[Viele – etwa nicht erst / allein MoralistInnen
oder UmweltschützerInnen – erschrecken, bis
reagieren, heftigst, bei der Vorstellung / Erwähnung,
‚dass jeder auf / mit seiner eigenen (Individualdistanz
äh) Insel lebe‘ – sind auch nicht immer damit zu beruhigen /
trösten, dass dazwischen Gemeinsamkeiten / Verbindungen zu finden sind (so decken sich die biometrischen Gesichtszüge aller
gegenwärtigen Menschen, edv-technisch analysiert, zu
mindestens 65 % - näher miteinander verwandter tendenziell mehr), oder von der (dem Gemeinten / Gesagten gar nicht widersprechenden)
Einsicht, dass alle zusammen / nebeneinander auf ein und der
selben, einen (gar endlichen) Erde
leben]  Diese Gefahren sind / bleiben groß, zumal
Menschen meist nichts lieber tun, als von ihrer diesbezüglich durchaus ganz
eigenen, erlebnisweltlichen
Diese Gefahren sind / bleiben groß, zumal
Menschen meist nichts lieber tun, als von ihrer diesbezüglich durchaus ganz
eigenen, erlebnisweltlichen
Insel zu erzählen, bis Unähnlichkeiten ‚mit/auf der Insel, des / der
anderen‘ für/als falsch etc. oder faszinierend pp. zu halten / handhaben.  [Gemeinsam sind, bis werden, wir sogar im
Stande: Weitaus mehr An- bis Auszuleuchten, als gemeinsame (ob eher konsensuale oder dissensuale) Überlappungen unserer ‚Kenntnisbereiche‘
plus unserer gesamten übrigen je eigenen Erfahrungen zusammengenommen]
[Gemeinsam sind, bis werden, wir sogar im
Stande: Weitaus mehr An- bis Auszuleuchten, als gemeinsame (ob eher konsensuale oder dissensuale) Überlappungen unserer ‚Kenntnisbereiche‘
plus unserer gesamten übrigen je eigenen Erfahrungen zusammengenommen]
[Zumal Denken und (gleich gar intendiertes) Verhalten (immerhin anaytisch, also
‚denkerisch‘ und somit unausweichlich durchaus handelnd) zweierlei
Orientierungen des und der Menschen, die nicht (immer)
leicht ‚wieder‘ miteinander in Einklang zu bringen … ]
 Ausgerechnet vom gar / immerhin (lernenden / umsinnenden) ‚Sprung des Denkens‘, zum durchaus
jeweils ‚Sprung der Tat‘, [… falls, bis da / wo, qualifizierte (gar durchaus ‚bedingte‘, anstatt:
Ausgerechnet vom gar / immerhin (lernenden / umsinnenden) ‚Sprung des Denkens‘, zum durchaus
jeweils ‚Sprung der Tat‘, [… falls, bis da / wo, qualifizierte (gar durchaus ‚bedingte‘, anstatt: ‚willkürliche‘ oder
‚zwingend‘) Freiheit existiert …]  reichen Motive / Anreize
reichen Motive / Anreize  [ – zu vielen
Leuten, zu oft, überraschend verborgen bleibend – ] überhaupt nie / nicht hin: Gerade
beim / zum / im Handeln (Tun & Lassen)
geht es nämlich um Überwindungen von Hindernissen / Durchtanzen von Abständen / sprunghaftes
Durchschreiten, bis managen, von Lücken.
[ – zu vielen
Leuten, zu oft, überraschend verborgen bleibend – ] überhaupt nie / nicht hin: Gerade
beim / zum / im Handeln (Tun & Lassen)
geht es nämlich um Überwindungen von Hindernissen / Durchtanzen von Abständen / sprunghaftes
Durchschreiten, bis managen, von Lücken.  [… zwingen
die (wohl dreierlei Richtungen der, durchaus
affizierenden / persönlich betreffenden – noch so guten oder schlecjten) Gründe nicht das / ihr / mein /
sein BET
[… zwingen
die (wohl dreierlei Richtungen der, durchaus
affizierenden / persönlich betreffenden – noch so guten oder schlecjten) Gründe nicht das / ihr / mein /
sein BET ![]() (motivational mit/als ‚Komfort-Zone‘ etc. weder
zureichend, noch notwendigerweise ‚schweinehündisch‘ treffend, beschrieben)
gegenwärtiges Dasein respektive damit wechselwirkend Bewusstheit/en zu ändern /
‚verlassen‘
(motivational mit/als ‚Komfort-Zone‘ etc. weder
zureichend, noch notwendigerweise ‚schweinehündisch‘ treffend, beschrieben)
gegenwärtiges Dasein respektive damit wechselwirkend Bewusstheit/en zu ändern /
‚verlassen‘ ![]() GIMEL – das
besorgen / ‚vermitteln‘ zumeist Menschen (nicht
immer, andere – und höchstens in eher seltenen, ganz besonders heftigen /
unmittelbaren Fällen vielleicht …)]
GIMEL – das
besorgen / ‚vermitteln‘ zumeist Menschen (nicht
immer, andere – und höchstens in eher seltenen, ganz besonders heftigen /
unmittelbaren Fällen vielleicht …)] 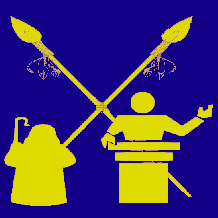
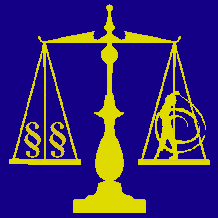 Juristische Modalität, fragend ob die jeweilige Norm so für alle, zu
allen Zeiten und überall Gültigkeit hat – oder eben in welchen Fällen gerade
nicht voraussetzungslos gilt? Zudem bemerkend dass rechtliche Gesetze gerade
auch kontrafaktische Gültigkeitsansprüche erheben, auch (anstatt etwa ausschließlich) zur Ahndung von Verstößen dagegen
da sein können, bis sollen: Aber gerade dies ohne dass Menschen dazu der freien
Willkür (zumal Mächtiger, bis Herrschender oder
gar Geschädigter respektive der Bevölkerung) ausgesetzt sind/bleiben.
Auch zeichnt sich ein funktionierender Rechtsstaat (gerade ‚die Gleichheit vor dem Gesetz‘) nicht etwa dadurch aus,
dass seine Gerichtshöfe blind oder schnell sind, sondern dadurch wie genau sie
hinsehen. Zu den Geheimnissen / Ergebnissen gehört, dass (bis wem) aus Pflichten (immer) Rechte entstehen – während, bis wogen, so manche
gegenteiliges versuchen / durchsetzen wollen. Menschen erhalten stets und
zunächst gerade das was ihnen faktisch zufällt – nicht notwendigerweise dem
entsprechend was (auch ‚nur‘ / immerhin irgend) eine
Seite für ‚ge-recht‘ hält. Worauf es aber – gar für viele noch weitaus überraschender (vor und
nach Lissabon 1755 / Theodizee-Fragen) – ankommt bleibt: Wie sie damit umgehen! Recht ist jenes (zu gerne mit Ergebnissen verwechselte)
Verfahren, durch das die erheblichen Beiträge der/ihrer Gemeinwesen zu dem was
Menschen widerfährt transparent, bis sogar fair und\aber in ihrem Verlaufe (‚inhaltlich‘ anstatt ‚
Juristische Modalität, fragend ob die jeweilige Norm so für alle, zu
allen Zeiten und überall Gültigkeit hat – oder eben in welchen Fällen gerade
nicht voraussetzungslos gilt? Zudem bemerkend dass rechtliche Gesetze gerade
auch kontrafaktische Gültigkeitsansprüche erheben, auch (anstatt etwa ausschließlich) zur Ahndung von Verstößen dagegen
da sein können, bis sollen: Aber gerade dies ohne dass Menschen dazu der freien
Willkür (zumal Mächtiger, bis Herrschender oder
gar Geschädigter respektive der Bevölkerung) ausgesetzt sind/bleiben.
Auch zeichnt sich ein funktionierender Rechtsstaat (gerade ‚die Gleichheit vor dem Gesetz‘) nicht etwa dadurch aus,
dass seine Gerichtshöfe blind oder schnell sind, sondern dadurch wie genau sie
hinsehen. Zu den Geheimnissen / Ergebnissen gehört, dass (bis wem) aus Pflichten (immer) Rechte entstehen – während, bis wogen, so manche
gegenteiliges versuchen / durchsetzen wollen. Menschen erhalten stets und
zunächst gerade das was ihnen faktisch zufällt – nicht notwendigerweise dem
entsprechend was (auch ‚nur‘ / immerhin irgend) eine
Seite für ‚ge-recht‘ hält. Worauf es aber – gar für viele noch weitaus überraschender (vor und
nach Lissabon 1755 / Theodizee-Fragen) – ankommt bleibt: Wie sie damit umgehen! Recht ist jenes (zu gerne mit Ergebnissen verwechselte)
Verfahren, durch das die erheblichen Beiträge der/ihrer Gemeinwesen zu dem was
Menschen widerfährt transparent, bis sogar fair und\aber in ihrem Verlaufe (‚inhaltlich‘ anstatt ‚formell‘) offen (anstatt: im/als Resultat bereits vprher determiniert, willkürlich / beliebig oder parteiisch),
gestaltet werden können & dürfen.  [‚Das Gesetze ist wie die Bibel, S/sie
werden immer Zitate finden, die im Widerspruch zu anderen Zitaten stehen –
stets deutende Anwendung/en erfahrend‘: Auch mittels der Rechts, Unrecht zu tun
/ begehen ist nicht weniger beleibt, als es immer wieder wirksam / wirkmächtig
wird; gerade diesbezüglich gehen – immerhin
inzwischen supranational festgeschriebene (bis einklagbare, jedenfalls bedingt
überwacht werdende) – ‚Menschenrechte‘ (konkretisierter
Schutz des/der anderen vor meiner/unserer Willkür) teils sogar ausdrücklich (darin stehend) manchen Verfassungsregelungen
vor]
[‚Das Gesetze ist wie die Bibel, S/sie
werden immer Zitate finden, die im Widerspruch zu anderen Zitaten stehen –
stets deutende Anwendung/en erfahrend‘: Auch mittels der Rechts, Unrecht zu tun
/ begehen ist nicht weniger beleibt, als es immer wieder wirksam / wirkmächtig
wird; gerade diesbezüglich gehen – immerhin
inzwischen supranational festgeschriebene (bis einklagbare, jedenfalls bedingt
überwacht werdende) – ‚Menschenrechte‘ (konkretisierter
Schutz des/der anderen vor meiner/unserer Willkür) teils sogar ausdrücklich (darin stehend) manchen Verfassungsregelungen
vor]
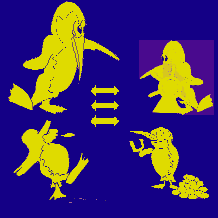 Die
ethische Modalität, nicht gerade selten mit Moral verwechselt, bis zum
Moralisieren verkommen, bleibt eine wichtig (weder
‚
Die
ethische Modalität, nicht gerade selten mit Moral verwechselt, bis zum
Moralisieren verkommen, bleibt eine wichtig (weder
‚die letzte/erste‘ noch ‚die oberste‘) Möglichkeit dessen
an Tauglich- bis Notwendigkeiten was an Haltungen, Einstellungen, etc. zwar
nicht (nicht einmal belehrend)
erzwingbare, jedoch (in Mindestmaßen) notwendige
Voraussetzung zivilisierten Zusammenlebens (gleich gar in einer nicht nur
‚formalen Demokratie). Dazu gehört auch die Einsicht, dass etwas nicht deswegen
falsch oder verweflich(es Verhalten) istm weik es vom
erwarteten/gewohnten abweicht. Zu gerne
scheint Gnade als das verstanden, bis missbraucht, zu werden, was unzureichende
Ergebnisse bestmöglichen Bemühens, oder bis aber eben Unterlassenes Versäumtes, auszugleichen habe. …  [Ethische Konflikte sind nicht selten,
Würdekollisionen schon eher. Wohlverstandene ‚Gesetzestreue‘ wäre bereits allzumeist genug; doch besonderen Eifer entwickeln nicht
etwa erst ‚Autoritäre Persönlichkeiten‘ beim/um –
na klar ‚fürsorglich‘ bis ‚vorsorglich‘ gemeinten (herrschaftlich
interessierten) – Überbieten ‚des Gesetzes‘ / der תורה Weisung (zumal
G‘ttes). – Doch, bis gar eher denn: Menschen
vergessen, zumal im Alltag, Dinge (Ereignisse
und sogar Personen), die ihnen (dennoch,
und obwohl sie ihnen eigentlich) wirklich wichtig / nötig sind/bleiben זכור /zachor/ bis Ritual_Pausen
und Festkalender (helfen gar mehr als buchhalterischer
Übererfüllungsversuchungen zwecks hinreichender Minimumsereichungshoffnungen
des Ausgleichens von Observanzen; vgl. Konflike des
Zauns der 613-mizwot um die Tora nicht zu
verletzen/übertreten, bis zum Stoppstellenschilder-Aufkommen)]
[Ethische Konflikte sind nicht selten,
Würdekollisionen schon eher. Wohlverstandene ‚Gesetzestreue‘ wäre bereits allzumeist genug; doch besonderen Eifer entwickeln nicht
etwa erst ‚Autoritäre Persönlichkeiten‘ beim/um –
na klar ‚fürsorglich‘ bis ‚vorsorglich‘ gemeinten (herrschaftlich
interessierten) – Überbieten ‚des Gesetzes‘ / der תורה Weisung (zumal
G‘ttes). – Doch, bis gar eher denn: Menschen
vergessen, zumal im Alltag, Dinge (Ereignisse
und sogar Personen), die ihnen (dennoch,
und obwohl sie ihnen eigentlich) wirklich wichtig / nötig sind/bleiben זכור /zachor/ bis Ritual_Pausen
und Festkalender (helfen gar mehr als buchhalterischer
Übererfüllungsversuchungen zwecks hinreichender Minimumsereichungshoffnungen
des Ausgleichens von Observanzen; vgl. Konflike des
Zauns der 613-mizwot um die Tora nicht zu
verletzen/übertreten, bis zum Stoppstellenschilder-Aufkommen)]
 Die pistische
Modalität, nach einem bis ‚dem‘ lateinischen Wortfeld für ‚Glaube‘ benannt;
doch weder auf ‚Vertrauen‘ beschränkbar, noch der /emuna(h)/ אמונה im heute üblich gewordenen
Vorstellungshorizont einer ‚vorläufigen Vermutung, die schließlich von gewissem
Besserwissen abzulösen sei‘ gemeint. Die zwar vorgeblich bekannte, doch
überraumzeitliche. Trias der (zumal gegenwärtig
noch kontrafaktischen) Hoffnungen /
Überzeugtheiten (nicht [allein] von
Sätzen / Repräsentationen), bis zwischenmenschlicher (nicht durch Gefolgschaft ersetz- oder
qualifizierbare) Treue / persönlicher (anstatt
allein ‚inhaltlicher‘ und/oder ‚formeller‘) Loyalität/en, Burgfestung
mit dem Hochschloss der ((gar weder allein durch
Achtsamkeiten noch stetes vorbehaltlos qualifizierten) Liebe/n, laufen
nämlich – wenn auch weniger bekanntlich –
gerade nicht etwa zwangsläufig auf deren
vierte, wesentlichste kardinal / göttlich qualifizierte Tauglichkeit der
Weisheit / Intelligenz hinaus. …
Die pistische
Modalität, nach einem bis ‚dem‘ lateinischen Wortfeld für ‚Glaube‘ benannt;
doch weder auf ‚Vertrauen‘ beschränkbar, noch der /emuna(h)/ אמונה im heute üblich gewordenen
Vorstellungshorizont einer ‚vorläufigen Vermutung, die schließlich von gewissem
Besserwissen abzulösen sei‘ gemeint. Die zwar vorgeblich bekannte, doch
überraumzeitliche. Trias der (zumal gegenwärtig
noch kontrafaktischen) Hoffnungen /
Überzeugtheiten (nicht [allein] von
Sätzen / Repräsentationen), bis zwischenmenschlicher (nicht durch Gefolgschaft ersetz- oder
qualifizierbare) Treue / persönlicher (anstatt
allein ‚inhaltlicher‘ und/oder ‚formeller‘) Loyalität/en, Burgfestung
mit dem Hochschloss der ((gar weder allein durch
Achtsamkeiten noch stetes vorbehaltlos qualifizierten) Liebe/n, laufen
nämlich – wenn auch weniger bekanntlich –
gerade nicht etwa zwangsläufig auf deren
vierte, wesentlichste kardinal / göttlich qualifizierte Tauglichkeit der
Weisheit / Intelligenz hinaus. …
 [Götzen sagen immer und zu allem nur ‚Ja‘ – G’tt widerspricht zumal/sogar Vorfindlichem: Gleich gar den
grundstrukturellen Gottesvorstellungen des Mythos:
[Götzen sagen immer und zu allem nur ‚Ja‘ – G’tt widerspricht zumal/sogar Vorfindlichem: Gleich gar den
grundstrukturellen Gottesvorstellungen des Mythos: Etwa es handle sich um
jene allerhöchste der völlig überlegenen / entfernten Allmacht jenseitiger
Mächte über uns Menschen und sonstigen Gegebenheiten, die alles Geschehende
kontrollierend (also [durch richtiges
Wohlverhalten]affizierbar / ‚tauschhändlerisch zu
beeinflussen‘, soweit nicht sogar ‚durchschaubar‘), bis gar willkürlich (also ‚unerklärbar‘ oder gleich ‚beliebig ambivalent
dualistisch‘), zuwiesen würden. Allerdings auch nicht etwa weniger
den Vergottungsvorstellungen des Logos widersprechend: Gott sei ein /das
alleroberste Prinzip der Ordnung, Liebe, Schönheit, Gnade/Güte, Wahrheit Gerechtigkeit,
pp. oder (mancher bis aller)
zusammengenommen. – ‚Ich glaube /
vertraue Dir/Ihnen‘ bleibt nämlich deutlich anders, gar nicht so selten sogar
im Gegensatz zur (allenfalls)
sekundären / abgeleiteten Struktur: ‚Ich halte (vorbehaltlos
alles) für wahr / Liebe was immer Du sagst / Sie tun‘]
 Dem ubd gleucg gar den Menschen ist / wird eine ganze Mege zu wissen möglich – doch um Alles handelt es sich
dabei nichtm allerdungs
mag, bis sollte, es genügen Grenzen(ränder) ders überhaupt
Wissbaren eranhen, bis handgaben, zu können. So
stehen dem Wissbaren
Nichtwissensprinzipien (etwa qualifizierte ‚Gnade‘) gegenüber, die
namentlich was die ‚Sphären‘/Denkballonhüllen qualifuziertr
Weisheit angeht, ‚dem Wissen‘ weder unter- noch übergeordnet – obwohl und
während ‚sich‘, genauer alle Betrachtungsweisen die Wirklichkeiten,
wechselseitig mehr oder minder wechselnd ‚durchringen‘.
Dem ubd gleucg gar den Menschen ist / wird eine ganze Mege zu wissen möglich – doch um Alles handelt es sich
dabei nichtm allerdungs
mag, bis sollte, es genügen Grenzen(ränder) ders überhaupt
Wissbaren eranhen, bis handgaben, zu können. So
stehen dem Wissbaren
Nichtwissensprinzipien (etwa qualifizierte ‚Gnade‘) gegenüber, die
namentlich was die ‚Sphären‘/Denkballonhüllen qualifuziertr
Weisheit angeht, ‚dem Wissen‘ weder unter- noch übergeordnet – obwohl und
während ‚sich‘, genauer alle Betrachtungsweisen die Wirklichkeiten,
wechselseitig mehr oder minder wechselnd ‚durchringen‘. 
 Denn es bleibt des/der Menschen Verstand, ‚der‘ jenes
Ganze / Wirklichkeiten, zu dem / denen ‚er‘ selbst gehört, analytisch in (nicht einmal immer nur ‚kleinere‘ – wie bereits Ihre
Durchlauch das Gespenst mathematischer Unendlichkeiten zeigt/verbirgt)
Teile zerlegt, um begreifend zu verstehen (vgl.
insbesondere C. F. v. Weitzäcker), bis
sich/anderen ursächlich deutend zusammengesetzt zu erklären (vgl. insbesondere Maximilian Weber)
respektive verwenden handhaben zu können.
Denn es bleibt des/der Menschen Verstand, ‚der‘ jenes
Ganze / Wirklichkeiten, zu dem / denen ‚er‘ selbst gehört, analytisch in (nicht einmal immer nur ‚kleinere‘ – wie bereits Ihre
Durchlauch das Gespenst mathematischer Unendlichkeiten zeigt/verbirgt)
Teile zerlegt, um begreifend zu verstehen (vgl.
insbesondere C. F. v. Weitzäcker), bis
sich/anderen ursächlich deutend zusammengesetzt zu erklären (vgl. insbesondere Maximilian Weber)
respektive verwenden handhaben zu können.
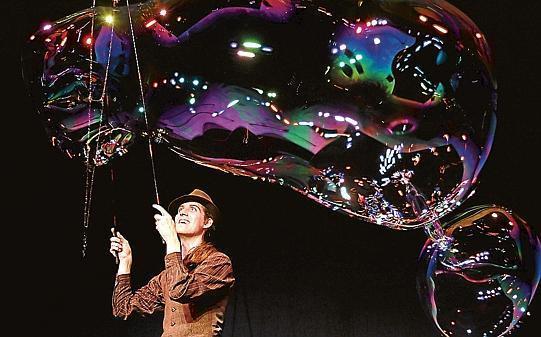 [Aus/In/Gegenüber den Perspektiven der ganzen
Wirklichkeiten: Kuschnerzitat]
[Aus/In/Gegenüber den Perspektiven der ganzen
Wirklichkeiten: Kuschnerzitat] 
Soweit, bisher / immerhin diese ‚Summen‘ – für Daniela und Martin (‚vom/zum‘ 20. August 2017).







|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Kommentare und Anregungen wären jederzeit willkommen: (unter webmaster@jahreiss.eu). |
||
|
|
|
|
by |