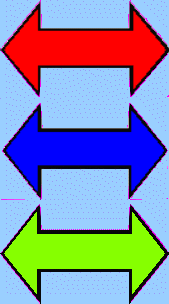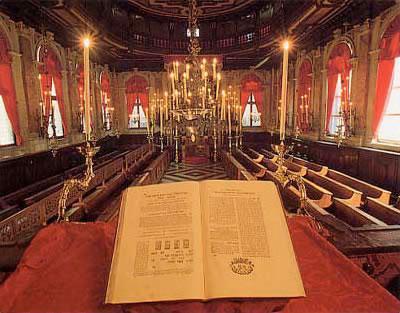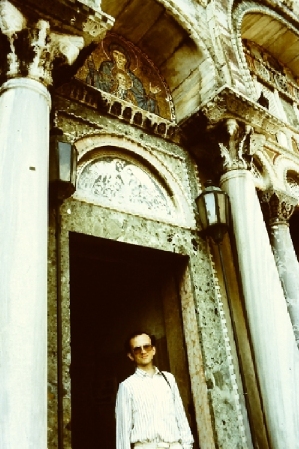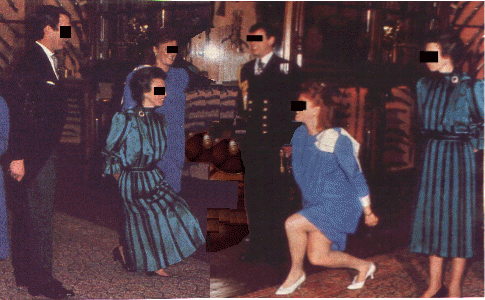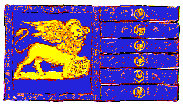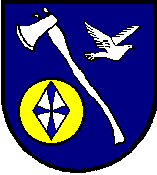![]() Sollte Ihr Monitor bzw. Browser (neben- sowie
untenstehende) úéøáò Hebräische
Schriftzeichen úåéúåà fehlerhaft
darstellen - können Sie hier mehr darüber finden. אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
Sollte Ihr Monitor bzw. Browser (neben- sowie
untenstehende) úéøáò Hebräische
Schriftzeichen úåéúåà fehlerhaft
darstellen - können Sie hier mehr darüber finden. אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
|
Von unter der ersten der drei Josefskuppeln nach Osten, den nördlichen Narthex entlang ‚sehend‘, bis zum Johannes- äh Venezia/Marien-Portal des Querschiffs der ‚goldenen‘ Maekusbasilika, nach der hier vierten, der Moseskuppel. Links ‚neben dem Foto‘ die Piazetta de leonini und rechts ‚davon‘ das St. Pieter Seitenschiff vorstellbar. |
Gleich
drei (bis alle vier ‚nördlichen‘)
Kuppeln und drei (bis immerhin vier der)
Wandbereiche bildern, über
die / von den zehnten, und insofern / strukturell finalen, |
Von unter der ‚Abrahamskuppel‘, im Westnarthex, in Hauptrichtung Norden ‚sehend‘ die ‚erste Josefskuppel‘ über der Ecke mit dem St. Alipius Portal. Piazza di San Marco also links ‚vom‘ und Naos respektive St. Peter Seitenschiff rechts ‚diesseits von dem Foto‘ vorstellbar. |
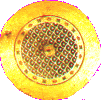 Dass/Falls
erst die Geschichte Josephs/Josefs (ab
Genesis/bereschit
37)
‚den Übergang‘(sic!) von ‚der Vätergeschichte‘ (sic!
eine dem Bibeltext deutend
hinzugefügte ‚Überschrift für‘ / Zusammenfassung von sieben, bis aller neun
vorher stehenden, der anfänglichen zehn /toledot/ eine ‚interne/eigene Gliederungsstruktur‘ des
1. Mosebuches überhaupt; vgl. S.R.K.)
Dass/Falls
erst die Geschichte Josephs/Josefs (ab
Genesis/bereschit
37)
‚den Übergang‘(sic!) von ‚der Vätergeschichte‘ (sic!
eine dem Bibeltext deutend
hinzugefügte ‚Überschrift für‘ / Zusammenfassung von sieben, bis aller neun
vorher stehenden, der anfänglichen zehn /toledot/ eine ‚interne/eigene Gliederungsstruktur‘ des
1. Mosebuches überhaupt; vgl. S.R.K.)
zur
‚Geschichte (sic! – wie ja das
hebräische ![]() so gern
übersetzt wird) Israels‘ (gleich gar rüber mit/zur‚Erwählung Moses‘) bedeute – was
christlichen Theologien nicht gerade selten behagen mag –
muss ja Venezsias
Entscheidungen – gerade diese Teile ausgerechnet so (zumal
‚heimlich‘, ohne Israels-Namensnennung) von ‚dem was aus/von
Jakob geworden‘ seinen /toledot/
so gern
übersetzt wird) Israels‘ (gleich gar rüber mit/zur‚Erwählung Moses‘) bedeute – was
christlichen Theologien nicht gerade selten behagen mag –
muss ja Venezsias
Entscheidungen – gerade diese Teile ausgerechnet so (zumal
‚heimlich‘, ohne Israels-Namensnennung) von ‚dem was aus/von
Jakob geworden‘ seinen /toledot/ ![]() ,
in diesen Arten und Weisen zu repräsentieren / erwähnen / verwenden /
beanspruchen – nicht vollständig / hinreichend erklären / ‚motivieren‘. [#hier Zitate
zu venezianischen Relationen mit der ‚Josefsgeschichte‘]
,
in diesen Arten und Weisen zu repräsentieren / erwähnen / verwenden /
beanspruchen – nicht vollständig / hinreichend erklären / ‚motivieren‘. [#hier Zitate
zu venezianischen Relationen mit der ‚Josefsgeschichte‘] 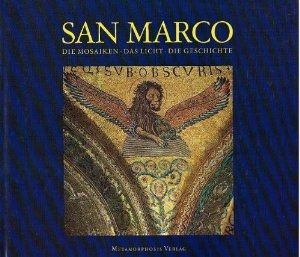
[O.G.J.‘s Mind-Map-Inhalte / Debatte der ‚Josefsgeschichte‘ aus Synagogegesprächen
von und mit Michael Shashar (Schereschewsky)
1997 und musivische Motive aus San Marcos Atrium zu Venedig. – Zumal
‚gegenüber‘ Mosaik-Aufnahmen und
Textteilen aus Genesis/bereschit/1.Mose 35, 37-46 von
Helmuth Niels Lose mit Überlegungen von Gisela Hellenkemper
Salies 1987]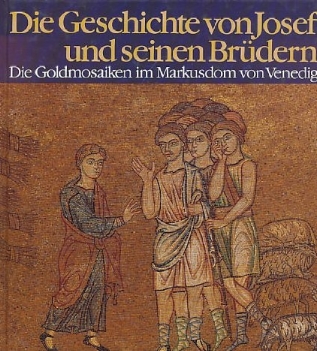 „Tief ist der
Brunnen der Vergangenheit, sollte man ihn nicht unergründlich nennen?“ (fragt
ja immerhin Thomas Mann in ‚Josef und seine Brüder‘)
„Tief ist der
Brunnen der Vergangenheit, sollte man ihn nicht unergründlich nennen?“ (fragt
ja immerhin Thomas Mann in ‚Josef und seine Brüder‘)
G.H.S. bemerkt (in ihrem Nachwort) u.a. die
uns so gegenwärtig vertraut erscheinende Nähe zu den / Nachvollziehbarkeiten
der (bereits/als/seit ‚schon vor langer Zeit‘) geschilderten Ereignisse/n. „So nimmt nicht wunder, daß die Josefsgeschichte durch die Jahrhunderte lebendig [sic!] blieb und in Literatur und bildender Kunst immer wieder
behandelt wurde. Dabei geriet das biblische Grundthema [sic!] der Erzählung - die göttliche Lenkung al1er Verirrungen
menschlicher Schuld zu einem gnädigen Ende - ebenso in den Hintergrund wie die Frage
nach dem historischen Umfeld,“ - „In der christlichen Auslegung […] verstand man das Schicksal [sic!]
Josefs als Gleichnis der Passion und Auferstehung Christi[sic!]: Wie Josef vom Vater zu den Brüdern
gesandt wurde, so Jesus zu den Menschen [sic! Zumindest aus jüdischer Perspektieve
/ Erfahrung eine eher ‚verharmlosende‘ Darstellungsweise, häufig wesentlich
schärfer bis bösartig kontrastierter Diskriminierung mancher; O.G.J.].
Josef wurde ebenso [sic!] wie Jesus von seinen Brüdern
verraten und sogar verkauft. Die Erhöhung Josefs zum Herrscher in [sic!] Ägypten wies
hin auf die Auferstehung und den Triumph Christi[sic!]. Josef als Retter seines Volkes [sic! immerhin 70 Seelen
Exodus/schemot 1:5]
entsprach Christus als Retter der Menschheit.“ Was zwar für die christliche
Literatur von großer, umfänglich thematisierter, Bedeutung [zumindest] gewesen
sei, nicht aber in der Bildenden Kunst der Spätantike und des Mittelalters, wo
diese Geschichte nur ‚rein‘ narrativ erzählend dargestellt – scheinbar, bis
angeblich, nicht gedeutet – worden sei. Gerade diese Auffassung verkennt,
durchaus mit G.H.S. selbst, allerdings
all jene, durchaus nicht alternativlosen künstlerischen,
Darstellungsentscheidungen, die namentlich vom
sogenannten ‚idiomatic/iconograpgic
turn‘ der Philosophie
/ Kunstgeschichte bemerkt werden. Nicht etwa
weniger als ‚verbalsprachliche Bilder‘ erweisen sich auch und gerade ‚optische
Darstellungen (auch Fotographie und Film, live-stream pp.) als nicht
etwa neutrale, nebensächlich oder gar besonders ‚wahre/authentische‘ – doch gleichwohl als besonders wirkmächtige – Illustrationen. Zu
den spezifisch venezianischen Anspielungen und Vereinnahmungen speziell dieser Geschichte für Serenissima
Selbstverständnis kommt/gehört auch, dass/wo sie so gut und allgemein
verbreitet bekannt (jedenfalls war) auf eher vereindeutigende,
weitergehende, Interpretationen
verzichten zu können, und zu wollen, bis zu vermeinen. [Dem gegenüber werden
sich hier wohl etwas ausführlichere Textauszüge, als die durchaus Beschriftung
der Mosaiken, manchmal nicht vermeiden lassen – gleichgar da/wo deren
Übersetzungen bereits unvermeidlich, bis absichtlich oder gar kaum bemerkt,
deutend und Deutungen sind, und aufzeigen mögen.]
Eine der ausführlichsten. musivischen Bearbeitungen befinde
sich jedenfalls in der Vorhalle von San Marco zu Venedig. „Den Darstellungen
aus dem Leben [sic!] Josefs sind drei Joche der Vorhalle
gewidmet. In etwa 40 Szenen werden in den Kuppeln, in Lünetten und Wandnischen
die Ereignisse von Josefs Jugend bis zu seinem Wiedersehen mit Benjamin in
Ägypten erzählt.“
Bei aller Treue der Künstler des 13. Jahrhunderts zu den
Bild-Vorlagen (namentlich der Cotten-Genesis)
„konnten [sic! bis
s/wollten gar eher; O.G.J.]
sie ihre eigene künstlerische Handschrift nicht völlig verleugnen, die sich im
Laufe der langwierigen Arbeiten in der Vorhalle immer stärker ausprägte und
besonders in der zweiten und dritten Josefskuppel
deutlich faßbar“ werde.
Bbbbbbb [Rnde
Nachwortzitate?]
„Die Josefsgeschichte von San
Marco beginnt in der Kuppel des Eckjoches der Vorhalle. Zwölf Szenen folgen am
Kuppelrand friesartig aufeinander (Abb. 3 [des Buches]). Ein doppeltes
Schriftband mit lateinischen Erklärungen schließt den Figurenfries oben ab. Der
ganz mit Goldglaswürfeln ausgelegte
Grund der Kuppel hebt die Darstellungen in eine übernatürliche, entrückte
Sphäre.
Den Scheitelpunkt der Kuppel betont
ein rundes Omamentfeld. [Abb.]
Thema der ersten Josefskuppel
sind die Ereignisse aus Josefs Jugend in Kanaan. Den Anfang bilden, in einer
Szene zusammengezogen, die beiden Träume Josefs, die den Haß
der Brüder unheilvoll schüren sollten (Abb. 4). Neben dem schlafenden Josef
sind die elf Garben der Brüder liegend vor der aufrechten zwölften Garbe
dargestellt, eine Vereinfachung gegenüber dem Text der Bibel, dem zufolge die
sich neigenden Garben der Brüder die des Josef umringen. Am oberen Rand der
Szene weist ein Himmelssegment mit Sonne, Mond und elf Sternen auf den zweiten
Traum Josefs.
Die Brüder, denen Josef von seinem
Traum berichtet (Abb. 5), sind als dichtgefügte Gruppe wiedergegeben.
Die Unterhaltung mit Josef führt,
der Gestik nach zu urteilen, der vordere, durch einen Bart hervorgehobene
Bruder, in dem wohl Ruben, der Älteste, zu erkennen ist. Die vornehme Kleidung
Josefs - Hinweis auf den ,bunten Rock' des Bibeltextes
- hebt sich von den einfachen Hirtengewändern der Brüder ab. Derselbe Gegensatz
zwischen dem für sich stehenden, reich gekleideten Josef und der Gruppe der
Brüder kennzeichnet auch die Szene, in der Josef dem Vater und den Brüdern
seinen zweiten Traum erzählt (Abb. 6). Jakob sitzt in herrscherlicher
Haltung auf einem Thron, dessen verziertes Polster Ruhen ehrerbietig
zurechtrückt, ein genrehaftes Detail das vermutlich
von den Künstlern des 13. Jahrhunderts eingeführt wurde.
Auf die Begegnung mit dem Mann, der
Josef in Sichem den Weg zu den Brüdern weist (Abb.
7), folgt das Treffen mit den Brüdern, die bei Dotan
die Herden weiden.
Die spannungsgeladene Atmosphäre
dieser Begegnung kommt in den finsteren Mienen der Brüder zum Ausdruck, die den
in seinen ,bunten Rock' gekleideten Josef schon von
ferne erblicken. Der sich in der Gewalttat entladende Haß
der Brüder ist auf das Bild 8 verkürzt, wo drei der Brüder den nackten wehrlosen
Josef in den Brunnen hinabstoßen. Die nach der Tat noch andauernde Erregung
äußert sich in den heftigen Gebärden der Brüder beim anschließenden Mahl. In
der oberen Bildhälfte ziehen die midianitischen
Kaufleute auf ihren Kamelen heran, Die goldgestreiften, den Oberkörper
freilassenden Gewänder, die Stirnbinden und die goldenen Armreifen betonen die
fremdartige [sic!] Erscheinung der dunkelhäutigen Midianiter
(Abb. 10).
Nachdem die [sic! eben nicht alle gemeinsam; O.G.J.] Brüder Josef wieder aus dem Brunnen herausgezogen haben
(Abb. 9), verkaufen sie ihn an die fremden Händler, die als Kaufpreis ein
Geldsäckchen überreichen. Anschließend brechen sie mit Josef nach Ägypten auf
(Abb. 11) Die letzten Szenen der Kuppel zeigen die Trauer und Verzweiflung
Rubens, der den Brunnen leer findet (Abb. 12), und Jakobs, dem das
blutbefleckte Gewand Josefs gezeigt wird (Abb. 13). Beide sind mit an der Brust
zerrissenem Gewand und emporgeworfenen
Armen dargestellt.
Bbbbbbbb
Die Josefsgeschichte
nimmt im anschließenden Joch der nördlichen Vorhalle ihren Fortgang. Schon auf
den ersten Blick zeigt sich in der bildnerischen Gestaltung der Mosaiken ein
Gegensatz zur ersten Kuppel. Die Anordnung der Friese am Kuppelansatz ist zwar
gleich, doch die Figuren der zweiten Kuppel sind deutlich höher, das
Schriftband ist breiter und das ornamentale Zentralmedaillon größer (Abb. 20).
Entsprechend ist der Goldgrund weniger dominant. Eine starke Farbigkeit mit
lebhaften und sehr intensiven Tönen steigert [G.H.S.,
S. 77] den Gegensatz zur ersten Kuppel. Die einzelnen Szenen sind breiter und
detailreicher, so daß in der zweiten Kuppel nur neun
Szenen gegenüber zwöf in der ersten Platz finden. Die
Gewänder sind reicher und bewegter, Haltung und Ausdruck der Figuren
differenzierter.
Ganz offensichtlich haben die
Künstler dieser Kuppel bei der Wiedergabe der spätantiken Vorbilder dem
Stilempfinden ihrer eigenen Zeit stärker nachgegeben [sic! waren zumindest entstehungszeitlich weiter davon
entfernt; O.G.J.]. Eine größere Unabhängigkeit gegenüber
der Vorlage macht sich besonders in den phantasievollen
Hintergrundarchitekturen bemerkbar.
In sechs Szenen der Kuppel wird in
großer Ausführlichkeit das Leben Josefs im Haus des Ägypters Potiphar dargestellt, von seiner Ankunft (Abb. 14) über seinen
Aufstieg zum Verwalter (Abb. 15), die Versuchung durch Potiphars
Weib (Abb. 16), seine Flucht vor ihr (Abb. 17), seine Verleumdung durch die
abgewiesene Frau (Abb. 18) bis zu seiner Verurteilung durch Potiphar
(Abb. 19). Die letzten Szenen der Kuppel zeigen das Urteil des Pharao über den
Bäcker und den Mundschenk (Abb. 21), die Träume der beiden Verurteilten (Abb.
22) und die Deutung ihrer Träume durch Josef (Abb. 23).
bbbbb
In den Pendentifs wird die
Geschichte fortgesetzt: Entsprechend der Weissagung Josefs ist der Mundschenk
wieder in sein Amt eingesetzt und wartet dem Pharao auf (Abb. 24), der Bäcker
aber wird gekreuzigt (Abb. 25).
Der Traum Pharaos von den sieben
fetten und den sieben mageren Kühen ist auf zwei Pendentifs verteilt (Abb.
26/27). Beide Mosaiken wurden im 19. Jahrhundert neu gesetzt und können sich in
der künstlerischen und technischen Qualität nicht mit den Arbeiten des 13.
Jahrhunderts messen. Ein Vergleich mit der thematisch wie ikonographisch sehr ähnlichen Darstellung von Pharaos zweitem Traum in der
gegenüberliegenden Wandlünette - der Traum von den sieben vollen und den sieben
dürren Ähren (Abb. 28) - zeigt deutlich diesen Qualitätsunterschied.
In den Mosaiken der Wandlünette -
oben der zweite Traum des Pharao, darunter die drei ägyptischen Traumdeuter vor
dem thronenden Herrscher (Abb. 29) und der Mundschenk, der dem Pharao von
Josefs Traumdeutungen erzählt (Abb. 30) - ist ein Höhepunkt technischen und
bildnerischen Könnens erreicht.
Das plastische Volumen der Figuren,
die fein abgestuften Schattierungen der Gewänder, Ausdruck und Haltung der
Dargestellten finden in den älteren Mosaiken der westlichen Vorhalle nichts
Vergleichbares.
Wie groß die technische
Überlegenheit und der Unterschied in der künstlerischen Konzeption gegenüber
der ersten Josefskuppel ist, offenbart der Vergleich
zwischen den Szenen der Traumdeuter vor Pharao (Abb. 29) und den Midianitern bei Josefs Brüdern (Abb. 9/10), einer der
reichsten Szenen der [ersten] Kuppel.
Die Unterschiede zwischen den
Mosaiken der ersten Josefskuppel und denen im
anschließenden Joch des nördlichen Flügels lassen auf eine längere
Unterbrechung der Mosaikarbeiten schließen, die vielleicht eine Generation lang
andauerte. Der Anlaß für diese Unterbrechung ist uns
nicht bekannt. Als man nach einiger Zeit die Arbeiten wieder aufnahm, hatten
nicht nur die ausführenden Künstler gewechselt, sondern auch die Einstellung
gegenüber der Aufgabe[sic!],
die spätantiken Vorbilder angemessen wiederzugeben.
Bei der Darstellung der Geschehnisse
im Hause Potiphars oder am Hofe des Pharao fällt auf,
daß Kleidung und Aussehen der Ägypter in keiner Weise
der Zeit der geschilderten Ereignisse angepaßt sind.
Der Spätantike, in der die Miniaturen der Vorlage geschaffen wurden, war eine
solche historisierende Einstellung fremd. Man hatte weder den Wunsch noch das
Wissen, einen Ägypter des 2. Jahrtausends vor Christi Geburt realistisch
abzubilden; vielmehr stellte man die Handelnden als Zeitgenossen dar. Dies tat
man um so unbefangener, als
es nicht um die Wiedergabe historischer Ereignisse ging, sondern um ein
Geschehen von zeitloser Bedeutung.
Die Venezianer übernahmen die
spätantike Bildersprache. Die Kontinuität der byzantinischen Tradition, die auf
die venezianisehe Tradition eingewirkt hatte, ließ
dem Betrachter das Dargestellte zwar nicht als fremd erscheinen, rückte es aber
noch stärker in eine zeitlose, vom Alltäglichen [sic!]
abgehobene Sphäre.
Trotzdem [sic!] scheuten sich die mittelalterlichen
Künstler nicht, zeitgenössische Details einzubringen, wie etwa die gotische
Fensterrosette (Abb. 24) oder die Krone des Pharao (Abb. 21).
Das erste Auftreten Josefs vor
Pharao, seine Deutung von dessen Träumen und seine Berufung zum Reichsverweser
hatten ihren Platz in der Apsis dieses Joches, sind aber im 17. Jahrhundert
durch ein völlig neu entworfenes Mosaik ersetzt worden.
bbbbb
Der Zyklus des 13. Jahrhunderts
nimmt in der Kuppel [G.H.S., S. 78} des anschließenden
Joches seinen Fortgang. Der Figurenfries der dritten Josefskuppel
(Abb. 31) ist streng symmetrisch aufgebaut: Die eine Hälfte der Kuppel enthält
vier Szenen, in denen das Wirken Josefs als Würdenträger in Ägypten dargestellt
ist, in den vier Szenen der zweiten Hälfte wird die Aussendung der Brüder nach
Ägypten und ihre Begegnung mit Josef geschildert.
Zwei Szenen der ersten Hälfte sind
den Ereignissen der ,fetten', zwei denen der ,mageren'
Jahre gewidmet. Die Pyramiden, die in der ersten und letzten Szene dieser
Hälfte den Schauplatz von Josefs Wirken anzeigen, trennen zugleich beide Teile
optisch voneinander ab.
Zu Beginn des Frieses wird Josefs
Vorsorge für die geweissagten Hungerjahre gezeigt (Abb. 32): Unter seiner
Aufsicht sind drei Arbeiter damit beschäftigt, einem vierten, der sich in einer
Pyramide befindet, Komgarben anzureichen. Zwischen
den vorderen drei Pyramiden werden die Spitzen von zwei Stufenpyramiden im
Hintergrund sichtbar. Aus der Darstellung ergibt sich, daß
die Pyramiden hier nicht als Begräbnisstätten der Pharaonen verstanden sind,
sondern als Kornspeicher. [sic! Eine
auch für und in Venedig derat zentral wichtige
Angelegenheit, dass der Getreideeicher das Stadtbild
von San Marco jahrhundertelang prägte; O.G.J.] Die
Deutung der Pyramiden als die von Josef errichteten Vorratshäuser geht auf eine
Legende zurück, die sich seit frühchristlicher Zeit nachweisen läßt.
Das nächste Bild faßt
private Begebenheiten dieser Jahre in Josefs Leben zusammen. Josef betritt
seinen Palast, in dem Asenath, seine ägyptische
Gemahlin, auf einem kostbar verzierten Bett ruht (Abb. 33). Vor dem Bett steht
ein Tischchen mit Erfrischungen. Eine Dienerin hält Josef den neugeborenen
Ephraim entgegen; der Erstgeborene, Manasse,
erscheint reich gekleidet im Vordergrund.
Eine eindrucksvolle und bewegte
Szene steht am Anfang der Ereignisse in den Dürrejahren (Abb. 34). Josef, als
Würdenträger auf einem Podest stehend, wird von einer bewaffneten Leibgarde
gegen die aufgebrachten Ägypter abgeschirmt, die Korn fordern. [sic! Auch Venzias Würdentrger wurden bei Bedarf und manche wie der Doge und
Mitglieder des sogenannten ‚Zehnerrates‘ ständig, von bewaffneten
Militäreskorten begletet; O.G.J.] Ein ungewöhnlich weiter Abstand kennzeichnet den Gegensatz
zwischen den Herrschenden und dem hungernden Volk.
Die Kornverteilung aus den
angehäuften Vorräten (Abb. 35) bildet den Abschluß
der Darstellungen in der ersten Hälfte der [dritten] Kuppel. Der thronende
Josef ist wiederum von Bewaffneten umgeben. Während Josef in den Jahren des
Überflusses von einem waffenlosen Gefolge begleitet war (vgl. Abb. 32), tritt
während der Hungerjahre eine bewaffnete Garde auf - ein realistischer Hinweis
auf die politischen Spannungen der [sic!
bis eben jeder derartigen Krisen-]Zeit.
Josef erscheint, verglichen
mit seiner jugendlichen Gestalt in den frühen ägyptischen Jahren, in dieser [den Zyklus abschließenden]
Kuppel als gereifter, bärtiger Mann.
Die zweite Hälfte des Kuppelfrieses
wird von der Begegnung mit den Brüdern bestimmt. Der grauhaarige,in einem Nischenbau thronende Jakob schickt seine Söhne
nach Ägypten, um dort Korn für die hungernde Sippe in Kanaan zu kaufen (Abb.
36). Wieder ist es Ruben, der Älteste, der die Unterhaltung führt. Der ufbruch der Brüder und ihre Ankunft in Ägypten sind im
Mosaikzyklus nicht dargestellt. Auf die Aussendung folgt unmittelbar die
Beschuldigung der Brüder als Spione und die Ergreifung des vordersten durch
ägyptische Soldaten (Abb. 37).
Zu den Schlüsselszenen der Erzählung
gehört das Schuldgeständnis der Brüder, die ihre Einkerkerung durch den
vermeintlichen Ägypter, in dem sie ihren Bruder noch nicht wiedererkennen, als
gerechte Strafe Gottes für ihr Verbrechen an Josef begreifen. In Gestik und
Haltung drückt sich ihre Reue und Verzweiflung aus. Josef wendet sich voll
innerer Bewegung ab und trocknet mit dem Gewand seine Tränen. Der Knabe, der
zwischen Josef und der Gruppe der Brüder steht, ist vermutlich Manasse, Josefs Erstgeborener, der einer jüdischen Legende
zufolge von Josef zum Dolmetscher bestellt war
(Abb. 38). Die Ergreifung Simeons als Geisel bildet den Abschluß
des Kuppelfrieses (Abb. 39).
bbbbb
Die letzten Szenen des Josefszyklus befinden sich auf der Wandlünette dieses
Vorhallenjoches (Abb. 40). Zunächst wird die Rückkehr der Brüder nach Kanaan
geschildert, wie sie ihre Säcke, in die
Josef die Geldbeutel hat hineinlegen lassen, vor Jakob ausleeren (Abb. 41).
Unter diesem Bild reihen sich drei
weitere Szenen aneinander:
Die Einwilligung Jakobs zur Reise
Benjamins nach Ägypten (Abb. 42), der Aufbruch zur zweiten Reise der Brüder
(Abb. 43) und ihre Ankunft vor Josefs Haus (Abb. 44). Hier bricht die Josefsgeschichte ab.
Der abrupte Schluß
entspricht sicher [sic!]
nicht der ursprünglichen Konzeption. Die Cotton-Genesis enthält nach der Szene
mit Benjamin vor Josefs Haus noch etwa 40 weitere Miniaturen. Vermutlich sollte
zunächst die gesamte nördliche Vorhalle der Josefslegende
vorbehalten bleiben. Aus uns unbekannten [sic!
die Urkunden scheinen verloren, gleichwohl mögeimmerhin einige theologische Beweggründe einer möglichen Debatte naheliegen: So enden weder die
‚Geschichte/Herborbingungen Jakobs/Israels‘ in
Ägypten noch eine ‚Heilsgesichte‘; die Ansprüche christlicher Deutungen – gleich gar Subsituitionslehren
– beziehen sich/Jesus derart basal auf Mose und die Tora,
dass wohl kaum ernstlich vollständig darauf verzichtet werden sollte, sich
diese wenigstens soweit anzueignen ;
O.G.J.] Gründen entschloß
man sich jedoch zu einer Programmänderung [G.H.S., S. 79] und widmete das letzte Joch der Geschichte des Moses.
Die Mosaiken der dritten Josefskuppel und der zugehörigen Wandlünette bilden den
künstlerischen Höhepunkt des gesamten Mosaikzyklus in der Vorhalle.
Gegenüber der Vorlage, den
spätantiken Miniaturen, sind in diesem Abschnitt die stilistischen und
ikonographischen Abweichungen am größten - Weichfallende, üppig drapierte
Gewänder betonen die naturnahe Körperlichkeit der Figuren. In Körperhaltung,
Gebärden und Mimik kommen die unterschiedlichen seelischen Situationen zum
Ausdruck. Charakteristisch ist die liebevolle Ausmalung genrehafter Szenen,
etwa das Einlagern oder das Austeilen des Korns (Abb. 32, 35). Die Farbpalette
ist reich, aber weniger grell als in der zweiten Kuppel, die Gesamtwirkung
erscheint harmonischer. Im Gegensatz zu den älteren Mosaiken der Vorhalle, wo
die Figuren frei vor dem Goldgrund schweben, stehen in der dritten Josefskuppel alle Figuren in einem durch Geländestreifen
und Bauten umgrenzten Raum. Die spätantike Vorlage, die zu Beginn der Arbeit
die Mosaiken stark prägte, hat in dieser Kuppel viel von ihrer
Vorbildhaftigkeit [sic!]
eingebüßt.“
Zzzz #jojo
„Den Anstoß zur Ausschmückung der Vorhalle von San Marco mit
einem kostbaren Mosaikzyklus gab die Eroberung Konstantinopels durch Vendig und das Heer der Kreuzfahrer im Jahre 1204. Der Sieg
über das Byzantinische Reich ließ Venedig zur beherrschenden Macht im
Mittelmeer werden. Grenzenloser [sic!]
Reichtum floß in die Stadt. Die Kirche des heiligen
Markus, Palastkapelle des Dogen und Staatskirche der Serenissima, führte in
ihrer Pracht den Bürgern wie der übrigen Welt den Rang der siegreichen Republik
vor Augen. Die Mosaikarbeiten in der Vorhalle begannen bald nach der Eroberung
Konstantinopels, um 1220 war die erste Kuppel fertiggestellt. Der Abschluß des Josefszyklus
erfolgte jedoch nicht vor dem späten 13. Jahrhundert. Dieser Zyklus
beanspruchte den größten Raum in der Vorhalle. […] Ägypten, der Schauplatz der meisten Szenen,
hatte einen besonderen Bezug zu Markus, dem Patron der Kirche und des Staates.
Aus Ägypten hatten die Venezianer den Leichnam des Apostels geraubt, der als
Bischof in Alexandria das Martyrium erlitten hatte. Dem gläubigen [sic!] Betrachter der Mosaiken offenbarte sich so ein enges Band
zwischen der alttestamentlichen [sic!] Herrschergestalt
des Josef und dem mächtigen Schutzheiligen der Stadt.“ (G.H.S., S. 80)
#olaf
MMP-Mind Map O.G.J., mit Mi.Sh.
Synagoge
Genesis Kapitel 35
Problemstellungen / Methodisches bei/mit Mi.Sh.
den ‚Wissenschaft versus Religion‘ sowie (bis also;
O.G.J.) ‚Prädestination
vs. verantwortliche Willensfreiheit‘ interessieren. Unterschiede bemerkend
/ beschreibend zwischen
|
‚anthropozentrischer Auffassung (gar ‚christlichem‘ – insoweit Juden gleichwohl weder
unbekanntem, noch von/bei/unter ihnen etwa vollständig überwundenes oder
verworfenes [O.G.J.] – Paradigma) |
|
‚teleozentrischer Auffassung (gar eher ‚jüdischem‘ Paradigma)‘. |
|
Frage nach
dem Wesen Gottes (implizit: ihn
zwangsläufig vermenschlichend). Fragen nach
der (weit) entfernten
Zukunft (Messias etc.). Verdacht:
Flucht vor der Gegenwart |
|
Interesse
daran, welche Beziehung der Mensch zu Gott hat? Fragt nach
der Bewältigung des Jetzt, kümmert sich
vorwiegend/hauptsächlich um irdische Dinge und Ereignisse. |
An/Als
Gemeinsamkeit unter (ohnehin schwer exakt definierbaren) Juden erkennt und betont Mi. Sh.
eben nicht Inhalte der Gedanken über Gott und Bibel gleich zu haben/machen: Vielfalt
und Widersprüche sind (hinsichtlich der Gedanken) vorhanden und zulässig. – Sondern Verpflichtung auf gleiche [MiTZWoT] Gebote/das Gesetz [ToRaH],
implizit: hinsichtlich der Taten gibt es Regelungen/Gemeinsamkeiten (unter/der Juden – mit den Herausforderungen deren Zustandekommen,
Durchführung, Beurteilung etc. betreffend).
‚Ich glaube[sic!] an Gott‘ (vgl. ‚Ich fürchte G-tt‘) sagt alles
– oder: vielmehr (so gut wie) Nichts. Die
Frage ist, vielmehr ‚wie sieht das aus, äußert sich das?‘
- Die Antwort des Judentums:
'Halten seiner Thorah' Was das aber tagtäglich
konkret bedeutet, ist jeden Morgen von neuem die Frage; der der Referent dann eben in Jerusalem nachgehen werde.
Mi.Sh. untersucht ‚Besonderheiten, Ungewöhnliches bzw.
nicht-Zwingendes an/im Text‘. – Motto: „dies (was
im Text berichtet wird) war doch nicht die einzige (denkbare) Möglichkeit (des/fürs Geschehen/s).“ Dazu
gehören, und dahinter stehen, auch die (nicht etwa
allein, oder erst) rabbinischen Methoden
der Thora-Auslegungen, zumindest des hermeneutischen
‚Vierweges‘ mit- bis gegeneinander wechselwirkender פרד״ס PaRDe‘‘S-Aspekte jeglichen
Textverständnisses: ![]() Der ‚Ebene‘ des (gar ‚schwarz brennenden‘) ‚Wortlautes‘ der Geschichte ‚an sich‘ פשט /pschat/ (zwar
nicht ‚einfach‘ ohne [gar auf Rückseite weiß] grammatikalisch geformte / ‚silbern
verpackte(gefasste‘, bis gar ‚gerematrisch
abgesonderte‘, Umgebungskontexte
der/an umfänglicheren ‚Exformation/en‘, doch zumal
diese nicht notwendigerweise überhaupt, als solche, bemerkend/respektierend,
oder aber als ‚selbstverständlich allgemeinverbindlich eindeutig singulär allen
alternativlos kontrastklar offensichtlich
objektiv konsensfähig bekannt, also gar unwichtig, reduzier- bis
einsparbar / unhöflich belästigende analytische Zumutung/Komplexe‘
unterstellend);
Der ‚Ebene‘ des (gar ‚schwarz brennenden‘) ‚Wortlautes‘ der Geschichte ‚an sich‘ פשט /pschat/ (zwar
nicht ‚einfach‘ ohne [gar auf Rückseite weiß] grammatikalisch geformte / ‚silbern
verpackte(gefasste‘, bis gar ‚gerematrisch
abgesonderte‘, Umgebungskontexte
der/an umfänglicheren ‚Exformation/en‘, doch zumal
diese nicht notwendigerweise überhaupt, als solche, bemerkend/respektierend,
oder aber als ‚selbstverständlich allgemeinverbindlich eindeutig singulär allen
alternativlos kontrastklar offensichtlich
objektiv konsensfähig bekannt, also gar unwichtig, reduzier- bis
einsparbar / unhöflich belästigende analytische Zumutung/Komplexe‘
unterstellend); ![]() der Hinweise (gar Teile, gleich alle/r Torah) darin und darauf, zumal in/aus unseren gegenwärtig betreffenden (einander zwar teils – sozial-(psycho-)logisch, zumal kulturell,
geschlechtlich, situativ etc. – überlappenden, doch längst nicht etwa [erst
recht mehrsprachlich / ‚allsprachlich‘ nicht] deckungsgleich/komplementär
übereinstimmenden), und uns(anderen (bestenfalls
unvollständig, zumal verschieden) überlieferten,
‚Erlebniswelten‘ רמז /remez/;
der Hinweise (gar Teile, gleich alle/r Torah) darin und darauf, zumal in/aus unseren gegenwärtig betreffenden (einander zwar teils – sozial-(psycho-)logisch, zumal kulturell,
geschlechtlich, situativ etc. – überlappenden, doch längst nicht etwa [erst
recht mehrsprachlich / ‚allsprachlich‘ nicht] deckungsgleich/komplementär
übereinstimmenden), und uns(anderen (bestenfalls
unvollständig, zumal verschieden) überlieferten,
‚Erlebniswelten‘ רמז /remez/; ![]() der mit predigend-fordernden
Auswahlentscheidungen für Deutungen / Auslegungspforten verfolgten derzeitigen (Verhalten-beeinflussungs-)Absichten דרש /darasch/;
der mit predigend-fordernden
Auswahlentscheidungen für Deutungen / Auslegungspforten verfolgten derzeitigen (Verhalten-beeinflussungs-)Absichten דרש /darasch/; ![]() sowie
gerade/nur hinsichtlich ihrer überhaupt Offenlegung / mancher Erkenn- bis sogar
Berührbarkeit/en – zumal ‚kontemplativ‘ אחד /‘echad\‘axad/ vollständig/vollkommen erahnbar – ‚geheimnisvoll sichtbar verborgen‘ daran, dahinter, darum,
dazwischen, darin, daneben (vgl.
griechisch / aristotelisch ‚metata‘) und/also ‚dimensional
darüber‘ gegebenen, doch ganz erheblichen, ‚unüberschaubar mithin ‚geheim( ergreifen /
betreffen könnend)en Rest(s)‘ סוד /sod/, ‚jenseits‘ des davon/wozu
Verwendeten / Angeeigneten.
sowie
gerade/nur hinsichtlich ihrer überhaupt Offenlegung / mancher Erkenn- bis sogar
Berührbarkeit/en – zumal ‚kontemplativ‘ אחד /‘echad\‘axad/ vollständig/vollkommen erahnbar – ‚geheimnisvoll sichtbar verborgen‘ daran, dahinter, darum,
dazwischen, darin, daneben (vgl.
griechisch / aristotelisch ‚metata‘) und/also ‚dimensional
darüber‘ gegebenen, doch ganz erheblichen, ‚unüberschaubar mithin ‚geheim( ergreifen /
betreffen könnend)en Rest(s)‘ סוד /sod/, ‚jenseits‘ des davon/wozu
Verwendeten / Angeeigneten.
«Methoden
der Rabbinen bei ihrer Auslegungsarbeit:
1)
Pilpul = Streitgespräch Vgl.
die zahlreichen Streitgespräche Jesu.
2)
Maschal = Gleichnis Vgl. die
echten Gleichnisse Jesu.
3)
Halacha = Anweisung, Anordnung
Vgl. Teile der Bergpredigt u.a. Lehrstücke.
4)
Haggada = Erzählung oder Legende
mit
zu deutendem Inhalt Vgl. Geschichten Jesu, meist unberechtigt zu den
Gleichnissen gezählt (Barmh.Samariter).
Hermeneutische
Auslegungsregeln für Mischna und Talmud:
Die sieben Regeln aus der Zeit Hillels I,
die ihm zugeschrieben werden:
1) Schluß 'vom Leichteren zum Schwereren (Wenn schon..dann erst recht . ... ).
2) Schluß durch Analogie (in diesem Fall ...,
deshalb auch in jenem Fall ...)
3) Aus einer
Stelle abgeleitetes
Prinzip auf inhaltlich verwandten Fall angewandt.
4) Aus zwei
Stellen abgeleitetes
Prinzip auf weitere inhaltlich verwandte Fälle angewandt.
5) Das Allgemeine wird durch das Besondere näher bestimmt, aber auch
umgekehrt: das Besondere
wird durch einen Beleg, der an sich Allgemeines enthält, gedeutet.
6) Eine
Stelle wird durch
eine andere erläutert, die ähnliche Folgerungen enthält.
7) Eine Einzelstelle
wird erklärt, indem man sie vom
Zusammenhang her interpretiert.
Die
dreizehn Regeln des Ismael
ben-Elisa: Sie schließen sich an die
Hillel-Regeln an, sind aber ausführlicher und betonen stärker den Wortsinn, den auch der
einfache Torahörer verstehen kann, da die Tora in der
"Menschensprache redet“
(So betont auch Mar ben-Rabina gegen Raw Kahana den Wortsinn).
Die
entgegengesetzte Methode des Rabbi Akiba:
Die
Tora soll Wort für Wort und Buchstabe für Buchstabe
auf ihre "geheime
Bedeutung" untersucht werden, also auch allegorisch ausgelegt werden, da sich
ihre Sprache von der
"Menschensprache deutlich
unterscheidet" und
göttliche Geheimnisse verbirgt. Diese hermeneutische
Richtung ermöglicht später die mystische und kabbalistische Arbeit.» (Aus: K. Hartmann. Atlas-Tafei-Werk
zur Geschichte der Weltreligionen III. © Ouell
Verlag. Stuttgart 1990, S. 48; optische Umrahmungen, Unterstreichungen und weitere, sorgsame Formatierungen
dieses Autors nicht vollständig wiedergeben)
Genesis Kapitel 37 - Der Verkauf
Josephs nach Ägypten
Mi. Sh.‘s
Frage/Interesse: Erster (erwähnter) Störfaktor des Verhältnisses Joseph vs. Brüder?
Prämisse: Eltern sollen ihre Kinder
gleich lieben
Jakob (da erfahren) konnte, ja
müsse, etwas geahnt haben vom Spannungsverhältnis zwischen den Brüdern und
Joseph
Joseph antwortete "Hier bin
ich"
Warum denken die Brüder gleich an Tötung?
Warum zerreißen und mit Blut
beschmieren des Kleides Josephs
Nachfrage: Jetzt lassen die Brüder
Joseph ja doch überleben
Ergänzung: Die Liste der Güter, die
die Karawane nach ET bringt, entspricht der, die Jakob seine Söhne später nach
ET mitnehmen heißt.
Genesis Kapitel 41 – Joseph deutet
die Träume des Pharao und wird Vizekönig
Jedenfalls zur Zeit/hier/soweit
liege die Sympathie (der Leserschaft / Zuhörenden /
Beobachtenden) bei Joseph, wie beim beinahe
geopferten Isaak (und nicht einmal beim, von Abraham, tatsächlich der Todesgefahr ausgelieferten
Ismael und seiner Mutter Prinzessin Hagar die G’tt
ernähren/bewahren musste; vgl. Bazon Brock).
Judentum findet Kompromisse die
Befolgung der Thorah-Forderungen ermöglichen
Kontraste: ![]() Josephs Träume stehen in Kontrast zu seinem
Verkauft werden (vorläufiger Tiefpunkt in wellenartiger Bewegung)
Josephs Träume stehen in Kontrast zu seinem
Verkauft werden (vorläufiger Tiefpunkt in wellenartiger Bewegung)
![]() Joseph versus Pharao
Joseph versus Pharao
![]() Fülle versus Hunger
Fülle versus Hunger
![]() Friede (Landschaft und unter
den Brüdern/Mundschenk) versus Tod (gegenüber Joseph/Bäcker)
Friede (Landschaft und unter
den Brüdern/Mundschenk) versus Tod (gegenüber Joseph/Bäcker)
Das zweifache
Träumen
Träumen (überhaupt) als bildhafte
konkrete Sprache
Propheten wurden früher Seher
genannt (1.Sam 9,9)
ET unterscheidet sich 5.Mo.11.10 von
Israel, da es immer Wasser hat (Nil) nicht auf Regen angewiesen ist
Warum legten seine/die Weisen, die
leicht verständlichen Träume Pharaos nicht aus?
Joseph wird in seinem Gleichgewicht
zumindest erschüttert, als er vor Pharao gerufen wird
Nachträge und Vorfrage: ![]() Sicher habe sich Joseph in der Gefahr
befunden, sich (vor Pharao) wie ein 'Halbgott' vorzukommen (sic!)
Sicher habe sich Joseph in der Gefahr
befunden, sich (vor Pharao) wie ein 'Halbgott' vorzukommen (sic!)
![]() Joseph - n.B.
der erste Hofjude - rächt
sich (jedenfalls scheinbar) an seinen Brüdern [- wie kann er ein Gerechter
(Zadik) sein? - vgl. unten]
Joseph - n.B.
der erste Hofjude - rächt
sich (jedenfalls scheinbar) an seinen Brüdern [- wie kann er ein Gerechter
(Zadik) sein? - vgl. unten]
![]() Joseph erhält in Gen.41,45 einen neuen Namen vom Pharao
Joseph erhält in Gen.41,45 einen neuen Namen vom Pharao
![]() Warum sagt Joseph, Gott
wolle dem Pharao Heil (Schalom) verkünden?
Warum sagt Joseph, Gott
wolle dem Pharao Heil (Schalom) verkünden?
Genesis Kapitel 42 – Die 1. Reise
der Brüder nach Ägypten ("Und Joseph stellt sich fremd gegen sie und redet
hart mit ihnen")
Die Waage der Sympathie für den
'Underdog' schlägt nun tendenziell um, von Joseph auf die Brüder
Die Initiative nach Ägypten zu gehen
kommt nicht von den Brüdern, sondern vom alten Jakob
War Jakobs Benehmen seinen Brüdern
gegenüber Rache? - Paßt das - so menschlich es auch
ist – zu einem Gerechten?
Der zweite Traum Josephs (Gestirne
verneigen sich) erfordert dann auch Anwesenheit seiner Eltern)
Nun erst erweist sich, daß Joseph nicht das still erduldende reine Opfer (des Grubenwurfes und Sklavenverkaufs) war, wie man anfangs hätte meinen können
Nachträge: ![]() Beginn der Thematik: Ruben vs. Juda unten
Beginn der Thematik: Ruben vs. Juda unten
![]() Die Vorschläge (Josephs) an
die Brüder ändern sich, nachdem sie sich in ihrem echten Notzustand (im
Gefängnis) nicht entschließen können/wollen
Die Vorschläge (Josephs) an
die Brüder ändern sich, nachdem sie sich in ihrem echten Notzustand (im
Gefängnis) nicht entschließen können/wollen
![]() Die Brüder hasten, zurück
nach Hause
Die Brüder hasten, zurück
nach Hause
![]() Die Brüder berichten Jakob,
ihnen seien Handelsrechte (genauer Saher - O.G.J.: Hausierhandel) in ET angeboten worden, obwohl der
Text nirgends berichtet, daß Joseph dies tat.
Die Brüder berichten Jakob,
ihnen seien Handelsrechte (genauer Saher - O.G.J.: Hausierhandel) in ET angeboten worden, obwohl der
Text nirgends berichtet, daß Joseph dies tat.
Genesis Kapitel 43-44,17 – Die 2.
Reise der Brüder nach Ägypten
Jakobs Weigerung Benjamin
mitzusenden veranlast Ruben zum Vorschlag seine
beiden Söhne als Pfand zu bieten
Ruben verglichen mit Juda - oder wessen Vorschlägen folgt schließlich Jakob?
Bei der zweiten Reise lautet der
Auftrag nur 'ein wenig Getreide' zu kaufen
EXKURS: Darf/Soll man den Heiligen
Text überhaupt übersetzen - da seine volle Bedeutung gar nicht übertragbar ist?
Hebräisch ‚Sehen‘ und ‚Angst
bekommen‘ (in Vwes 16) sind eigentlich identische Wörter
Die Sitzordnung der Brüder, ein
jeder nach seinem (Geburts-)Rang an der hoheitlichen Tafel.
Nachträge: ![]() Der Becher Josephs bedeutet mehr als ein
Trinkgefäß (eher vergleichbar mit dem Ring des Herrschers)
Der Becher Josephs bedeutet mehr als ein
Trinkgefäß (eher vergleichbar mit dem Ring des Herrschers)
![]() Die Brüder schlagen dem sie
Verfolgenden vor, den Schuldigen zu töten und sie als Knechte zu nehmen
Die Brüder schlagen dem sie
Verfolgenden vor, den Schuldigen zu töten und sie als Knechte zu nehmen
![]() Dies wird nicht akzeptiert, sondern Modifiziert, nur der Schuldige
soll, und zwar nur Knecht Josephs sein (vgl. oben Modifikationen beim ersten
Mal im Gefängnis)
Dies wird nicht akzeptiert, sondern Modifiziert, nur der Schuldige
soll, und zwar nur Knecht Josephs sein (vgl. oben Modifikationen beim ersten
Mal im Gefängnis)
![]() Mögliche Reaktionen der
Brüder auf (scheinbar) nachgewiesene neue Schuld:
Mögliche Reaktionen der
Brüder auf (scheinbar) nachgewiesene neue Schuld:
![]() Josephs Abgesandter lehnt
das Angebot (alle Knechte) ab, würde sie - ohne Benjamin – mit Frieden zu ihrem
Vater zurückschicken
Josephs Abgesandter lehnt
das Angebot (alle Knechte) ab, würde sie - ohne Benjamin – mit Frieden zu ihrem
Vater zurückschicken
Genesis Kapitel 44,18-46,7 – Josephs
Aussöhnung mit seinen Brüdern
Juda
bietet sich Joseph als Ersatz für Benjamin an
Struktur des Benehmens von Joseph
insgesamt
Gott habe damit (mit der Tat der
Brüder) "einen Rest Israels" gerettet (erstmals hier: Gen. 45,7)
Der Vater Jakob glaubt der (O.G.J.: ‚guten‘) Nachricht nicht sofort. Auffällig aber ist:
Israel (Jakob) zieht zunächst nach Berscheba, wo er opfert, betet und eine Offenbarung[sic!]
Gottes erhält
Gott meinte es gut - er führte,
begleitete (vgl. Gen 46,4) beide Joseph und dessen Vater Jakob nach Ägypten und
(O.G.J.: physisch-individuell allerdings erst
verstorben) wieder zurück
Joseph läßt
seinem Vater Gen 45,8 bestellen, er sei der 'Vater über Pharao' - war das für
eine 'Stellvertreterposition' nicht etwas übertrieben?
Zusatz: Gen. 50,14-21
vgl. dazu Deuteronium
Rabbah, Schophetium, 15, ed. Liebermann, S. 102 bei J.J. Petuchowski
1979, S. 103
Rabbi Simeon ben
Lakisch erklärte, daß sich
die Heilige Schrift hier "erdichteter Worte" bediente "um
Frieden zwischen Joseph und seinen Brüdern zu stiften". Denn nirgendwo
finden wir, "daß unser Vater Jakob tatsächlich
einen solchen Befehl erlassen hatte. Die Heilige Schrift [O.G.J.:
respektive die Brüder Josephs] bedient sich hier erdichteter Worte - um des
Friedens willen." (S. 103)
O.G.J.: Auffällig, hier, nach Tod und Beisetzung des Vaters Jakob / Jisrael (dem Familienoberhaupt), scheint ferner
![]() der (wiederholte / weiter träumegemäße?) Kotau der Brüder vor Joseph
der (wiederholte / weiter träumegemäße?) Kotau der Brüder vor Joseph
![]() das Angebot
ihrer Knechtschaft Joseph, bis gar Ägypten, gegenüber
das Angebot
ihrer Knechtschaft Joseph, bis gar Ägypten, gegenüber
![]() dessen zwar nicht
Nicht-Akzeptanz, da ihr Verhalten zu Gottes ‚Plänen‘
(zumindest) passte, und dennoch das Patronatsversprechen Josephs gar jahrhundertelang
(anstatt ‚für immer und ewig‘) wirkte; vgl.
dazu auch Lehnsverhältnisse, gar zumal gegenüber (zeitgleich) solchen Venezias
mit/zu ihren ‚Kolonien‘.
dessen zwar nicht
Nicht-Akzeptanz, da ihr Verhalten zu Gottes ‚Plänen‘
(zumindest) passte, und dennoch das Patronatsversprechen Josephs gar jahrhundertelang
(anstatt ‚für immer und ewig‘) wirkte; vgl.
dazu auch Lehnsverhältnisse, gar zumal gegenüber (zeitgleich) solchen Venezias
mit/zu ihren ‚Kolonien‘.
![]() Josephs Fähigkeit 'zum
Herzen' der/aller Brüder zu reden (d.h. zum ganzen Menschen bzw. seinen, bis
gar überindividuellen, Bewusstheiten – nicht nur entweder zu Verstand oder
Gefühl/en)
Josephs Fähigkeit 'zum
Herzen' der/aller Brüder zu reden (d.h. zum ganzen Menschen bzw. seinen, bis
gar überindividuellen, Bewusstheiten – nicht nur entweder zu Verstand oder
Gefühl/en)
![]() Schließlich endet gleich
danach das ganze Buch der Genesis, der anfänglichen Texte von Hervorbringungen
Schließlich endet gleich
danach das ganze Buch der Genesis, der anfänglichen Texte von Hervorbringungen ![]() , zumal der
Väter/Patriarchen in/als /bereschit/
, zumal der
Väter/Patriarchen in/als /bereschit/ ![]() .
.
Es ‚beginne‘ dann ‚die Zeit der
(sic!) Propheten‘ (zumal und namentlich Moses) … [#hier vgl. E.A.S.‘s im Text über diesen
selbst hinaus verweisende Paarungen Prophet versus Patriarch und Pruester versus König, bis zu qualifizierter Phrophetie im Untersched/Gegensatz
zu wahrsagerischen Progmosen/Änfsten]
Es ‚ende‘ die ‚('Ur'-)Zeit‘ der Angaben/Berichte von quasi
‚individuellen‘ (doch eben immerhin grammatisch
teils pluralischen/kollektiven, zumindest und immerhin aber durchaus prototypischen/archetypischen,
geradezu – ‚immerhin‘, bis etwa ‚nur‘ – ‚exemplarischen‘) Persönlichkeiten, Familienstrukturen und Stammesverbände (zumal was die, von/durch G-tt,
belastend-erwählten angeht)
und die Emergenzstufe(n ‚gprupierter Menschen‘) Volk
und Völker (damit auch das ambivalent-kulturalistische,
moderne Phänomen der ‚Nation/en‘) werde zum
manifesten Bestandteil der, so gerne (bis auf Religion
/ Realitätenhandhabungsweisen verkürzend)
‚Heilsentwicklung‘ genannten (nicht nur
eines singulär abstrakt heteronomistischen – und sei
es göttlichen – Heilsplans) für die / (sinnstiftender)
Zweckbestimmung der Menschenheit
– namentlich: zu dienen und geführt zu sein/werden.
[MMP-Mind Map
was/wie so manche Leute ‚Josef‘, gar antisemitisch, zu leugnen trachten, steht
ausdrücklich ‚erst‘ im 2. Mosebuch/ Exodus / schemot
‚Namen‘ – beschreibt/benennt aber ein, bis das, Menschenheitsproblem,
längst nicht nur – bis überhaupt nicht hauptsächlich,
allenfalls scheinbar – semitisch denkende/sprechende (bis ‚komplexer‘
als rein dualistisch empfindende) Menschen, oder gar alleine/erst
Jüdinnen und Juden (nach welchen Definitionen auch
immer), elementar angehend/betreffend]
#eee-Lesung
|
[An, respektive unter oder
in, Kuppeln von San
Marco zu Venedig musifisch (anstatt |
בראשית פרק Genesis Chapter |
[Auch in einem wörtlichen
Sinne eine, durchaus lückenhafte
Fortsetzung an Textauszügen des ersten Mosebuches
der תורה] |
#jojo#ende-toralesung
|
Da, bis warum oder wie
auch immer, diese bildliche
respektive textliche ‚Darstellung‘ hier aufzuhören scheint, auch auf der ‚nächsten‘ site
nicht etwa |
|
#jojo
|
Dogaressa und ‚zofende‘ Edelhofdame ‚sto(o/)l,/pern‘ sie – etwa über (Rand-) Schwelle hinaus, äh – hinein? |
Hoppela – bei so manchen Gedanken liegt es wohl nicht entscheidend an der – kaum bestritten – schweren Lesbarkeit von O.G.J.‘s (gleich gar Online-)Texten, sie lieber, besser erst überhaupt nicht ins/unters Heiligtum lassen zu s/wollen (erst recht falls, oder wo, sie bereits resch-waw-chet ר־ו־ח / vorhanden). |
|
|
Wie bitte, im sogar zwillingsbrüderlich engsten Konkurrenzverhältnis, zumal um Erstgeburtssegen, genügten nicht einmal die allertiefsten Kotau-Reverenzen (Gen. 33:3 ff.) sogar aller Frauen und Kinder (wenn auch einseitig jener, zudem gar Esau ausgeliefert erscheinenden, Jakobs) zur hinreichend dauerhaften Befriedung des künftigen Verhältnisses der wechselseitigen Nachkommenschaften? |
[Dass/Wenn/Fall einander hier ‚Ekklesis‘ und ‚Synagoge‘ vergegnen sollten …] |
Mancher ‚Bibelm‘ Verständmisse künden twar / bekanntlich mit Luther übersetzend / übertreibend:
Jakob (/Israel) habe der Vater Isaak ‚geliebt Esau aber gehasst‘ – doch der akzeptierte
Konsonatentext der Hebräischen
Bibel seht Esau eher bis nur an die zweite Stelle – was berits
genügend Empäromg. Nicht ets
bei Gleichheitsüberbietungen ... Sie
wissen schon.
______________________________________
_____________________________________________
ו. וַתִּגַּשְׁןָ הַשְּׁפָחוֹת הֵנָּה וְיַלְדֵיהֶן וַתִּשְׁתַּחֲוֶיןָ:
33:6. Then the maidservants came near, they and their children, and they
bowed down.
___________________________________________________________________________________
ז. וַתִּגַּשׁ גַּם-לֵאָה וִילָדֶיהָ וַיִּשְׁתַּחֲווּ וְאַחַר נִגַּשׁ יוֹסֵף וְרָחֵל וַיִּשְׁתַּחֲווּ:
33:7. And Leah also with her children came near, and bowed themselves;
and after came Joseph near and Rachel, and they bowed down.
חוה /chawa/ Wurzel-Trippel
להשתחוות
![]()
v. to bow, prostrate oneself
x
השתחוות
![]()
nf. prostrating
oneself, bowing down
So bereits Abram 18:2 als G’tt
ihm begleitet erschien; Lot in sodim
19:1 zur Begrüßung der beiden Engel. Anbeten Abraham 22:5. Abraham vor den Hetitern
23:7+12. 24:26 G’tt dankend/anbetend. 24:48 Anbetung. Abrahams diener Anbetung
24:52. Brüder und Nationen 27:29 dreimal.
33:3 Jakob vor Esau. Erstmals
ausdrücklich auch Frauen nämlich Israels, des bisherigen Jakobs, Edelmägde und
Leha sowie Rahel mit ihren jeweiligen Kindern, in dieser Verbeugungsfrorm
erwähnt (Zitat).
37:7 Jakob.
|
Wie
bitte,
bereits (ver)einfache(nde, (verschwörungs(mytho)logisch schließlich / ursprünglich mit Formen / Varianten von
Judenfeindschaft, meist plus Frauendiskriminierung, einhergehende) Phänomene (des bis je)des ‚Populismus‘
gehören / gehen prototypisch / ‚pharaonisch‘ hierher zurück? Auch / Gerade
Kontrastklarheit maximierende / duakistische Befeindungen gegen Schriftgelehrsamkeit und/oder
qualifiziertes Lernen (zumal
statt ‚zu belehren‘ / anzupassen), erweisen sich als Problem
der Menschenheit insgesamt, nicht etwa
allein oder hauptsächlich der
Benachteiligten: |
[Nicht
einmal alle Populisten sind zornige, kleine alte Männer – oder sonst
physiologisch eindeutig erkennbar] |
|
|
|
|
|
Verständnisse der, bekanntlich
dem nächsten Buch der hebräischen Bibel entstammenden, einschlägigen Passage (schemot / Exodus / 2. Mose 2:6-11), setzen Kenntnisse der ‚Josefsgeschichte‘ voraus: Nach Josefs Tod (Exodus Kapitel
1Vers 6) als
_____________________________________________________________________________
ו. וַיָּמָת יוֹסֵף וְכָל-אֶחָיו וְכֹל הַדּוֹר הַהוּא:
Ex.1:6. And Joseph died, and all his brothers, and all that generation.
_____________________________________________________________________________
ז. וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל פָּרוּ וַיִּשְׁרְצוּ וַיִּרְבּוּ וַיַּעַצְמוּ בִּמְאֹד מְאֹד וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ אֹתָם:
1:7. And the people of Israel were fruitful,
and increased abundantly, and multiplied,
and became exceedingly mighty; and the land was filled with them.
_____________________________________________________________________________
ח. וַיָּקָם מֶלֶךְ-חָדָשׁ עַל-מִצְרָיִם אֲשֶׁר לֹא-יָדַע אֶת-יוֹסֵף:
1:8. And there arose up a new king over Egypt,
who knew not Joseph.
_____________________________________________________________________________
ט. וַיֹּאמֶר אֶל-עַמּוֹ הִנֵּה עַם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל רַב וְעָצוּם מִמֶּנּוּ:
1:9. And he said to his people, Behold, the
people of the children of Israel are more
and mightier than we;
_____________________________________________________________________________
Page 204
Exodus
Exodus
__________________________________
|
|
Kommentare und Anregungen wären willkommen unter: webmaster@jahreiss.eu |
||
|
* |
|
||
|
|
|
by
|